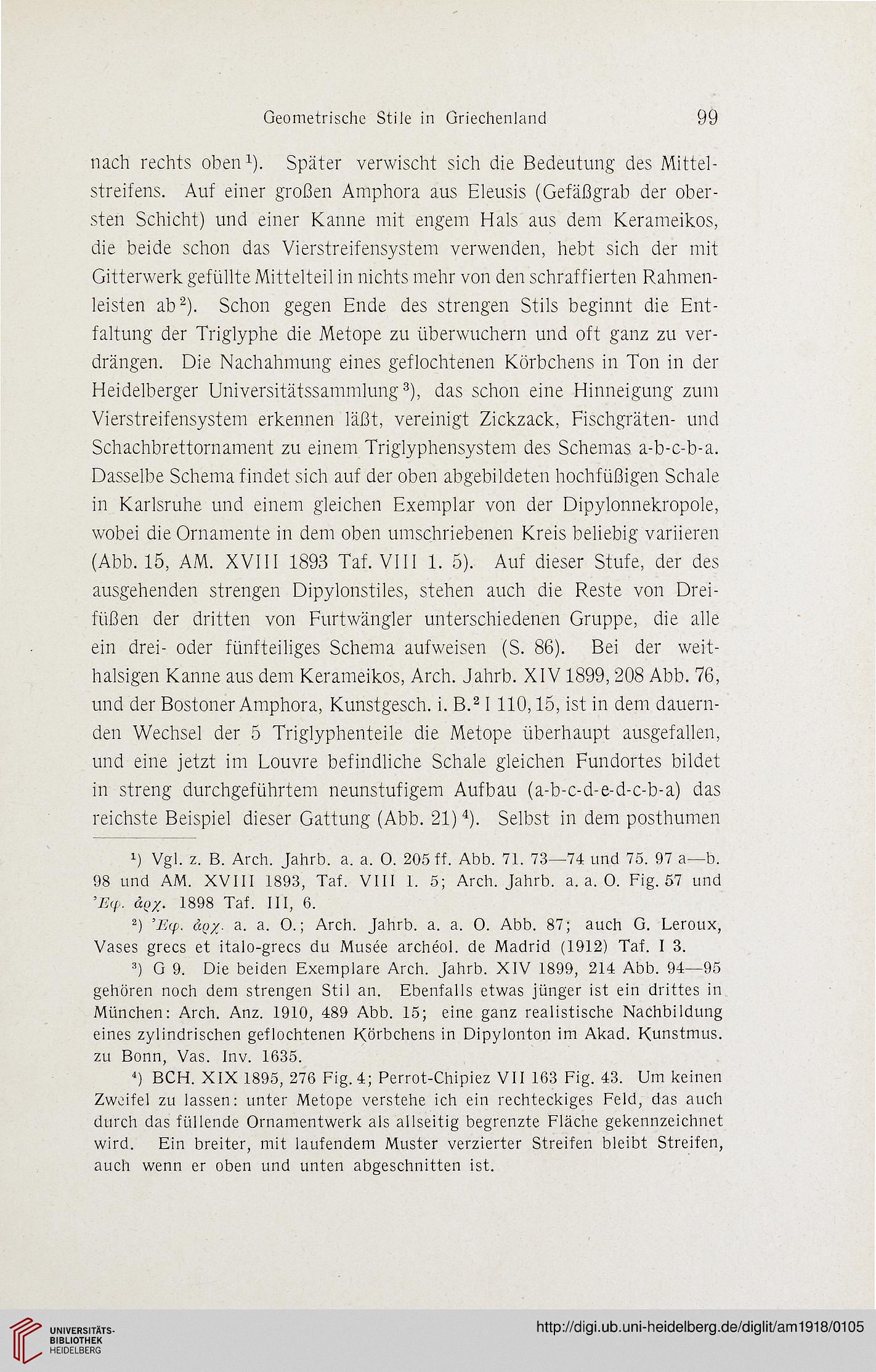Geometrische Stiie in Griecheniand
99
nach rechts oben^). Später verwischt sich die Bedeutung des Alittel-
streifens. Auf einer großen Amphora aus Eieusis (Gefäßgrab der ober-
sten Schicht) und einer Kanne mit engem Hais aus dem Kerameikos,
die beide schon das Vierstreifensystem verwenden, hebt sich der mit
Gitterwerk gefüllte Mittelteil in nichts mehr von den schraffierten Rahmen-
leisten ab 3). Schon gegen Ende des strengen Stils beginnt die Ent-
faltung der Triglyphe die Metope zu überwuchern und oft ganz zu ver-
drängen. Die Nachahmung eines geflochtenen Körbchens in Ton in der
Heidelberger Universitätssammlung 3), das schon eine Hinneigung zum
Vierstreifensystem erkennen läßt, vereinigt Zickzack, Fischgräten- und
Schachbrettornament zu einem Triglyphensystem des Schemas a-b-c-b-a.
Dasselbe Schema findet sich auf der oben abgebildeten hochfüßigen Schale
in Karlsruhe und einem gleichen Exemplar von der Dipylonnekropole,
wobei die Ornamente in dem oben umschriebenen Kreis beliebig variieren
(Abb. 15, AM. XV111 1893 Tat. V1H 1. 5). Auf dieser Stufe, der des
ausgehenden strengen Dipylonstiles, stehen auch die Reste von Drei-
füßen der dritten von Furtwängler unterschiedenen Gruppe, die alle
ein drei- oder fünfteiliges Schema aufweisen (S. 86). Bei der weit-
halsigen Kanne aus dem Kerameikos, Arch. Jahrb. XIV 1899, 208 Abb. 76,
und der Bostoner Amphora, Kunstgesch. i. BT 1 110,15, ist in dem dauern-
den Wechsel der 5 Triglyphenteile die Metope überhaupt ausgefallen,
und eine jetzt im Louvre befindliche Schale gleichen Fundortes bildet
in streng durchgeführtem neunstufigem Aufbau (a-b-c-d-e-d-c-b-a) das
reichste Beispiel dieser Gattung (Abb. 21)^). Selbst in dem posthumen
p Vgi. z. B. Arch. Jahrb. a. a. O. 205 ff. Abb. 71. 73—74 und 75. 97 a—b.
98 und AM. XVHI 1893, Taf. VIH 1. 5; Arch. Jahrb. a. a. 0. Fig. 57 und
dp^. 1898 Taf. III, 6.
2) dp,/, a. a. O.; Arch. Jahrb. a. a. 0. Abb. 87; auch G. Leroux,
Vases grecs et italo-grecs du Musee archeol. de Madrid (1912) Taf. I 3.
h G 9. Die beiden Exemplare Arch. Jahrb. XIV 1899, 214 Abb. 94—95
gehören noch dem strengen Stil an. Ebenfalls etwas jünger ist ein drittes in
München: Arch. Anz. 1910, 489 Abb. 15; eine ganz realistische Nachbildung
eines zylindrischen geflochtenen Körbchens in Dipylonton im Akad. Kunstmus.
zu Bonn, Vas. Inv. 1635.
0 BCH. XIX 1895, 276 Fig. 4; Perrot-Chipiez VII 163 Fig. 43. Um keinen
Zweifel zu lassen: unter Metope verstehe ich ein rechteckiges Feld, das auch
durch das füllende Ornamentwerk als allseitig begrenzte Fläche gekennzeichnet
wird. Ein breiter, mit laufendem Muster verzierter Streifen bleibt Streifen,
auch wenn er oben und unten abgeschnitten ist.
99
nach rechts oben^). Später verwischt sich die Bedeutung des Alittel-
streifens. Auf einer großen Amphora aus Eieusis (Gefäßgrab der ober-
sten Schicht) und einer Kanne mit engem Hais aus dem Kerameikos,
die beide schon das Vierstreifensystem verwenden, hebt sich der mit
Gitterwerk gefüllte Mittelteil in nichts mehr von den schraffierten Rahmen-
leisten ab 3). Schon gegen Ende des strengen Stils beginnt die Ent-
faltung der Triglyphe die Metope zu überwuchern und oft ganz zu ver-
drängen. Die Nachahmung eines geflochtenen Körbchens in Ton in der
Heidelberger Universitätssammlung 3), das schon eine Hinneigung zum
Vierstreifensystem erkennen läßt, vereinigt Zickzack, Fischgräten- und
Schachbrettornament zu einem Triglyphensystem des Schemas a-b-c-b-a.
Dasselbe Schema findet sich auf der oben abgebildeten hochfüßigen Schale
in Karlsruhe und einem gleichen Exemplar von der Dipylonnekropole,
wobei die Ornamente in dem oben umschriebenen Kreis beliebig variieren
(Abb. 15, AM. XV111 1893 Tat. V1H 1. 5). Auf dieser Stufe, der des
ausgehenden strengen Dipylonstiles, stehen auch die Reste von Drei-
füßen der dritten von Furtwängler unterschiedenen Gruppe, die alle
ein drei- oder fünfteiliges Schema aufweisen (S. 86). Bei der weit-
halsigen Kanne aus dem Kerameikos, Arch. Jahrb. XIV 1899, 208 Abb. 76,
und der Bostoner Amphora, Kunstgesch. i. BT 1 110,15, ist in dem dauern-
den Wechsel der 5 Triglyphenteile die Metope überhaupt ausgefallen,
und eine jetzt im Louvre befindliche Schale gleichen Fundortes bildet
in streng durchgeführtem neunstufigem Aufbau (a-b-c-d-e-d-c-b-a) das
reichste Beispiel dieser Gattung (Abb. 21)^). Selbst in dem posthumen
p Vgi. z. B. Arch. Jahrb. a. a. O. 205 ff. Abb. 71. 73—74 und 75. 97 a—b.
98 und AM. XVHI 1893, Taf. VIH 1. 5; Arch. Jahrb. a. a. 0. Fig. 57 und
dp^. 1898 Taf. III, 6.
2) dp,/, a. a. O.; Arch. Jahrb. a. a. 0. Abb. 87; auch G. Leroux,
Vases grecs et italo-grecs du Musee archeol. de Madrid (1912) Taf. I 3.
h G 9. Die beiden Exemplare Arch. Jahrb. XIV 1899, 214 Abb. 94—95
gehören noch dem strengen Stil an. Ebenfalls etwas jünger ist ein drittes in
München: Arch. Anz. 1910, 489 Abb. 15; eine ganz realistische Nachbildung
eines zylindrischen geflochtenen Körbchens in Dipylonton im Akad. Kunstmus.
zu Bonn, Vas. Inv. 1635.
0 BCH. XIX 1895, 276 Fig. 4; Perrot-Chipiez VII 163 Fig. 43. Um keinen
Zweifel zu lassen: unter Metope verstehe ich ein rechteckiges Feld, das auch
durch das füllende Ornamentwerk als allseitig begrenzte Fläche gekennzeichnet
wird. Ein breiter, mit laufendem Muster verzierter Streifen bleibt Streifen,
auch wenn er oben und unten abgeschnitten ist.