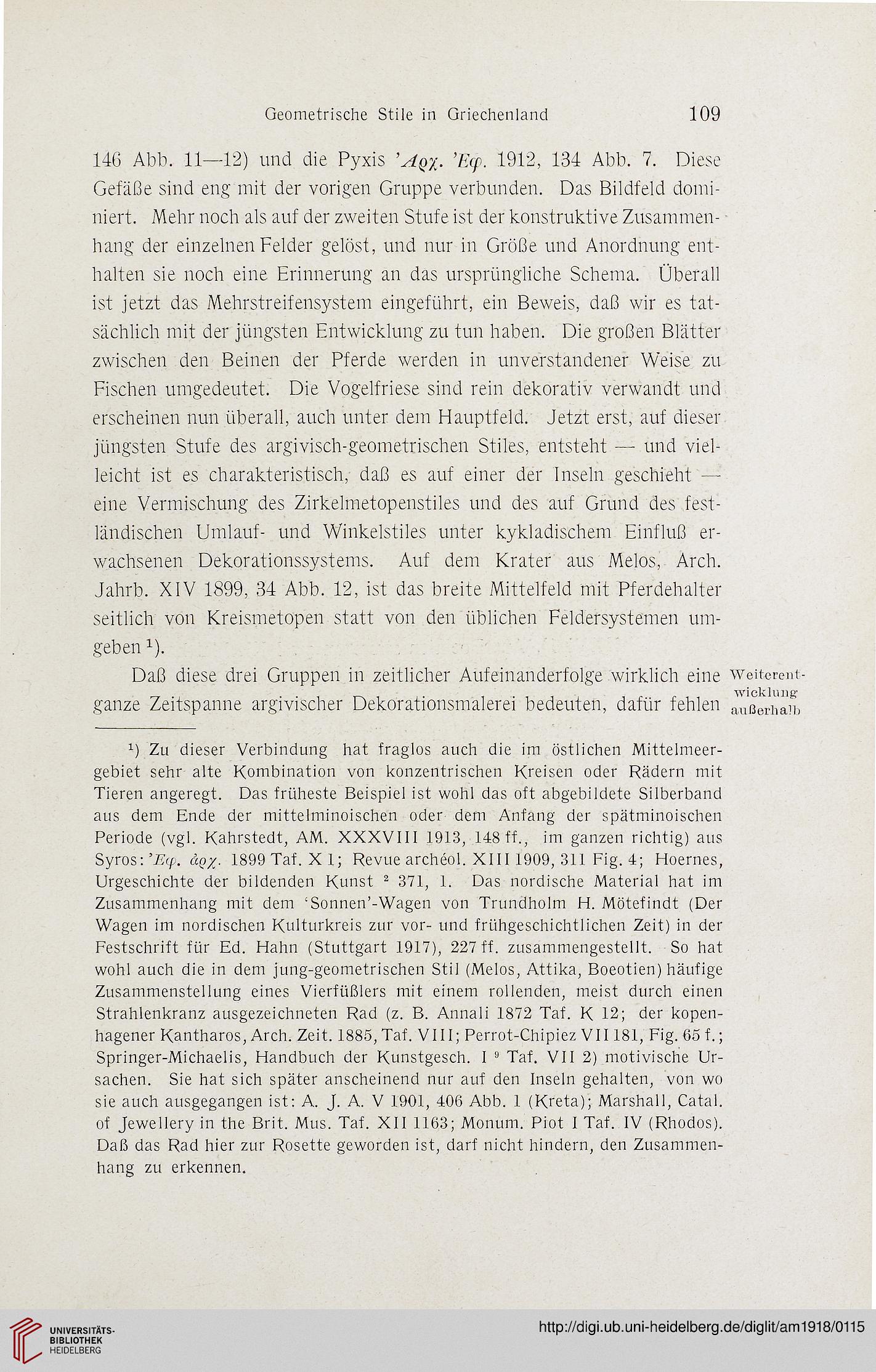Geometrische Stiie in Griecheniand
109
14G Abb. 11—12) und die Pyxis Wfpx. Wy. 1912, 134 Abb. 7. Diese
Gefäße sind eng mit der vorigen Gruppe verbunden. Das Bildfeid domi-
niert. Mehr noch als auf der zweiten Stufe ist der konstruktive Zusammen-
hang der einzelnen Felder gelöst, und nur in Größe und Anordnung ent-
halten sie noch eine Erinnerung an das ursprüngliche Schema. Überall
ist jetzt das Mehrstreifensystem eingeführt, ein Beweis, daß wir es tat-
sächlich mit der jüngsten Entwicklung zu tun haben. Die großen Blätter
zwischen den Beinen der Pferde werden in unverstandener Weise zu
Fischen umgedeutet. Die Vogelfriese sind rein dekorativ verwandt und
erscheinen nun überall, auch unter dem Flauptfeld. Jetzt erst, auf dieser
jüngsten Stufe des argivisch-geometrischen Stiles, entsteht — und viel-
leicht ist es charakteristisch, daß es auf einer der Inseln geschieht -
eine Vermischung des Zirkelmetopenstiles und des auf Grund des fest-
ländischen Umlauf- und Winkelstiles unter kykladischem Einfluß er-
wachsenen Dekorationssystems. Auf dem Krater aus Melos, Arch.
Jahrb. XIV 1899, 34 Abb. 12, ist das breite Mittelfeld mit Pferdehalter
seitlich von Kreismetopen statt von den üblichen Feldersystemen um-
geben i).
Daß diese drei Gruppen in zeitlicher Aufeinanderfolge wirklich eine weitcrem-
ganze Zeitspanne argivischer Dekorationsmalerei bedeuten, dafür fehlen
i) Zu dieser Verbindung hat fragios auch die im östiichen Mitteimeer-
gebiet sehr aite Kombination von konzentrischen Kreisen oder Rädern mit
Tieren angeregt. Das früheste Beispiei ist wohi das oft abgebiidete Siiberband
aus dem Ende der mitteiminoischen oder dem Anfang der spätminoischen
Periode (vgl. Kahrstedt, AM. XXXVIH 1913, 148 ff., im ganzen richtig) aus
Syros:'-7?y. dpx- 1899 Tat. XI; Revuearcheol. XIII 1909,311 Fig. 4; Hoernes,
Urgeschichte der bildenden Knnst " 371, 1. Das nordische Material hat im
Zusammenhang mit dem 'Sonnen'-Wagen von Trundholm H. Mötefindt (Der
Wagen im nordischen Knlturkreis zur vor- und frühgeschichtlichen Zeit) in der
Festschrift für Ed. Hahn (Stuttgart 1917), 227 ff. zusammengestellt. So hat
wohl auch die in dem jung-geometrischen Stil (Melos, Attika, Boeotien) häufige
Zusammenstellung eines Vierfüßlers mit einem rollenden, meist durch einen
Strahlenkranz ausgezeichneten Rad (z. B. Annali 1872 Tat. K 12; der kopen-
hagener Kantharos, Arch. Zeit. 1885, Taf. V1 H; Perrot-Chipiez VII181, Fig. 65 f.;
Springer-Michaelis, Handbuch der Kunstgesch. I " Taf. VII 2) motivische Ur-
sachen. Sie hat sich später anscheinend nur auf den Inseln gehalten, von wo
sie auch ausgegangen ist: A. J. A. V 1901, 406 Abb. 1 (Kreta); Marshall, Catal.
of Jewellery in the Brit. Mus. Taf. XII 1163; Monum. Piot I Taf. IV (Rhodos).
Daß das Rad hier zur Rosette geworden ist, darf nicht hindern, den Zusammen-
hang zu erkennen.
109
14G Abb. 11—12) und die Pyxis Wfpx. Wy. 1912, 134 Abb. 7. Diese
Gefäße sind eng mit der vorigen Gruppe verbunden. Das Bildfeid domi-
niert. Mehr noch als auf der zweiten Stufe ist der konstruktive Zusammen-
hang der einzelnen Felder gelöst, und nur in Größe und Anordnung ent-
halten sie noch eine Erinnerung an das ursprüngliche Schema. Überall
ist jetzt das Mehrstreifensystem eingeführt, ein Beweis, daß wir es tat-
sächlich mit der jüngsten Entwicklung zu tun haben. Die großen Blätter
zwischen den Beinen der Pferde werden in unverstandener Weise zu
Fischen umgedeutet. Die Vogelfriese sind rein dekorativ verwandt und
erscheinen nun überall, auch unter dem Flauptfeld. Jetzt erst, auf dieser
jüngsten Stufe des argivisch-geometrischen Stiles, entsteht — und viel-
leicht ist es charakteristisch, daß es auf einer der Inseln geschieht -
eine Vermischung des Zirkelmetopenstiles und des auf Grund des fest-
ländischen Umlauf- und Winkelstiles unter kykladischem Einfluß er-
wachsenen Dekorationssystems. Auf dem Krater aus Melos, Arch.
Jahrb. XIV 1899, 34 Abb. 12, ist das breite Mittelfeld mit Pferdehalter
seitlich von Kreismetopen statt von den üblichen Feldersystemen um-
geben i).
Daß diese drei Gruppen in zeitlicher Aufeinanderfolge wirklich eine weitcrem-
ganze Zeitspanne argivischer Dekorationsmalerei bedeuten, dafür fehlen
i) Zu dieser Verbindung hat fragios auch die im östiichen Mitteimeer-
gebiet sehr aite Kombination von konzentrischen Kreisen oder Rädern mit
Tieren angeregt. Das früheste Beispiei ist wohi das oft abgebiidete Siiberband
aus dem Ende der mitteiminoischen oder dem Anfang der spätminoischen
Periode (vgl. Kahrstedt, AM. XXXVIH 1913, 148 ff., im ganzen richtig) aus
Syros:'-7?y. dpx- 1899 Tat. XI; Revuearcheol. XIII 1909,311 Fig. 4; Hoernes,
Urgeschichte der bildenden Knnst " 371, 1. Das nordische Material hat im
Zusammenhang mit dem 'Sonnen'-Wagen von Trundholm H. Mötefindt (Der
Wagen im nordischen Knlturkreis zur vor- und frühgeschichtlichen Zeit) in der
Festschrift für Ed. Hahn (Stuttgart 1917), 227 ff. zusammengestellt. So hat
wohl auch die in dem jung-geometrischen Stil (Melos, Attika, Boeotien) häufige
Zusammenstellung eines Vierfüßlers mit einem rollenden, meist durch einen
Strahlenkranz ausgezeichneten Rad (z. B. Annali 1872 Tat. K 12; der kopen-
hagener Kantharos, Arch. Zeit. 1885, Taf. V1 H; Perrot-Chipiez VII181, Fig. 65 f.;
Springer-Michaelis, Handbuch der Kunstgesch. I " Taf. VII 2) motivische Ur-
sachen. Sie hat sich später anscheinend nur auf den Inseln gehalten, von wo
sie auch ausgegangen ist: A. J. A. V 1901, 406 Abb. 1 (Kreta); Marshall, Catal.
of Jewellery in the Brit. Mus. Taf. XII 1163; Monum. Piot I Taf. IV (Rhodos).
Daß das Rad hier zur Rosette geworden ist, darf nicht hindern, den Zusammen-
hang zu erkennen.