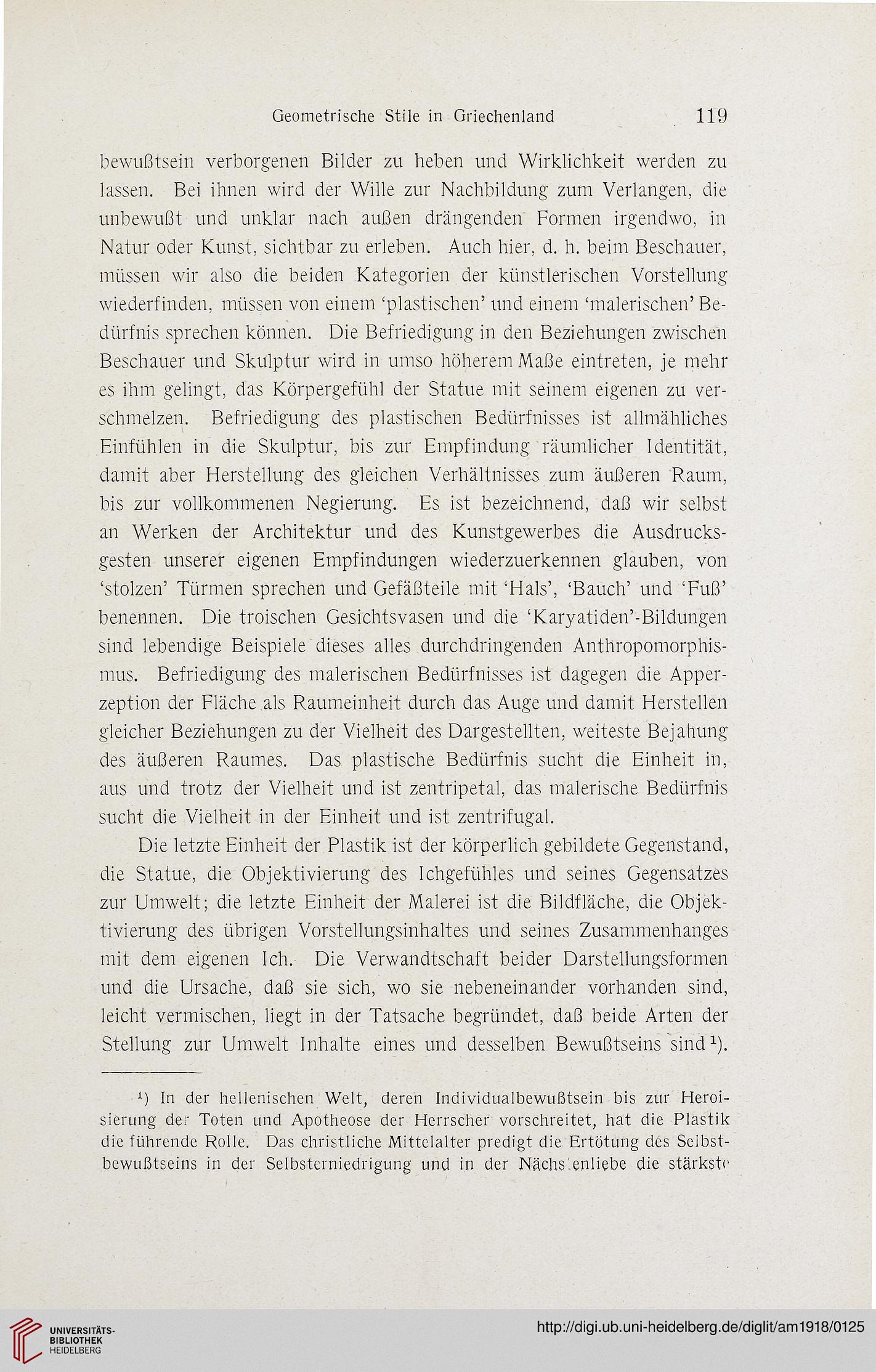Geometrische Stile in Griecheniand
119
bewußtsein verborgenen Bilder zu heben und Wirklichkeit werden zu
lassen. Bei ihnen wird der Wille zur Nachbildung zum Verlangen, die
unbewußt und unklar nach außen drängenden Formen irgendwo, in
Natur oder Kunst, sichtbar zu erleben. Auch hier, d. h. beim Beschauer,
müssen wir also die beiden Kategorien der künstlerischen Vorstellung
wiederfinden, müssen von einem 'plastischen' und einem 'malerischen' Be-
dürfnis sprechen können. Die Befriedigung in den Beziehungen zwischen
Beschauer und Skulptur wird in umso höherem Maße eintreten, je mehr
es ihm gelingt, das Körpergefühl der Statue mit seinem eigenen zu ver-
schmelzen. Befriedigung des plastischen Bedürfnisses ist allmähliches
Einfühlen in die Skulptur, bis zur Empfindung räumlicher Identität,
damit aber Herstellung des gleichen Verhältnisses zum äußeren Raum,
bis zur vollkommenen Negierung. Es ist bezeichnend, daß wir selbst
an Werken der Architektur und des Kunstgewerbes die Ausdrucks-
gesten unserer eigenen Empfindungen wiederzuerkennen glauben, von
'stolzen' Türmen sprechen und Gefäßteile mit 'Hals', 'Bauch' und 'Fuß'
benennen. Die troischen Gesichtsvasen und die 'Karyatiden'-Bildungen
sind lebendige Beispiele dieses alles durchdringenden Anthropomorphis-
mus. Befriedigung des malerischen Bedürfnisses ist dagegen die Apper-
zeption der Fläche als Raumeinheit durch das Auge und damit Herstellen
gleicher Beziehungen zu der Vielheit des Dargestellten, weiteste Bejahung
des äußeren Raumes. Das plastische Bedürfnis sucht die Einheit in,
aus und trotz der Vielheit und ist zentripetal, das malerische Bedürfnis
sucht die Vielheit in der Einheit und ist zentrifugal.
Die letzte Einheit der Plastik ist der körperlich gebildete Gegenstand,
die Statue, die Objektivierung des Ichgefühles und seines Gegensatzes
zur Umwelt; die letzte Einheit der Malerei ist die Bildfläche, die Objek-
tivierung des übrigen Vorstellungsinhaltes und seines Zusammenhanges
mit dem eigenen Ich. Die Verwandtschaft beider Darstellungsformen
und die Ursache, daß sie sich, wo sie nebeneinander vorhanden sind,
leicht vermischen, liegt in der Tatsache begründet, daß beide Arten der
Stellung zur Umwelt Inhalte eines und desselben Bewußtseins sind^).
B ln der hellenischen Welt, deren Individualbewußtsein bis zur Heroi-
sierung der Toten und Apotheose der Herrscher vorschreitet, hat die Plastik
die führende Rolle. Das christliche Mittelalter predigt die Ertötung des Sclbst-
bcwußtseins in der Selbsterniedrigung und in der Nächstenliebe die stärkste
119
bewußtsein verborgenen Bilder zu heben und Wirklichkeit werden zu
lassen. Bei ihnen wird der Wille zur Nachbildung zum Verlangen, die
unbewußt und unklar nach außen drängenden Formen irgendwo, in
Natur oder Kunst, sichtbar zu erleben. Auch hier, d. h. beim Beschauer,
müssen wir also die beiden Kategorien der künstlerischen Vorstellung
wiederfinden, müssen von einem 'plastischen' und einem 'malerischen' Be-
dürfnis sprechen können. Die Befriedigung in den Beziehungen zwischen
Beschauer und Skulptur wird in umso höherem Maße eintreten, je mehr
es ihm gelingt, das Körpergefühl der Statue mit seinem eigenen zu ver-
schmelzen. Befriedigung des plastischen Bedürfnisses ist allmähliches
Einfühlen in die Skulptur, bis zur Empfindung räumlicher Identität,
damit aber Herstellung des gleichen Verhältnisses zum äußeren Raum,
bis zur vollkommenen Negierung. Es ist bezeichnend, daß wir selbst
an Werken der Architektur und des Kunstgewerbes die Ausdrucks-
gesten unserer eigenen Empfindungen wiederzuerkennen glauben, von
'stolzen' Türmen sprechen und Gefäßteile mit 'Hals', 'Bauch' und 'Fuß'
benennen. Die troischen Gesichtsvasen und die 'Karyatiden'-Bildungen
sind lebendige Beispiele dieses alles durchdringenden Anthropomorphis-
mus. Befriedigung des malerischen Bedürfnisses ist dagegen die Apper-
zeption der Fläche als Raumeinheit durch das Auge und damit Herstellen
gleicher Beziehungen zu der Vielheit des Dargestellten, weiteste Bejahung
des äußeren Raumes. Das plastische Bedürfnis sucht die Einheit in,
aus und trotz der Vielheit und ist zentripetal, das malerische Bedürfnis
sucht die Vielheit in der Einheit und ist zentrifugal.
Die letzte Einheit der Plastik ist der körperlich gebildete Gegenstand,
die Statue, die Objektivierung des Ichgefühles und seines Gegensatzes
zur Umwelt; die letzte Einheit der Malerei ist die Bildfläche, die Objek-
tivierung des übrigen Vorstellungsinhaltes und seines Zusammenhanges
mit dem eigenen Ich. Die Verwandtschaft beider Darstellungsformen
und die Ursache, daß sie sich, wo sie nebeneinander vorhanden sind,
leicht vermischen, liegt in der Tatsache begründet, daß beide Arten der
Stellung zur Umwelt Inhalte eines und desselben Bewußtseins sind^).
B ln der hellenischen Welt, deren Individualbewußtsein bis zur Heroi-
sierung der Toten und Apotheose der Herrscher vorschreitet, hat die Plastik
die führende Rolle. Das christliche Mittelalter predigt die Ertötung des Sclbst-
bcwußtseins in der Selbsterniedrigung und in der Nächstenliebe die stärkste