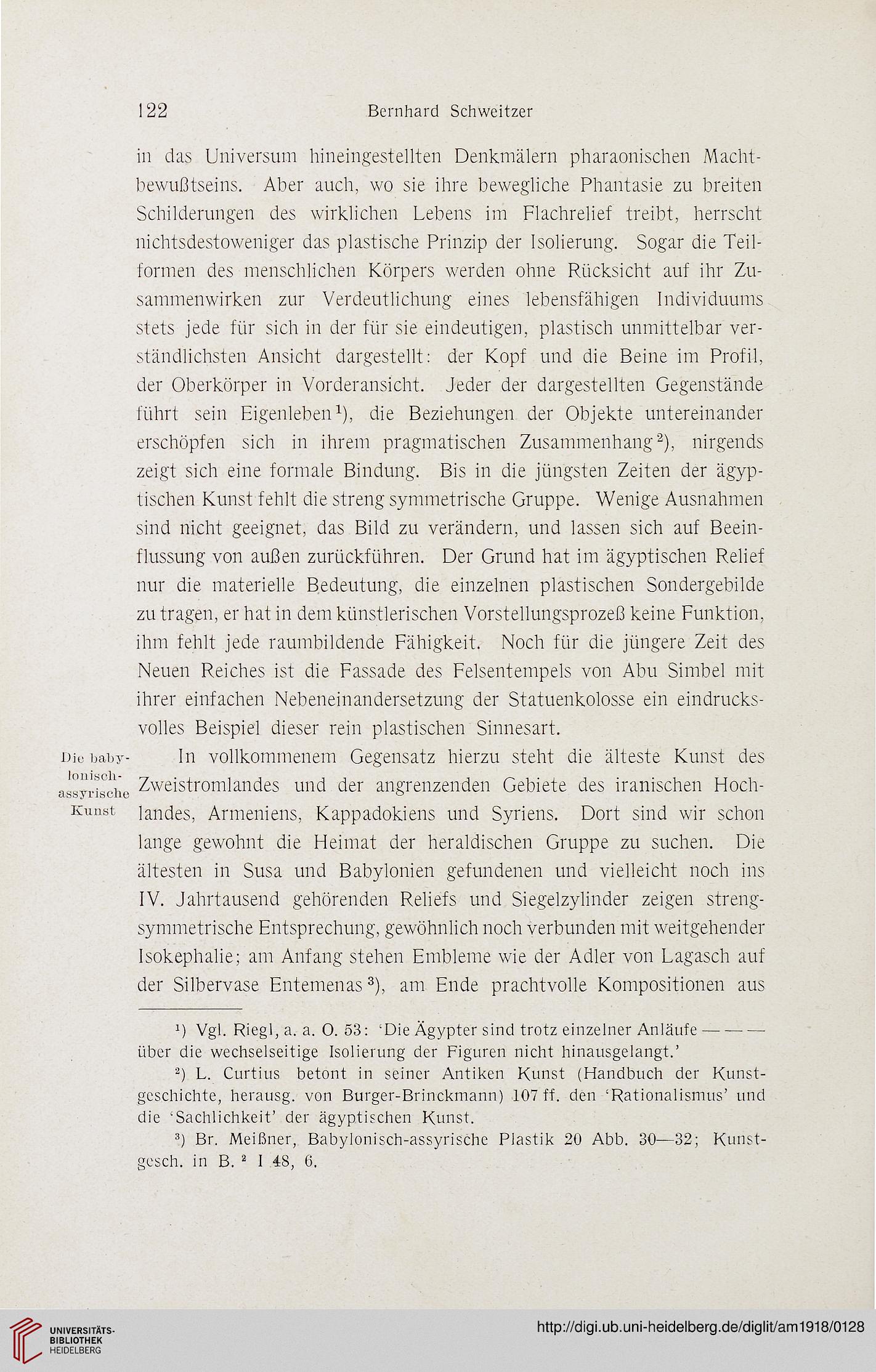122
Bernhard Schweitzer
in das Universum hineingesteliten Denkmälern pharaonischen Macht-
bewußtseins. Aber auch, wo sie ihre bewegliche Phantasie zu breiten
Schilderungen des wirklichen Lebens im Flachrelief treibt, herrscht
nichtsdestoweniger das plastische Prinzip der Isolierung. Sogar die Teil-
formen des menschlichen Körpers werden ohne Rücksicht auf ihr Zu-
sammenwirken zur Verdeutlichung eines lebensfähigen Individuums
stets jede für sich in der für sie eindeutigen, plastisch unmittelbar ver-
ständlichsten Ansicht dargestellt: der Kopf und die Beine im Profil,
der Oberkörper in Vorderansicht. Jeder der dargestellten Gegenstände
führt sein Eigenleben^), die Beziehungen der Objekte untereinander
erschöpfen sich in ihrem pragmatischen Zusammenhang^), nirgends
zeigt sich eine formale Bindung. Bis in die jüngsten Zeiten der ägyp-
tischen Kunst fehlt die streng symmetrische Gruppe. Wenige Ausnahmen
sind nicht geeignet, das Bild zu verändern, und lassen sich auf Beein-
flussung von außen zurückführen. Der Grund hat im ägyptischen Relief
nur die materielle Bedeutung, die einzelnen plastischen Sondergebilde
zu tragen, er hat in dem künstlerischen Vorstellungsprozeß keine Funktion,
ihm fehlt jede raumbildende Fähigkeit. Noch für die jüngere Zeit des
Neuen Reiches ist die Fassade des Felsentempels von Abu Simbel mit
ihrer einfachen Nebeneinandersefzung der Statuenkolosse ein eindrucks-
volles Beispiel dieser rein plastischen Sinnesart.
ln vollkommenem Gegensatz hierzu steht die älteste Kunst des
Zweistromlandes und der angrenzenden Gebiete des iranischen Hoch-
landes, Armeniens, Kappadokiens und Syriens. Dort sind wir schon
lange gewohnt die Heimat der heraldischen Gruppe zu suchen. Die
ältesten in Susa und Babylonien gefundenen und vielleicht noch ins
IV. Jahrtausend gehörenden Reliefs und Siegelzylinder zeigen streng-
symmetrische Entsprechung, gewöhnlich noch verbunden mit weitgehender
Isokephalie; am Anfang stehen Embleme wie der Adler von Lagasch auf
der Silbervase Entemenas 3), am Ende prachtvolle Kompositionen aus
') Vgl. Riegl, a. a. 0. 53: 'Die Ägypter sind trotz einzelner Anläufe-
über die wechselseitige Isolierung der Figuren nicht hinausgelangt.'
h L. Curtius betont in seiner Antiken Kunst (Handbuch der Kunst-
geschichte, herausg. von Burger-Brinckmann) 107 ff. den 'Rationalismus' und
die 'Sachlichkeit' der ägyptischen Kunst.
2) Br. Meißner, Babylonisch-assyrische Plastik 20 Abb. 30—32; Kunst-
gesch. in B. ^ l 48, G.
Bernhard Schweitzer
in das Universum hineingesteliten Denkmälern pharaonischen Macht-
bewußtseins. Aber auch, wo sie ihre bewegliche Phantasie zu breiten
Schilderungen des wirklichen Lebens im Flachrelief treibt, herrscht
nichtsdestoweniger das plastische Prinzip der Isolierung. Sogar die Teil-
formen des menschlichen Körpers werden ohne Rücksicht auf ihr Zu-
sammenwirken zur Verdeutlichung eines lebensfähigen Individuums
stets jede für sich in der für sie eindeutigen, plastisch unmittelbar ver-
ständlichsten Ansicht dargestellt: der Kopf und die Beine im Profil,
der Oberkörper in Vorderansicht. Jeder der dargestellten Gegenstände
führt sein Eigenleben^), die Beziehungen der Objekte untereinander
erschöpfen sich in ihrem pragmatischen Zusammenhang^), nirgends
zeigt sich eine formale Bindung. Bis in die jüngsten Zeiten der ägyp-
tischen Kunst fehlt die streng symmetrische Gruppe. Wenige Ausnahmen
sind nicht geeignet, das Bild zu verändern, und lassen sich auf Beein-
flussung von außen zurückführen. Der Grund hat im ägyptischen Relief
nur die materielle Bedeutung, die einzelnen plastischen Sondergebilde
zu tragen, er hat in dem künstlerischen Vorstellungsprozeß keine Funktion,
ihm fehlt jede raumbildende Fähigkeit. Noch für die jüngere Zeit des
Neuen Reiches ist die Fassade des Felsentempels von Abu Simbel mit
ihrer einfachen Nebeneinandersefzung der Statuenkolosse ein eindrucks-
volles Beispiel dieser rein plastischen Sinnesart.
ln vollkommenem Gegensatz hierzu steht die älteste Kunst des
Zweistromlandes und der angrenzenden Gebiete des iranischen Hoch-
landes, Armeniens, Kappadokiens und Syriens. Dort sind wir schon
lange gewohnt die Heimat der heraldischen Gruppe zu suchen. Die
ältesten in Susa und Babylonien gefundenen und vielleicht noch ins
IV. Jahrtausend gehörenden Reliefs und Siegelzylinder zeigen streng-
symmetrische Entsprechung, gewöhnlich noch verbunden mit weitgehender
Isokephalie; am Anfang stehen Embleme wie der Adler von Lagasch auf
der Silbervase Entemenas 3), am Ende prachtvolle Kompositionen aus
') Vgl. Riegl, a. a. 0. 53: 'Die Ägypter sind trotz einzelner Anläufe-
über die wechselseitige Isolierung der Figuren nicht hinausgelangt.'
h L. Curtius betont in seiner Antiken Kunst (Handbuch der Kunst-
geschichte, herausg. von Burger-Brinckmann) 107 ff. den 'Rationalismus' und
die 'Sachlichkeit' der ägyptischen Kunst.
2) Br. Meißner, Babylonisch-assyrische Plastik 20 Abb. 30—32; Kunst-
gesch. in B. ^ l 48, G.