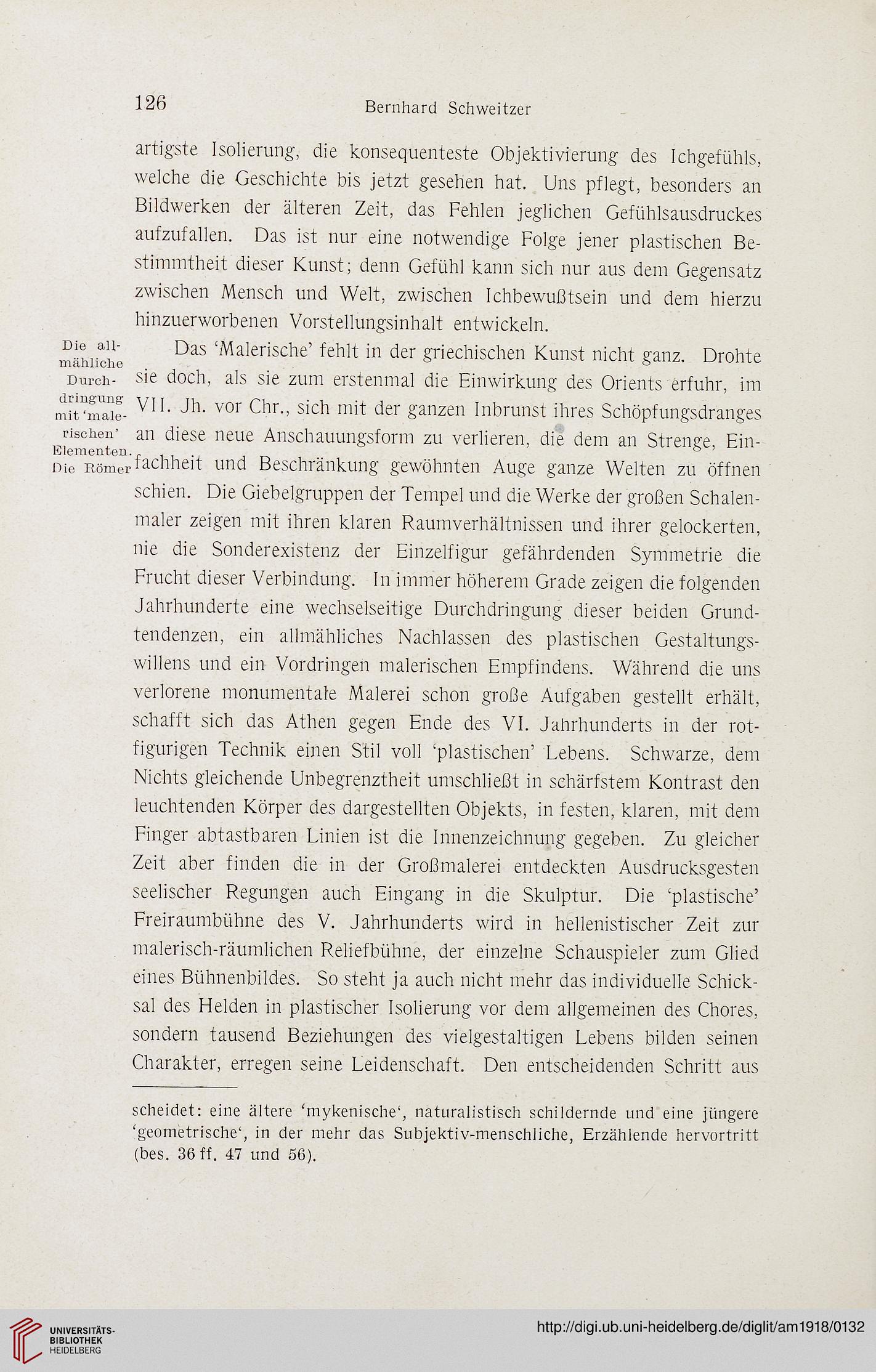126
Bernhard Schweitzer
artigste Isolierung, die konsequenteste Objektivierung des Ichgefühls,
welche die Geschichte bis jetzt gesehen hat. Uns pflegt, besonders an
Bildwerken der älteren Zeit, das Fehlen jeglichen Gefühlsausdruckes
aufzufallen. Das ist nur eine notwendige Folge jener plastischen Be-
stimmtheit dieser Kunst; denn Gefühl kann sich nur aus dem Gegensatz
zwischen Mensch und Welt, zwischen Ichbewußtsein und dem hierzu
hinzuerworbenen Vorstellungsinhalt entwickeln.
Die an- Das 'Malerische' fehlt in der griechischen Kunst nicht ganz. Drohte
Durch- sie doch, als sie zum erstenmal die Einwirkung des Orients erfuhr, im
n!mmue- Chr., sich mit der ganzen Inbrunst ihres Schöpfungsdranges
rischen' an diese neue Anschauungsform zu verlieren, die dem an Strenge, Ein-
Di< Römer fachheit und Beschränkung gewöhnten Auge ganze Welten zu öffnen
schien. Die Giebelgruppen der Tempel und die Werke der großen Schalen-
maler zeigen mit ihren klaren Raumverhältnissen und ihrer gelockerten,
nie die Sonderexistenz der Einzelfigur gefährdenden Symmetrie die
Frucht dieser Verbindung, ln immer höherem Grade zeigen die folgenden
Jahrhunderte eine wechselseitige Durchdringung dieser beiden Grund-
tendenzen, ein allmähliches Nachlassen des plastischen Gestaltungs-
willens und ein Vordringen malerischen Empfindens. Während die uns
verlorene monumentale Malerei schon große Aufgaben gestellt erhält,
schafft sich das Athen gegen Ende des VI. Jahrhunderts in der rot-
figurigen Technik einen Stil voll 'plastischen' Lebens. Schwarze, dem
Nichts gleichende Unbegrenztheit umschließt in schärfstem Kontrast den
leuchtenden Körper des dargestellten Objekts, in festen, klaren, mit dem
Finger abtastbaren Linien ist die Innenzeichnung gegeben. Zu gleicher
Zeit aber finden die in der Großmalerei entdeckten Ausdrucksgesten
seelischer Regungen auch Eingang in die Skulptur. Die 'plastische'
Freiraumbühne des V. Jahrhunderts wird in hellenistischer Zeit zur
malerisch-räumlichen Reliefbühne, der einzelne Schauspieler zum Glied
eines Bühnenbildes. So steht ja auch nicht mehr das individuelle Schick-
sal des Helden in plastischer Isolierung vor dem allgemeinen des Chores,
sondern tausend Beziehungen des vielgestaltigen Lebens bilden seinen
Charakter, erregen seine Leidenschaft. Den entscheidenden Schritt aus
scheidet: eine äitere 'mykenische', naturaiistisch schiidernde und eine jüngere
'geometrische', in der mehr das Subjektiv-menschiiche, Erzähiende hervortritt
(bes. 36 ff. 47 und 56).
Bernhard Schweitzer
artigste Isolierung, die konsequenteste Objektivierung des Ichgefühls,
welche die Geschichte bis jetzt gesehen hat. Uns pflegt, besonders an
Bildwerken der älteren Zeit, das Fehlen jeglichen Gefühlsausdruckes
aufzufallen. Das ist nur eine notwendige Folge jener plastischen Be-
stimmtheit dieser Kunst; denn Gefühl kann sich nur aus dem Gegensatz
zwischen Mensch und Welt, zwischen Ichbewußtsein und dem hierzu
hinzuerworbenen Vorstellungsinhalt entwickeln.
Die an- Das 'Malerische' fehlt in der griechischen Kunst nicht ganz. Drohte
Durch- sie doch, als sie zum erstenmal die Einwirkung des Orients erfuhr, im
n!mmue- Chr., sich mit der ganzen Inbrunst ihres Schöpfungsdranges
rischen' an diese neue Anschauungsform zu verlieren, die dem an Strenge, Ein-
Di< Römer fachheit und Beschränkung gewöhnten Auge ganze Welten zu öffnen
schien. Die Giebelgruppen der Tempel und die Werke der großen Schalen-
maler zeigen mit ihren klaren Raumverhältnissen und ihrer gelockerten,
nie die Sonderexistenz der Einzelfigur gefährdenden Symmetrie die
Frucht dieser Verbindung, ln immer höherem Grade zeigen die folgenden
Jahrhunderte eine wechselseitige Durchdringung dieser beiden Grund-
tendenzen, ein allmähliches Nachlassen des plastischen Gestaltungs-
willens und ein Vordringen malerischen Empfindens. Während die uns
verlorene monumentale Malerei schon große Aufgaben gestellt erhält,
schafft sich das Athen gegen Ende des VI. Jahrhunderts in der rot-
figurigen Technik einen Stil voll 'plastischen' Lebens. Schwarze, dem
Nichts gleichende Unbegrenztheit umschließt in schärfstem Kontrast den
leuchtenden Körper des dargestellten Objekts, in festen, klaren, mit dem
Finger abtastbaren Linien ist die Innenzeichnung gegeben. Zu gleicher
Zeit aber finden die in der Großmalerei entdeckten Ausdrucksgesten
seelischer Regungen auch Eingang in die Skulptur. Die 'plastische'
Freiraumbühne des V. Jahrhunderts wird in hellenistischer Zeit zur
malerisch-räumlichen Reliefbühne, der einzelne Schauspieler zum Glied
eines Bühnenbildes. So steht ja auch nicht mehr das individuelle Schick-
sal des Helden in plastischer Isolierung vor dem allgemeinen des Chores,
sondern tausend Beziehungen des vielgestaltigen Lebens bilden seinen
Charakter, erregen seine Leidenschaft. Den entscheidenden Schritt aus
scheidet: eine äitere 'mykenische', naturaiistisch schiidernde und eine jüngere
'geometrische', in der mehr das Subjektiv-menschiiche, Erzähiende hervortritt
(bes. 36 ff. 47 und 56).