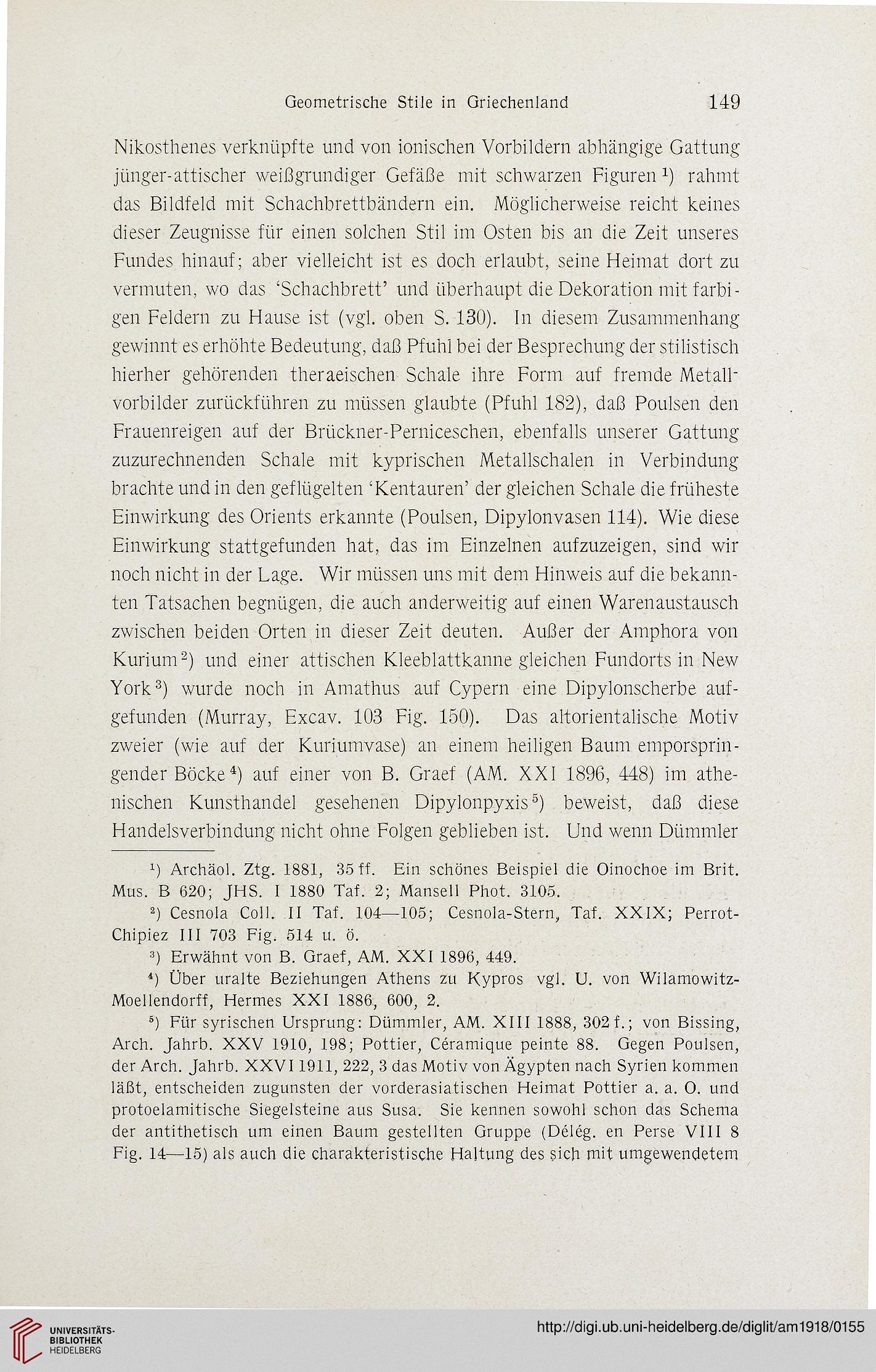Geometrische Stiie in Griecheniand
149
Nikosthenes verknüpfte und von ionischen Vorbildern abhängige Gattung
jünger-attischer weißgrundiger Gefäße mit schwarzen Figuren * *) rahmt
das Bildfeld mit Schachbrettbändern ein. Möglicherweise reicht keines
dieser Zeugnisse für einen solchen Stil im Osten bis an die Zeit unseres
Fundes hinauf; aber vielleicht ist es doch erlaubt, seine Heimat dort zu
vermuten, wo das 'Schachbrett' und überhaupt die Dekoration mit farbi-
gen Feldern zu Hause ist (vgl. oben S. 130). ln diesem Zusammenhang
gewinnt es erhöhte Bedeutung, daß Pfuhl bei der Besprechung der stilistisch
hierher gehörenden theraeischen Schale ihre Form auf fremde Metalk
Vorbilder zurückführen zu müssen glaubte (Pfuhl 182), daß Poulsen den
Frauenreigen auf der Brückner-Perniceschen, ebenfalls unserer Gattung
zuzurechnenden Schale mit kyprischen Metallschalen in Verbindung
brachte und in den geflügelten 'Kentauren' der gleichen Schale die früheste
Einwirkung des Orients erkannte (Poulsen, Dipylonvasen 114). Wie diese
Einwirkung stattgefunden hat, das im Einzelnen aufzuzeigen, sind wir
noch nicht in der Lage. Wir müssen uns mit dem Hinweis auf die bekann-
ten Tatsachen begnügen, die auch anderweitig auf einen Warenaustausch
zwischen beiden Orten in dieser Zeit deuten. Außer der Amphora von
KuriunD) und einer attischen Kleeblattkanne gleichen Fundorts in New
York 3) wurde noch in Ainathus auf Cypern eine Dipylonscherbe auf-
gefunden (Murray, Excav. 103 Fig. 150). Das altorientalische Motiv
zweier (wie auf der Kuriumvase) an einem heiligen Baum emporsprin-
gender Böcke*) auf einer von B. Graef (AM. XXI 1896, 448) im athe-
nischen Kunsthandel gesehenen Dipylonpyxis^) beweist, daß diese
Handelsverbindung nicht ohne Folgen geblieben ist. Und wenn Dümmler
p Archäo). Ztg. 1881, 35 ff. Ein schönes Beispie! die Oinochoe im Brit.
Mus. B 62Ü; JHS. I 1880 Taf. 2; Manseii Phot. 3105.
2) Cesnoia Coh. H Taf. 104—105; Cesno!a-Stern, Taf. XXIX; Perrot-
Chipiez III 703 Fig. 514 u. ö.
2) Erwähnt von B. Graef, AM. XXI 1896, 449.
*) Über uralte Beziehungen Athens zu Kypros vgi. U. von Wiiamowitz-
Moellendorff, Hermes XXI 1886, 600, 2.
b Für syrischen Ursprung: Dümmler, AM. XIII 1888, 302 f.; von Bissing,
Arch. Jahrb. XXV 1910, 198; Pottier, Ceramique peinte 88. Gegen Poulsen,
der Arch. Jahrb. XXVI1911, 222, 3 das Motiv von Ägypten nach Syrien kommen
täßt, entscheiden zugunsten der vorderasiatischen Heimat Pottier a. a. 0. und
protoeiamitische Siegelsteine aus Susa. Sie kennen sowohl schon das Schema
der antithetisch um einen Baum gesteilten Gruppe (Deleg. en Perse VIII 8
Fig. 14—15) als auch die charakteristische Haltung des sich mit umgewendetem
149
Nikosthenes verknüpfte und von ionischen Vorbildern abhängige Gattung
jünger-attischer weißgrundiger Gefäße mit schwarzen Figuren * *) rahmt
das Bildfeld mit Schachbrettbändern ein. Möglicherweise reicht keines
dieser Zeugnisse für einen solchen Stil im Osten bis an die Zeit unseres
Fundes hinauf; aber vielleicht ist es doch erlaubt, seine Heimat dort zu
vermuten, wo das 'Schachbrett' und überhaupt die Dekoration mit farbi-
gen Feldern zu Hause ist (vgl. oben S. 130). ln diesem Zusammenhang
gewinnt es erhöhte Bedeutung, daß Pfuhl bei der Besprechung der stilistisch
hierher gehörenden theraeischen Schale ihre Form auf fremde Metalk
Vorbilder zurückführen zu müssen glaubte (Pfuhl 182), daß Poulsen den
Frauenreigen auf der Brückner-Perniceschen, ebenfalls unserer Gattung
zuzurechnenden Schale mit kyprischen Metallschalen in Verbindung
brachte und in den geflügelten 'Kentauren' der gleichen Schale die früheste
Einwirkung des Orients erkannte (Poulsen, Dipylonvasen 114). Wie diese
Einwirkung stattgefunden hat, das im Einzelnen aufzuzeigen, sind wir
noch nicht in der Lage. Wir müssen uns mit dem Hinweis auf die bekann-
ten Tatsachen begnügen, die auch anderweitig auf einen Warenaustausch
zwischen beiden Orten in dieser Zeit deuten. Außer der Amphora von
KuriunD) und einer attischen Kleeblattkanne gleichen Fundorts in New
York 3) wurde noch in Ainathus auf Cypern eine Dipylonscherbe auf-
gefunden (Murray, Excav. 103 Fig. 150). Das altorientalische Motiv
zweier (wie auf der Kuriumvase) an einem heiligen Baum emporsprin-
gender Böcke*) auf einer von B. Graef (AM. XXI 1896, 448) im athe-
nischen Kunsthandel gesehenen Dipylonpyxis^) beweist, daß diese
Handelsverbindung nicht ohne Folgen geblieben ist. Und wenn Dümmler
p Archäo). Ztg. 1881, 35 ff. Ein schönes Beispie! die Oinochoe im Brit.
Mus. B 62Ü; JHS. I 1880 Taf. 2; Manseii Phot. 3105.
2) Cesnoia Coh. H Taf. 104—105; Cesno!a-Stern, Taf. XXIX; Perrot-
Chipiez III 703 Fig. 514 u. ö.
2) Erwähnt von B. Graef, AM. XXI 1896, 449.
*) Über uralte Beziehungen Athens zu Kypros vgi. U. von Wiiamowitz-
Moellendorff, Hermes XXI 1886, 600, 2.
b Für syrischen Ursprung: Dümmler, AM. XIII 1888, 302 f.; von Bissing,
Arch. Jahrb. XXV 1910, 198; Pottier, Ceramique peinte 88. Gegen Poulsen,
der Arch. Jahrb. XXVI1911, 222, 3 das Motiv von Ägypten nach Syrien kommen
täßt, entscheiden zugunsten der vorderasiatischen Heimat Pottier a. a. 0. und
protoeiamitische Siegelsteine aus Susa. Sie kennen sowohl schon das Schema
der antithetisch um einen Baum gesteilten Gruppe (Deleg. en Perse VIII 8
Fig. 14—15) als auch die charakteristische Haltung des sich mit umgewendetem