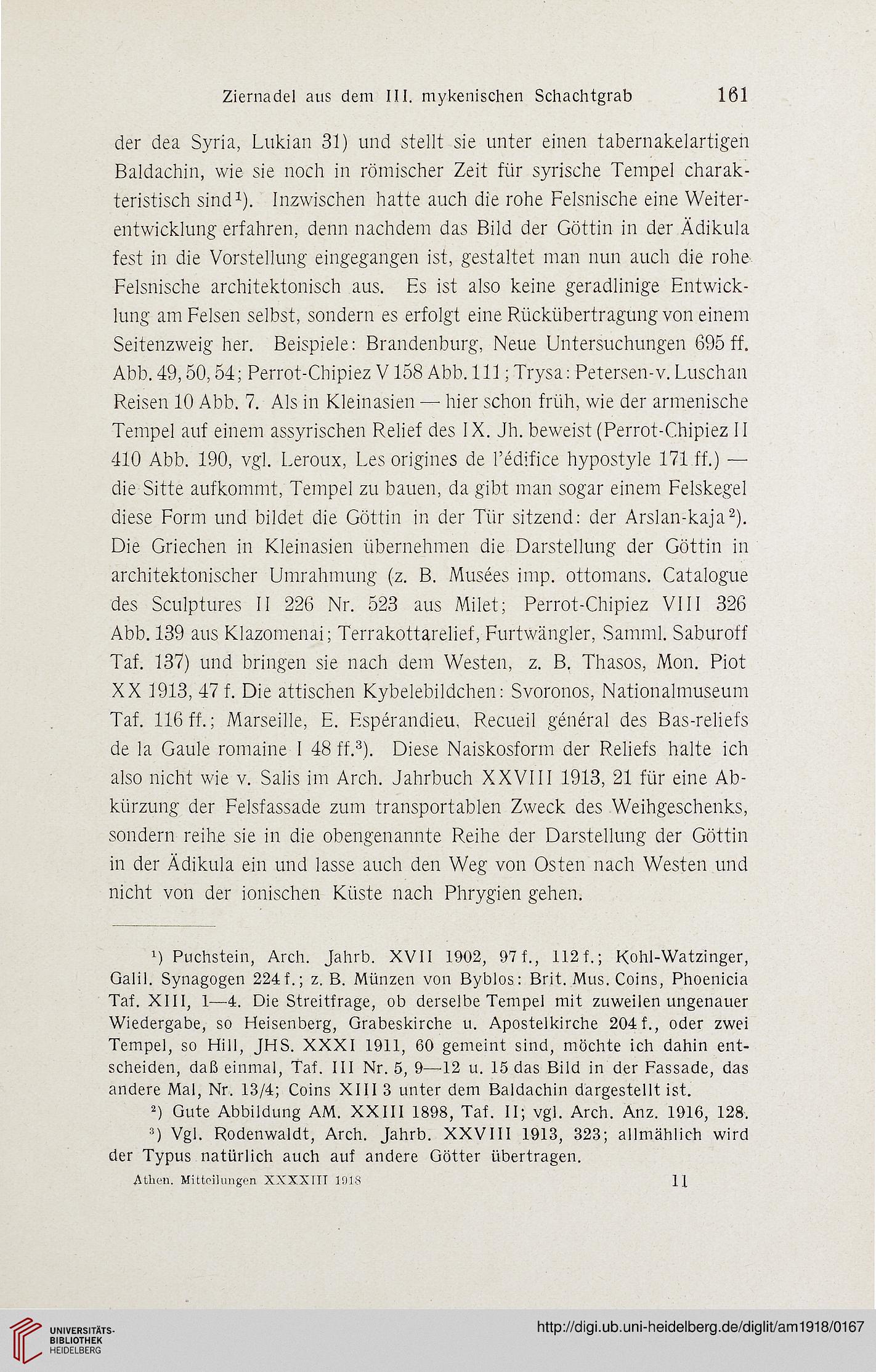Ziernadei aus dem III. mykenischen Schachtgrab
161
der dea Syria, Lukian 31) und stellt sie unter einen tabernakelartigen
Baldachin, wie sie noch in römischer Zeit für syrische Tempel charak-
teristisch sind^). Inzwischen hatte auch die rohe Felsnische eine Weiter-
entwicklung erfahren, denn nachdem das Bild der Göttin in der Ädikula
fest in die Vorstellung eingegangen ist, gestaltet man nun auch die rohe
Felsnische architektonisch aus. Fs ist also keine geradlinige Entwick-
lung am Felsen selbst, sondern es erfolgt eine Rückübertragung von einem
Seitenzweig her. Beispiele: Brandenburg, Neue Untersuchungen 695 ff.
Abb. 49,50,54; Perrot-Chipiez V 158Abb. 111 ;Trysa: Petersen-v. Luschan
Reisen 10 Abb. 7. Als in Kleinasien — hier schon früh, wie der armenische
Tempel auf einem assyrischen Relief des IX. Jh. beweist (Perrot-Chipiez 11
410 Abb. 190, vgl. Leroux, Les origines de l'edifice hypostyle 171 ff.) —
die Sitte aufkommt, Tempel zu bauen, da gibt man sogar einem Felskegel
diese Form und bildet die Göttin in der Tür sitzend: der Arslan-kaja^).
Die Griechen in Kleinasien übernehmen die Darstellung der Göttin in
architektonischer Umrahmung (z. B. Musees imp. ottomans. Catalogue
des Sculptures H 226 Nr. 523 aus Alilet; Perrot-Chipiez VIM 326
Abb. 139 aus Klazomenai; Terrakottarelief, Furtwängler, Samml. Saburoff
Taf. 137) und bringen sie nach dem Westen, z. B. Thasos, Mon. Piot
XX 1913, 47 f. Die attischen Kybelebildchen: Svoronos, Nationalmuseum
Taf. 116 ff.; Marseille, E. Esperandieu, Recueil general des Bas-reliefs
de la Gaule romaine 1 48 ffA). Diese Naiskosform der Reliefs halte ich
also nicht wie v. Salis im Arch. Jahrbuch XXVIH 1913, 21 für eine Ab-
kürzung der Felsfassade zum transportablen Zweck des Weihgeschenks,
sondern reihe sie in die obengenannte Reihe der Darstellung der Göttin
in der Ädikula ein und lasse auch den Weg von Osten nach Westen und
nicht von der ionischen Küste nach Phrygien gehen.
0 Puchstein, Arch. Jahrb. XVII 1902, 97 f., 112 f.; Kohl-Watzinger,
Caiil. Synagogen 224f.; z. B. Münzen von Byblos: Brit. Mus.Coins, Phoenicia
Taf. Xm, 1—4. Die Streitfrage, ob derselbe Tenrpei mit zuweilen ungenauer
Wiedergabe, so Heisenberg, Grabeskirche u. Apostelkirche 204 f., oder zwei
Tempel, so Hill, JHS. XXXI 1911, 60 gemeint sind, möchte ich dahin ent-
scheiden, daß einmal, Taf. III Nr. 5, 9—12 u. 15 das Bild in der Fassade, das
andere Mal, Nr. 13/4; Coins XIII 3 unter dem Baldachin dargestellt ist.
H Gute Abbildung AM. XXIII 1898, Taf. II; vgl. Arch. Anz. 1916, 128.
O Vgl. Rodenwaldt, Arch. Jahrb. XXVIII 1913, 323; allmählich wird
der Typus natürlich auch auf andere Götter übertragen.
Athen. Mitteilungen XXXXIII liMS 11
161
der dea Syria, Lukian 31) und stellt sie unter einen tabernakelartigen
Baldachin, wie sie noch in römischer Zeit für syrische Tempel charak-
teristisch sind^). Inzwischen hatte auch die rohe Felsnische eine Weiter-
entwicklung erfahren, denn nachdem das Bild der Göttin in der Ädikula
fest in die Vorstellung eingegangen ist, gestaltet man nun auch die rohe
Felsnische architektonisch aus. Fs ist also keine geradlinige Entwick-
lung am Felsen selbst, sondern es erfolgt eine Rückübertragung von einem
Seitenzweig her. Beispiele: Brandenburg, Neue Untersuchungen 695 ff.
Abb. 49,50,54; Perrot-Chipiez V 158Abb. 111 ;Trysa: Petersen-v. Luschan
Reisen 10 Abb. 7. Als in Kleinasien — hier schon früh, wie der armenische
Tempel auf einem assyrischen Relief des IX. Jh. beweist (Perrot-Chipiez 11
410 Abb. 190, vgl. Leroux, Les origines de l'edifice hypostyle 171 ff.) —
die Sitte aufkommt, Tempel zu bauen, da gibt man sogar einem Felskegel
diese Form und bildet die Göttin in der Tür sitzend: der Arslan-kaja^).
Die Griechen in Kleinasien übernehmen die Darstellung der Göttin in
architektonischer Umrahmung (z. B. Musees imp. ottomans. Catalogue
des Sculptures H 226 Nr. 523 aus Alilet; Perrot-Chipiez VIM 326
Abb. 139 aus Klazomenai; Terrakottarelief, Furtwängler, Samml. Saburoff
Taf. 137) und bringen sie nach dem Westen, z. B. Thasos, Mon. Piot
XX 1913, 47 f. Die attischen Kybelebildchen: Svoronos, Nationalmuseum
Taf. 116 ff.; Marseille, E. Esperandieu, Recueil general des Bas-reliefs
de la Gaule romaine 1 48 ffA). Diese Naiskosform der Reliefs halte ich
also nicht wie v. Salis im Arch. Jahrbuch XXVIH 1913, 21 für eine Ab-
kürzung der Felsfassade zum transportablen Zweck des Weihgeschenks,
sondern reihe sie in die obengenannte Reihe der Darstellung der Göttin
in der Ädikula ein und lasse auch den Weg von Osten nach Westen und
nicht von der ionischen Küste nach Phrygien gehen.
0 Puchstein, Arch. Jahrb. XVII 1902, 97 f., 112 f.; Kohl-Watzinger,
Caiil. Synagogen 224f.; z. B. Münzen von Byblos: Brit. Mus.Coins, Phoenicia
Taf. Xm, 1—4. Die Streitfrage, ob derselbe Tenrpei mit zuweilen ungenauer
Wiedergabe, so Heisenberg, Grabeskirche u. Apostelkirche 204 f., oder zwei
Tempel, so Hill, JHS. XXXI 1911, 60 gemeint sind, möchte ich dahin ent-
scheiden, daß einmal, Taf. III Nr. 5, 9—12 u. 15 das Bild in der Fassade, das
andere Mal, Nr. 13/4; Coins XIII 3 unter dem Baldachin dargestellt ist.
H Gute Abbildung AM. XXIII 1898, Taf. II; vgl. Arch. Anz. 1916, 128.
O Vgl. Rodenwaldt, Arch. Jahrb. XXVIII 1913, 323; allmählich wird
der Typus natürlich auch auf andere Götter übertragen.
Athen. Mitteilungen XXXXIII liMS 11