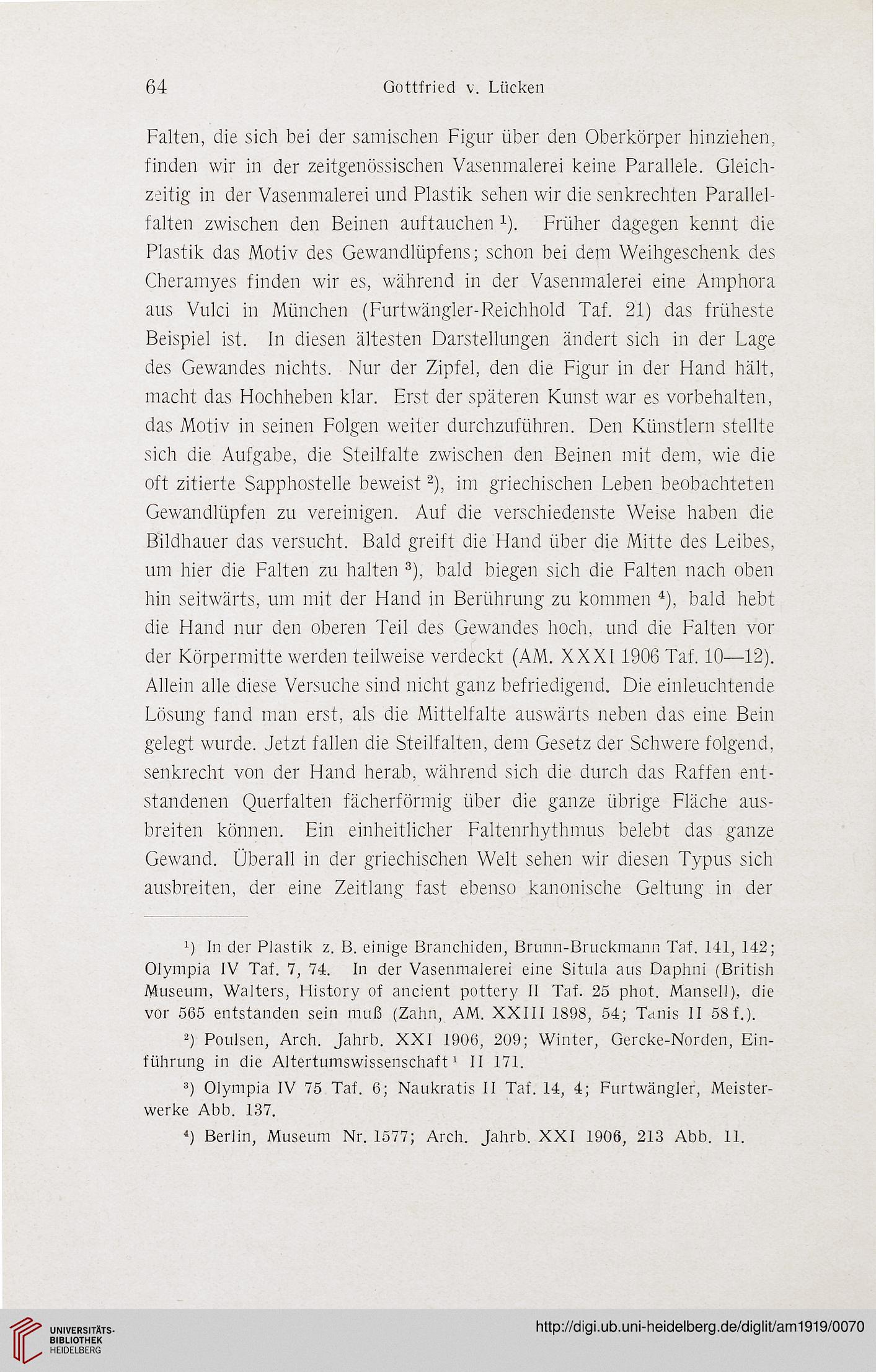64
Gottfried v. Lücken
Falten, die sich bei der samischen Figur über den Oberkörper hinziehen,
finden wir in der zeitgenössischen Vasenmalerei keine Parallele. Gleich-
zeitig in der Vasenmalerei und Plastik sehen wir die senkrechten Parallel-
falten zwischen den Beinen auftauchen Q. Früher dagegen kennt die
Plastik das Motiv des Gewandlüpfens; schon bei dem Weihgeschenk des
Cheramyes finden wir es, während in der Vasenmalerei eine Amphora
aus Vulci in München (Furtwängler-Reichhold Taf. 21) das früheste
Beispiel ist. ln diesen ältesten Darstellungen ändert sich in der Lage
des Gewandes nichts. Nur der Zipfel, den die Figur in der Hand hält,
macht das Hochheben klar. Erst der späteren Kunst war es Vorbehalten,
das Motiv in seinen Folgen weiter durchzuführen. Den Künstlern stellte
sich die Aufgabe, die Steilfalte zwischen den Beinen mit dem, wie die
oft zitierte Sapphostelle beweist Ü, im griechischen Leben beobachteten
Gewandlüpfen zu vereinigen. Auf die verschiedenste Weise haben die
Bildhauer das versucht. Bald greift die Hand über die Mitte des Leibes,
um hier die Falten zu halten Ü, bald biegen sich die Falten nach oben
hin seitwärts, um mit der Hand in Berührung zu kommen Q, bald hebt
die Hand nur den oberen Teil des Gewandes hoch, und die Falten vor
der Körpermitte werden teilweise verdeckt (AM. XXX! 1906 Taf. 10—12).
Allein alle diese Versuche sind nicht ganz befriedigend. Die einleuchtende
Lösung fand man erst, als die Mittelfalte auswärts neben das eine Bein
gelegt wurde. Jetzt fallen die Steilfalten, dem Gesetz der Schwere folgend,
senkrecht von der Hand herab, während sich die durch das Raffen ent-
standenen Querfalten fächerförmig über die ganze übrige Fläche aus-
breiten können. Ein einheitlicher Faltenrhythmus belebt das ganze
Gewand. Überall in der griechischen Welt sehen wir diesen Typus sich
ausbreiten, der eine Zeitlang fast ebenso kanonische Geltung in der
1) ln der Piastik z. B. einige Branchiden, Brunn-Bruckmann Taf. 141, 142;
Oiympia IV Taf. 7, 74. ln der Vasenmaierei eine Situia aus Daphni (British
Museum, Waiters, History of ancient pottery H Taf. 25 phot. Manseii), die
vor 565 entstanden sein muß (Zahn, AM. XXIIi 1898, 54; Tunis Π 58 f.).
h Pouisen, Arch. Jahrb. XXi 1906, 209; Winter, Gercke-Norden, Ein-
führung in die Aitertumswissenschaft* II 171.
2) Oiympia IV 75 Taf. 6; Naukratis II Taf. 14, 4; Furtwängler, Meister-
werke Abb. 137.
') Beriin, Museum Nr. 1577; Arch. Jahrb. XXI 1906, 213 Abb. 11.
Gottfried v. Lücken
Falten, die sich bei der samischen Figur über den Oberkörper hinziehen,
finden wir in der zeitgenössischen Vasenmalerei keine Parallele. Gleich-
zeitig in der Vasenmalerei und Plastik sehen wir die senkrechten Parallel-
falten zwischen den Beinen auftauchen Q. Früher dagegen kennt die
Plastik das Motiv des Gewandlüpfens; schon bei dem Weihgeschenk des
Cheramyes finden wir es, während in der Vasenmalerei eine Amphora
aus Vulci in München (Furtwängler-Reichhold Taf. 21) das früheste
Beispiel ist. ln diesen ältesten Darstellungen ändert sich in der Lage
des Gewandes nichts. Nur der Zipfel, den die Figur in der Hand hält,
macht das Hochheben klar. Erst der späteren Kunst war es Vorbehalten,
das Motiv in seinen Folgen weiter durchzuführen. Den Künstlern stellte
sich die Aufgabe, die Steilfalte zwischen den Beinen mit dem, wie die
oft zitierte Sapphostelle beweist Ü, im griechischen Leben beobachteten
Gewandlüpfen zu vereinigen. Auf die verschiedenste Weise haben die
Bildhauer das versucht. Bald greift die Hand über die Mitte des Leibes,
um hier die Falten zu halten Ü, bald biegen sich die Falten nach oben
hin seitwärts, um mit der Hand in Berührung zu kommen Q, bald hebt
die Hand nur den oberen Teil des Gewandes hoch, und die Falten vor
der Körpermitte werden teilweise verdeckt (AM. XXX! 1906 Taf. 10—12).
Allein alle diese Versuche sind nicht ganz befriedigend. Die einleuchtende
Lösung fand man erst, als die Mittelfalte auswärts neben das eine Bein
gelegt wurde. Jetzt fallen die Steilfalten, dem Gesetz der Schwere folgend,
senkrecht von der Hand herab, während sich die durch das Raffen ent-
standenen Querfalten fächerförmig über die ganze übrige Fläche aus-
breiten können. Ein einheitlicher Faltenrhythmus belebt das ganze
Gewand. Überall in der griechischen Welt sehen wir diesen Typus sich
ausbreiten, der eine Zeitlang fast ebenso kanonische Geltung in der
1) ln der Piastik z. B. einige Branchiden, Brunn-Bruckmann Taf. 141, 142;
Oiympia IV Taf. 7, 74. ln der Vasenmaierei eine Situia aus Daphni (British
Museum, Waiters, History of ancient pottery H Taf. 25 phot. Manseii), die
vor 565 entstanden sein muß (Zahn, AM. XXIIi 1898, 54; Tunis Π 58 f.).
h Pouisen, Arch. Jahrb. XXi 1906, 209; Winter, Gercke-Norden, Ein-
führung in die Aitertumswissenschaft* II 171.
2) Oiympia IV 75 Taf. 6; Naukratis II Taf. 14, 4; Furtwängler, Meister-
werke Abb. 137.
') Beriin, Museum Nr. 1577; Arch. Jahrb. XXI 1906, 213 Abb. 11.