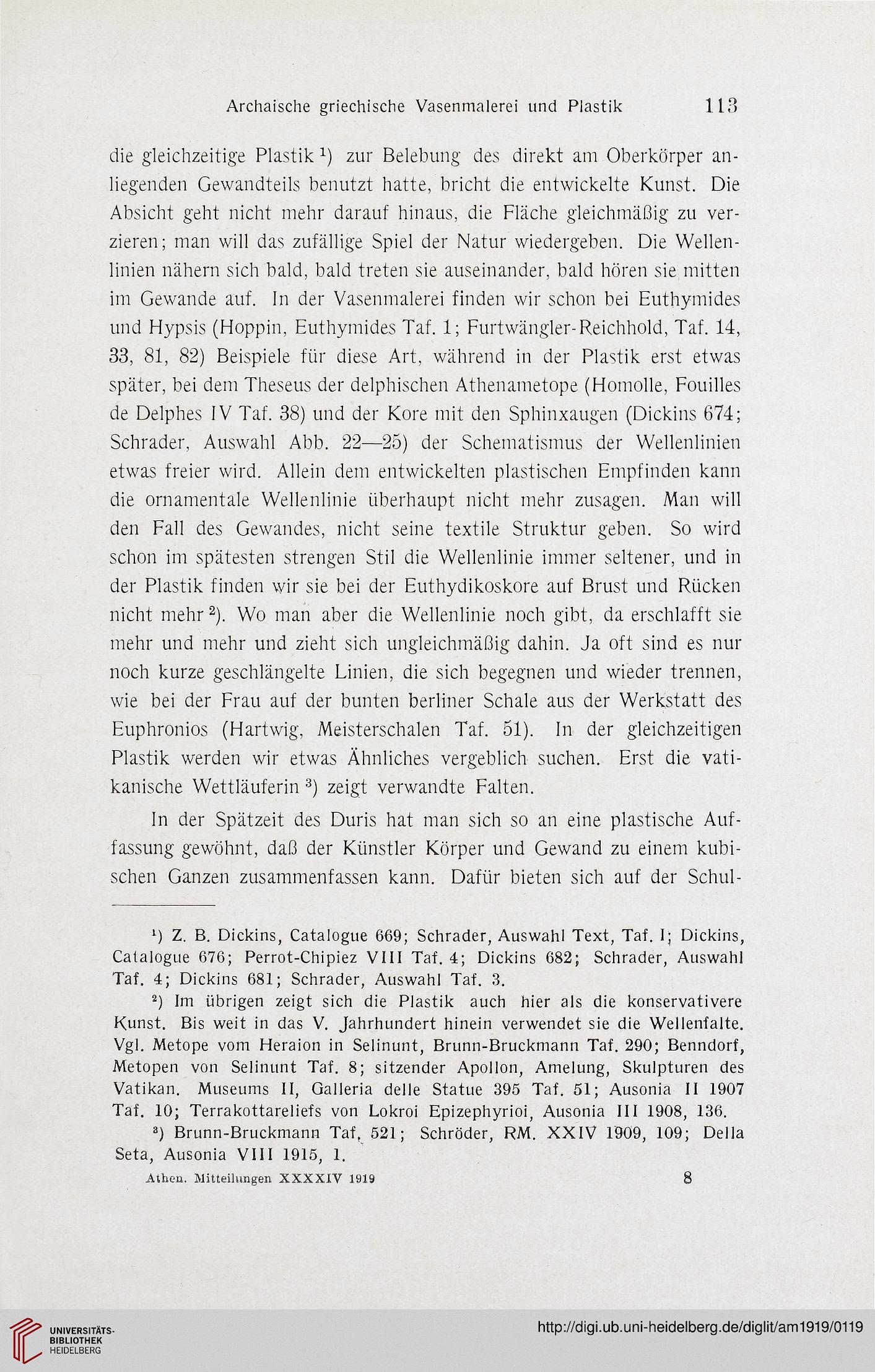Archaische griechische Vasenmaierei und Piastik 113
die gleichzeitige Plastik i) zur Belebung des direkt am Oberkörper an-
liegenden Gewandteils benutzt hatte, bricht die entwickelte Kunst. Die
Absicht geht nicht mehr darauf hinaus, die Fläche gleichmäßig zu ver-
zieren; man will das zufällige Spiel der Natur wiedergeben. Die Wellen-
linien nähern sich bald, bald treten sie auseinander, bald hören sie mitten
im Gewände auf. ln der Vasenmalerei finden wir schon bei Euthymides
und Hypsis (Hoppin, Euthymides Tat. 1; Furtwängler-Reichhold, Tat. 14,
33, 81, 82) Beispiele für diese Art, während in der Plastik erst etwas
später, bei dem Theseus der delphischen Athenametope (Homolle, Fouilles
de Delphes IV Tat. 38) und der Kore mit den Sphinxaugen (Dickins 674;
Schräder, Auswahl Abb. 22—25) der Schematismus der Wellenlinien
etwas freier wird. Allein dem entwickelten plastischen Empfinden kann
die ornamentale Wellenlinie überhaupt nicht mehr Zusagen. Man will
den Fall des Gewandes, nicht seine textile Struktur geben. So wird
schon im spätesten strengen Stil die Wellenlinie immer seltener, und in
der Plastik finden wir sie bei der Euthydikoskore auf Brust und Rücken
nicht mehr 2). Wo man aber die Wellenlinie noch gibt, da erschlafft sie
mehr und mehr und zieht sich ungleichmäßig dahin. Ja oft sind es nur
noch kurze geschlängelte Linien, die sich begegnen und wieder trennen,
wie bei der Frau auf der bunten berliner Schale aus der Werkstatt des
Euphronios (Hartwig, Meisterschalen Tat. 51). ln der gleichzeitigen
Plastik werden wir etwas Ähnliches vergeblich suchen. Erst die vati-
kanische Wettläuferin 3) zeigt verwandte Falten.
ln der Spätzeit des Duris hat man sich so an eine plastische Auf-
fassung gewöhnt, daß der Künstler Körper und Gewand zu einem kubi-
schen Ganzen zusammenfassen kann. Dafür bieten sich auf der Schul-
B Z. B. Dickins, Cataiogue 669; Schräder, Auswahi Text, Tat. !; Dickins,
Calaiogue 676; Perrot-Chipiez VH! Tat. 4; Dickins 682; Schräder, Auswah!
Tat. 4; Dickins 681; Schräder, Auswah] Tat. 3.
2) im übrigen zeigt sich die Piastik auch hier ais die konservativere
Kunst. Bis weit in das V. Jahrhundert hinein verwendet sie die Weiienfaite.
Vgi. Metope vom Heraion in Seiinunt, Brunn-Bruckmann Tat. 290; Benndorf,
Metopen von Seiinunt Taf. 8; sitzender Apoiion, Ameiung, Skuipturen des
Vatikan. Museums Π, Gaiieria deiie Statue 395 Taf. 51; Ausonia Π 1907
Taf. 10; Terrakottareiiefs von Lokroi Epizephyrioi, Ausonia !H 1908, 136.
3) Brunn-Bruckmann Taf, 521; Schröder, RM. XXIV 1909, 109; Deiia
Seta, Ausonia Viii 1915, 1.
Athen. Mitteiinngen XXXX1V 1919
8
die gleichzeitige Plastik i) zur Belebung des direkt am Oberkörper an-
liegenden Gewandteils benutzt hatte, bricht die entwickelte Kunst. Die
Absicht geht nicht mehr darauf hinaus, die Fläche gleichmäßig zu ver-
zieren; man will das zufällige Spiel der Natur wiedergeben. Die Wellen-
linien nähern sich bald, bald treten sie auseinander, bald hören sie mitten
im Gewände auf. ln der Vasenmalerei finden wir schon bei Euthymides
und Hypsis (Hoppin, Euthymides Tat. 1; Furtwängler-Reichhold, Tat. 14,
33, 81, 82) Beispiele für diese Art, während in der Plastik erst etwas
später, bei dem Theseus der delphischen Athenametope (Homolle, Fouilles
de Delphes IV Tat. 38) und der Kore mit den Sphinxaugen (Dickins 674;
Schräder, Auswahl Abb. 22—25) der Schematismus der Wellenlinien
etwas freier wird. Allein dem entwickelten plastischen Empfinden kann
die ornamentale Wellenlinie überhaupt nicht mehr Zusagen. Man will
den Fall des Gewandes, nicht seine textile Struktur geben. So wird
schon im spätesten strengen Stil die Wellenlinie immer seltener, und in
der Plastik finden wir sie bei der Euthydikoskore auf Brust und Rücken
nicht mehr 2). Wo man aber die Wellenlinie noch gibt, da erschlafft sie
mehr und mehr und zieht sich ungleichmäßig dahin. Ja oft sind es nur
noch kurze geschlängelte Linien, die sich begegnen und wieder trennen,
wie bei der Frau auf der bunten berliner Schale aus der Werkstatt des
Euphronios (Hartwig, Meisterschalen Tat. 51). ln der gleichzeitigen
Plastik werden wir etwas Ähnliches vergeblich suchen. Erst die vati-
kanische Wettläuferin 3) zeigt verwandte Falten.
ln der Spätzeit des Duris hat man sich so an eine plastische Auf-
fassung gewöhnt, daß der Künstler Körper und Gewand zu einem kubi-
schen Ganzen zusammenfassen kann. Dafür bieten sich auf der Schul-
B Z. B. Dickins, Cataiogue 669; Schräder, Auswahi Text, Tat. !; Dickins,
Calaiogue 676; Perrot-Chipiez VH! Tat. 4; Dickins 682; Schräder, Auswah!
Tat. 4; Dickins 681; Schräder, Auswah] Tat. 3.
2) im übrigen zeigt sich die Piastik auch hier ais die konservativere
Kunst. Bis weit in das V. Jahrhundert hinein verwendet sie die Weiienfaite.
Vgi. Metope vom Heraion in Seiinunt, Brunn-Bruckmann Tat. 290; Benndorf,
Metopen von Seiinunt Taf. 8; sitzender Apoiion, Ameiung, Skuipturen des
Vatikan. Museums Π, Gaiieria deiie Statue 395 Taf. 51; Ausonia Π 1907
Taf. 10; Terrakottareiiefs von Lokroi Epizephyrioi, Ausonia !H 1908, 136.
3) Brunn-Bruckmann Taf, 521; Schröder, RM. XXIV 1909, 109; Deiia
Seta, Ausonia Viii 1915, 1.
Athen. Mitteiinngen XXXX1V 1919
8