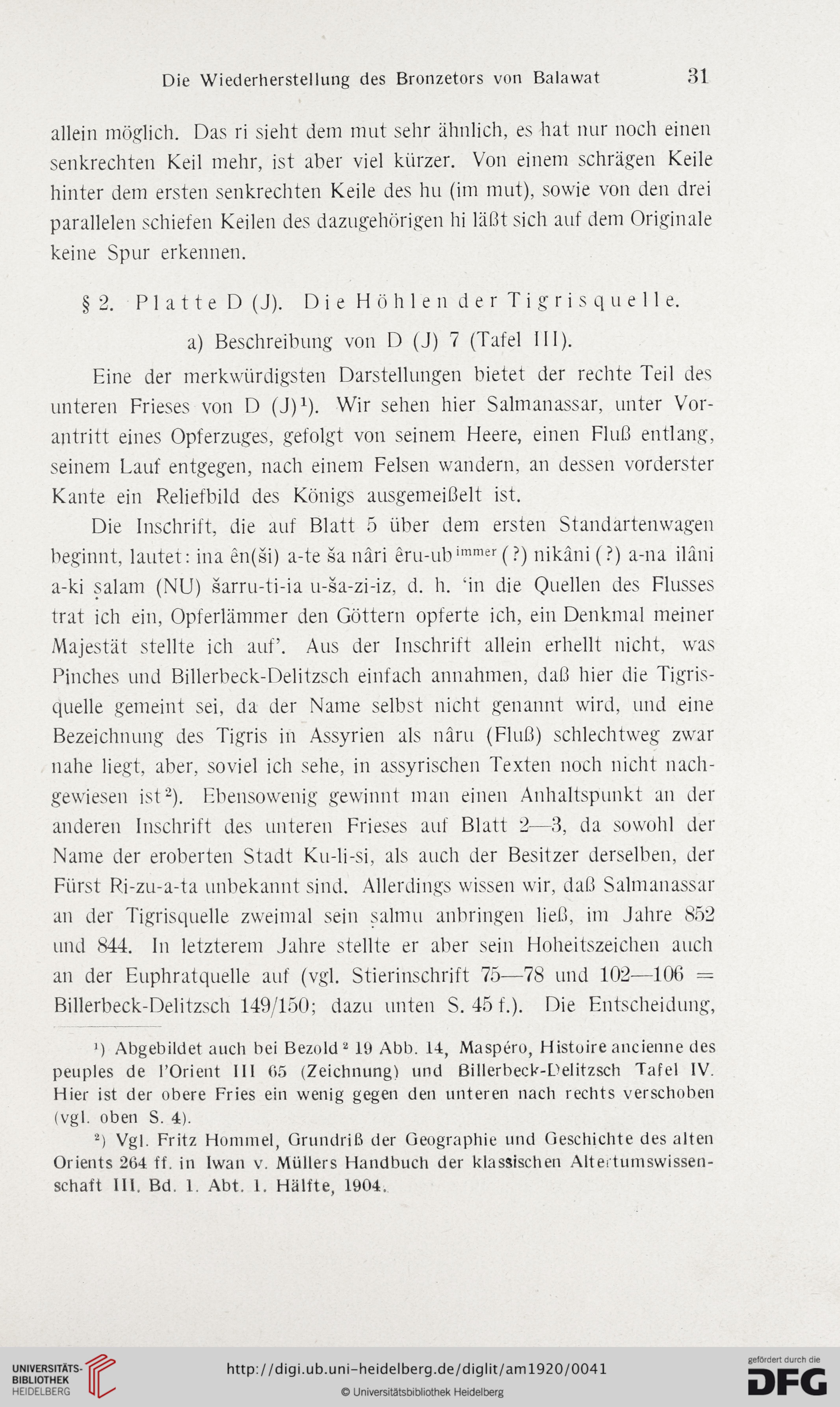Die Wiederherstellung des Bronzetors von Balawat
31
allein möglich. Das ri sieht dem mut sehr ähnlich, es hat nur noch einen
senkrechten Keil mehr, ist aber viel kürzer. Von einem schrägen Keile
hinter dem ersten senkrechten Keile des hu (im mut), sowie von den drei
parallelen schiefen Keilen des dazugehörigen hi läßt sich auf dem Originale
keine Spur erkennen.
§2. PlatteD (J). Die Höhlen derTigrisquelle.
a) Beschreibung von D (J) 7 (Tafel III).
Eine der merkwürdigsten Darstellungen bietet der rechte Teil des
unteren Frieses von D (J) 1). Wir sehen hier Salmanassar, unter Vor-
antritt eines Opferzuges, gefolgt von seinem Heere, einen Fluß entlang,
seinem Lauf entgegen, nach einem Felsen wandern, an dessen vorderster
Kante ein Reliefbild des Königs ausgemeißelt ist.
Die Inschrift, die auf Blatt 5 über dem ersten Standartenwagen
beginnt, lautet: ina en(si) a-te sa näri eru-ub immer (?) nikäni (?) a-na iläni
a-ki salam (NU) sarru-ti-ia u-sa-zi-iz, d. h. ‘in die Quellen des Flusses
trat ich ein, Opferlämmer den Göttern opferte ich, ein Denkmal meiner
Majestät stellte ich auf’. Aus der Inschrift allein erhellt nicht, was
Pinches und Billerbeck-Delitzsch einfach annahmen, daß hier die Tigris-
quelle gemeint sei, da der Name selbst nicht genannt wird, und eine
Bezeichnung des Tigris in Assyrien als näru (Fluß) schlechtweg zwar
nahe liegt, aber, soviel ich sehe, in assyrischen Texten noch nicht nach-
gewiesen ist 2). Ebensowenig gewinnt man einen Anhaltspunkt an der
anderen Inschrift des unteren Frieses auf Blatt 2—3, da sowohl der
Name der eroberten Stadt Ku-li-si, als auch der Besitzer derselben, der
Fürst Ri-zu-a-ta unbekannt sind. Allerdings wissen wir, daß Salmanassar
an der Tigrisquelle zweiinal sein salmu anbringen ließ, im Jahre 852
und 844. In letzterem Jahre stellte er aber sein Hoheitszeichen auch
an der Euphratquelle auf (vgl. Stierinschrift 75—78 und 102—106 -
Billerbeck-Delitzsch 149/150; dazu unten S. 45 f.). Die Entscheidung,
’) Abgebildet auch bei Bezold 2 10 Abb. 14, Maspero, Histoire ancienne des
peuples de l’Orient 111 65 (Zeichnung) und ßillerbeck-Delitzsch Tafel IV.
Hier ist der obere Fries ein wenig gegen den unteren nach rechts verschoben
(vgl. oben S. 4).
2) Vgl. Fritz Honnnel, Grundriß der Geographie und Geschichte des alten
Orients 264 t'f. in Iwan v. Müllers Handbuch der klassischen Altertumswissen-
schaft III, Bd. 1. Abt. 1. Hälfte, 1904.
31
allein möglich. Das ri sieht dem mut sehr ähnlich, es hat nur noch einen
senkrechten Keil mehr, ist aber viel kürzer. Von einem schrägen Keile
hinter dem ersten senkrechten Keile des hu (im mut), sowie von den drei
parallelen schiefen Keilen des dazugehörigen hi läßt sich auf dem Originale
keine Spur erkennen.
§2. PlatteD (J). Die Höhlen derTigrisquelle.
a) Beschreibung von D (J) 7 (Tafel III).
Eine der merkwürdigsten Darstellungen bietet der rechte Teil des
unteren Frieses von D (J) 1). Wir sehen hier Salmanassar, unter Vor-
antritt eines Opferzuges, gefolgt von seinem Heere, einen Fluß entlang,
seinem Lauf entgegen, nach einem Felsen wandern, an dessen vorderster
Kante ein Reliefbild des Königs ausgemeißelt ist.
Die Inschrift, die auf Blatt 5 über dem ersten Standartenwagen
beginnt, lautet: ina en(si) a-te sa näri eru-ub immer (?) nikäni (?) a-na iläni
a-ki salam (NU) sarru-ti-ia u-sa-zi-iz, d. h. ‘in die Quellen des Flusses
trat ich ein, Opferlämmer den Göttern opferte ich, ein Denkmal meiner
Majestät stellte ich auf’. Aus der Inschrift allein erhellt nicht, was
Pinches und Billerbeck-Delitzsch einfach annahmen, daß hier die Tigris-
quelle gemeint sei, da der Name selbst nicht genannt wird, und eine
Bezeichnung des Tigris in Assyrien als näru (Fluß) schlechtweg zwar
nahe liegt, aber, soviel ich sehe, in assyrischen Texten noch nicht nach-
gewiesen ist 2). Ebensowenig gewinnt man einen Anhaltspunkt an der
anderen Inschrift des unteren Frieses auf Blatt 2—3, da sowohl der
Name der eroberten Stadt Ku-li-si, als auch der Besitzer derselben, der
Fürst Ri-zu-a-ta unbekannt sind. Allerdings wissen wir, daß Salmanassar
an der Tigrisquelle zweiinal sein salmu anbringen ließ, im Jahre 852
und 844. In letzterem Jahre stellte er aber sein Hoheitszeichen auch
an der Euphratquelle auf (vgl. Stierinschrift 75—78 und 102—106 -
Billerbeck-Delitzsch 149/150; dazu unten S. 45 f.). Die Entscheidung,
’) Abgebildet auch bei Bezold 2 10 Abb. 14, Maspero, Histoire ancienne des
peuples de l’Orient 111 65 (Zeichnung) und ßillerbeck-Delitzsch Tafel IV.
Hier ist der obere Fries ein wenig gegen den unteren nach rechts verschoben
(vgl. oben S. 4).
2) Vgl. Fritz Honnnel, Grundriß der Geographie und Geschichte des alten
Orients 264 t'f. in Iwan v. Müllers Handbuch der klassischen Altertumswissen-
schaft III, Bd. 1. Abt. 1. Hälfte, 1904.