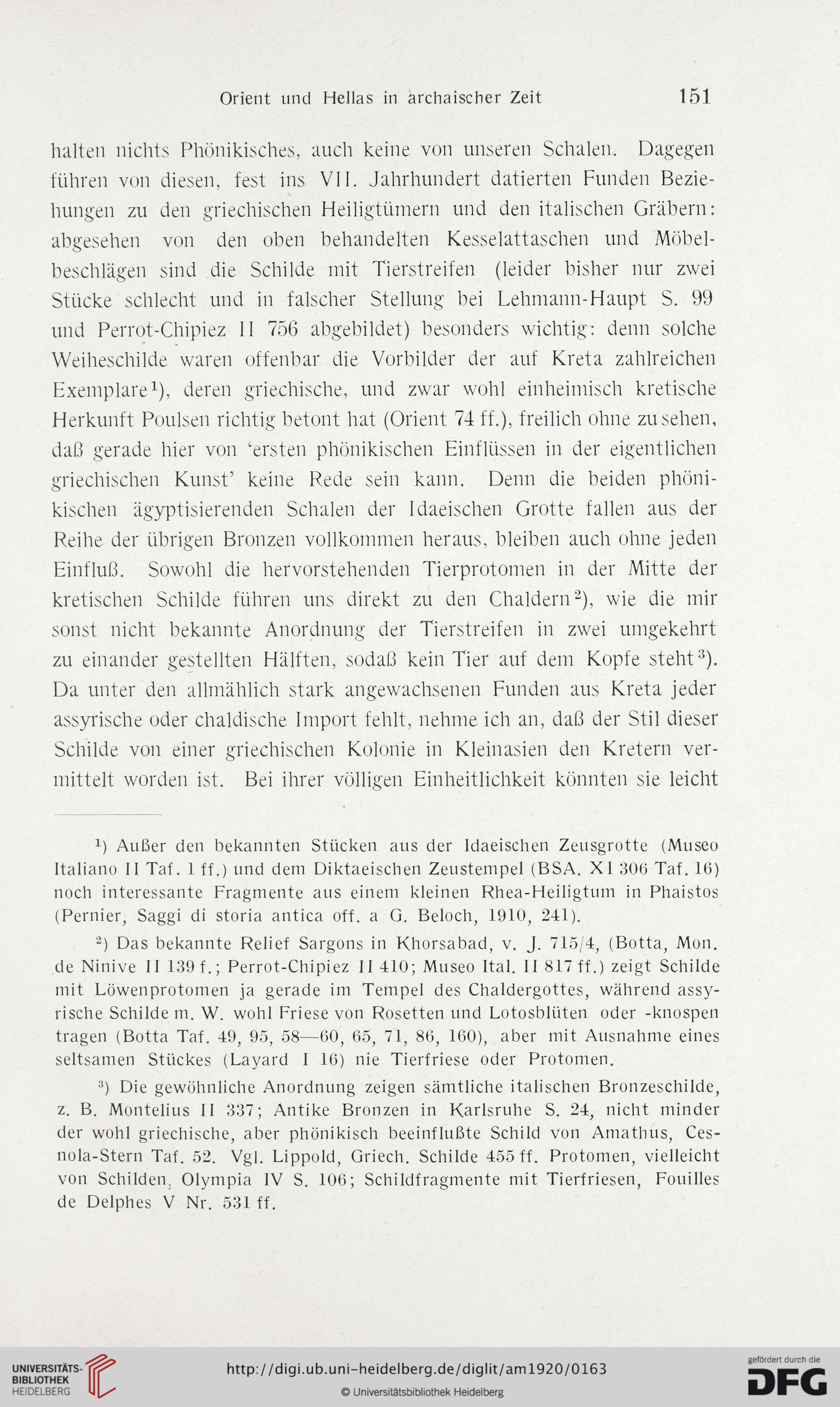Orient und Hellas in archaischer Zeit
151
halten nichts Phönikisches, auch keine von unseren Schalen. Dagegen
führen von diesen, fest ins VII. Jahrhundert datierten Funden Bezie-
hungen zu den griechischen Heiligtümern und den italischen Gräbern:
abgesehen von den oben behandelten Kesselattaschen und Möbel-
beschlägen sind die Schilde mit Tierstreifen (leider bisher nur zwei
Stücke schlecht und in falscher Stellung bei Lehmann-Haupt S. 99
und Perrot-Chipiez II 756 abgebildet) besonders wichtig: denn solche
Weiheschilde waren offenbar die Vorbilder der auf Kreta zahlreichen
Exemplare 1), deren griechische, und zwar wohl einheimisch kretische
Herkunft Poulsen richtig betont hat (Orient 74 ff.), freilich ohne zusehen,
daß gerade hier von ‘ersten phönikischen Einflüssen in der eigentlichen
griechischen Kunst’ keine Rede sein kann. Denn die beiden phöni-
kischen ägyptisierenden Schalen der Idaeischen Grotte fallen aus der
Reihe der übrigen Bronzen vollkommen heraus, bleiben auch ohne jeden
Einfluß. Sowohl die hervorstehenden Tierprotomen in der Mitte der
kretischen Schilde führen uns direkt zu den Chaldern 2), wie die mir
sonst nicht bekannte Anordnung der Tierstreifen in zwei umgekehrt
zu einander gestellten Hälften, sodaß kein Tier auf dem Kopfe steht 3).
Da unter den allmählich stark angewachsenen Funden aus Kreta jeder
assyrische oder chaldische Import fehlt, nehme ich an, daß der Stil dieser
Schilde von einer griechischen Kolonie in Kleinasien den Kretern ver-
mittelt worden ist. Bei ihrer völligen Einheitlichkeit könnten sie leicht
x) Außer den bekannten Stücken aus der Idaeischen Zeusgrotte (Museo
Italiano II Taf. 1 ff.) und dem Diktaeischen Zeustempel (BSA. XI 306 Taf. 16)
noch interessante Fragmente aus einem kleinen Rhea-Heiligtum in Phaistos
(Pernier, Saggi di storia antica off. a G. Beloch, 1910, 241).
2) Das bekannte Relief Sargons in Khorsabad, v. J. 715/4, (Botta, Mon.
de Ninive II 139 f.; Perrot-Chipiez II 410; Museo Ital. II 817 ff.) zeigt Schilde
mit Löwenprotomen ja gerade im Tempel des Chaldergottes, während assy-
rische Schilde m. W. wohl Friese von Rosetten und Lotosblüten oder -knospen
tragen (Botta Taf. 49, 95, 58—60, 65, 71, 86, 160), aber mit Ausnahme eines
seltsamen Stückes (Layard I 16) nie Tierfriese oder Protomen.
3) Die gewöhnliche Anordnung zeigen sämtliche italischen Bronzeschilde,
z. B. Montelius II 337; Antike Bronzen in Karlsruhe S. 24, nicht minder
der wohl griechische, aber phönikisch beeinflußte Schild von Amathus, Ces-
nola-Stern Taf. 52. Vgl. Lippold, Griech. Schilde 455 ff. Protomen, vielleicht
von Schilden. Olympia IV S. 106; Schildfragmente mit Tierfriesen, Fouilles
de Delphes V Nr. 531 ff.
151
halten nichts Phönikisches, auch keine von unseren Schalen. Dagegen
führen von diesen, fest ins VII. Jahrhundert datierten Funden Bezie-
hungen zu den griechischen Heiligtümern und den italischen Gräbern:
abgesehen von den oben behandelten Kesselattaschen und Möbel-
beschlägen sind die Schilde mit Tierstreifen (leider bisher nur zwei
Stücke schlecht und in falscher Stellung bei Lehmann-Haupt S. 99
und Perrot-Chipiez II 756 abgebildet) besonders wichtig: denn solche
Weiheschilde waren offenbar die Vorbilder der auf Kreta zahlreichen
Exemplare 1), deren griechische, und zwar wohl einheimisch kretische
Herkunft Poulsen richtig betont hat (Orient 74 ff.), freilich ohne zusehen,
daß gerade hier von ‘ersten phönikischen Einflüssen in der eigentlichen
griechischen Kunst’ keine Rede sein kann. Denn die beiden phöni-
kischen ägyptisierenden Schalen der Idaeischen Grotte fallen aus der
Reihe der übrigen Bronzen vollkommen heraus, bleiben auch ohne jeden
Einfluß. Sowohl die hervorstehenden Tierprotomen in der Mitte der
kretischen Schilde führen uns direkt zu den Chaldern 2), wie die mir
sonst nicht bekannte Anordnung der Tierstreifen in zwei umgekehrt
zu einander gestellten Hälften, sodaß kein Tier auf dem Kopfe steht 3).
Da unter den allmählich stark angewachsenen Funden aus Kreta jeder
assyrische oder chaldische Import fehlt, nehme ich an, daß der Stil dieser
Schilde von einer griechischen Kolonie in Kleinasien den Kretern ver-
mittelt worden ist. Bei ihrer völligen Einheitlichkeit könnten sie leicht
x) Außer den bekannten Stücken aus der Idaeischen Zeusgrotte (Museo
Italiano II Taf. 1 ff.) und dem Diktaeischen Zeustempel (BSA. XI 306 Taf. 16)
noch interessante Fragmente aus einem kleinen Rhea-Heiligtum in Phaistos
(Pernier, Saggi di storia antica off. a G. Beloch, 1910, 241).
2) Das bekannte Relief Sargons in Khorsabad, v. J. 715/4, (Botta, Mon.
de Ninive II 139 f.; Perrot-Chipiez II 410; Museo Ital. II 817 ff.) zeigt Schilde
mit Löwenprotomen ja gerade im Tempel des Chaldergottes, während assy-
rische Schilde m. W. wohl Friese von Rosetten und Lotosblüten oder -knospen
tragen (Botta Taf. 49, 95, 58—60, 65, 71, 86, 160), aber mit Ausnahme eines
seltsamen Stückes (Layard I 16) nie Tierfriese oder Protomen.
3) Die gewöhnliche Anordnung zeigen sämtliche italischen Bronzeschilde,
z. B. Montelius II 337; Antike Bronzen in Karlsruhe S. 24, nicht minder
der wohl griechische, aber phönikisch beeinflußte Schild von Amathus, Ces-
nola-Stern Taf. 52. Vgl. Lippold, Griech. Schilde 455 ff. Protomen, vielleicht
von Schilden. Olympia IV S. 106; Schildfragmente mit Tierfriesen, Fouilles
de Delphes V Nr. 531 ff.