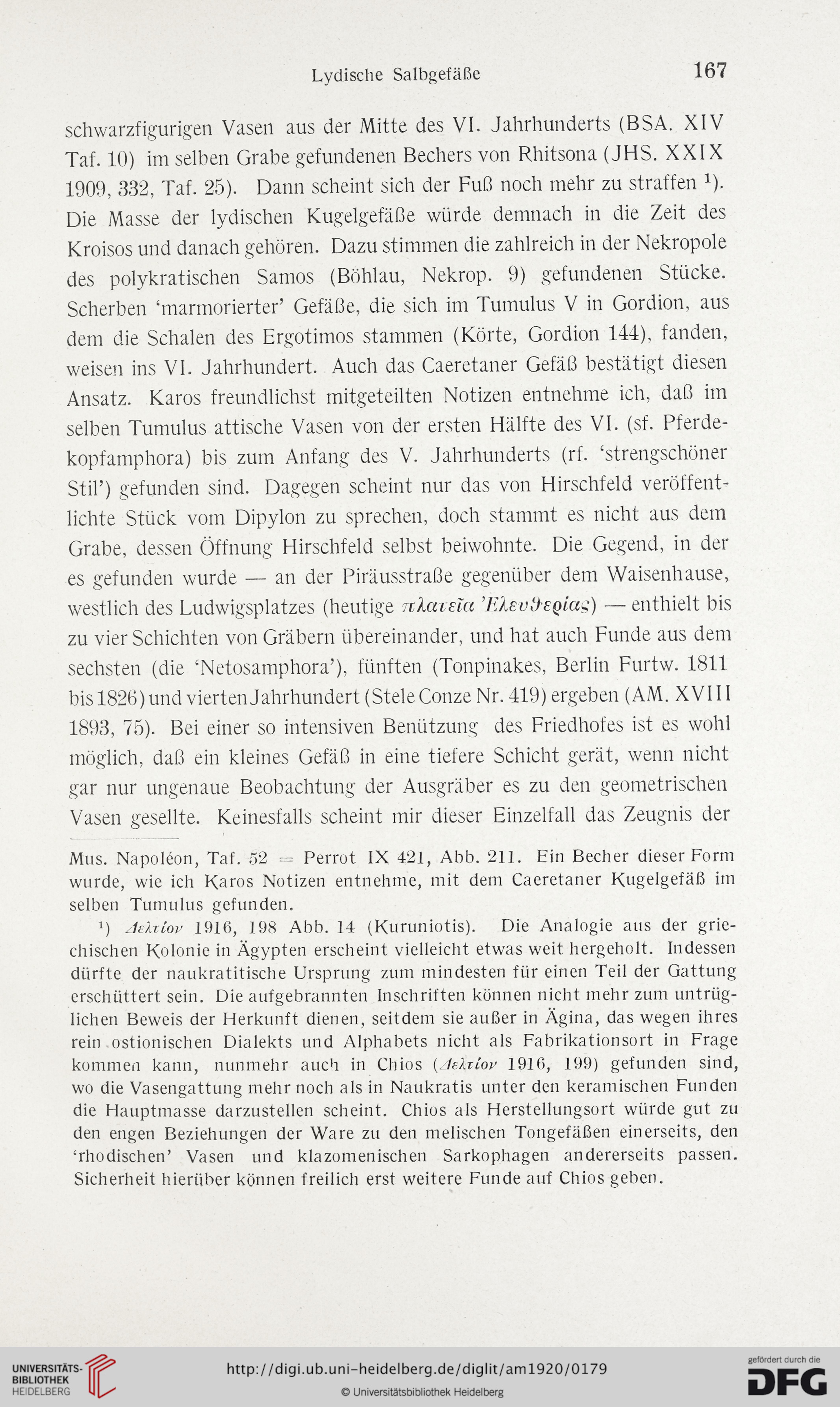Lydische Salbgefäße
167
schwarzfigurigen Vasen aus der Mitte des VI. Jahrhunderts (BSA. XIV
Taf. 10) im selben Grabe gefundenen Bechers von Rhitsona (JHS. XXIX
1909, 332, Taf. 25). Dann scheint sich der Fuß noch mehr zu straffen x).
Die Masse der lydischen Kugelgefäße würde demnach in die Zeit des
Kroisos und danach gehören. Dazu stimmen die zahlreich in der Nekropole
des polykratischen Samos (Böhlau, Nekrop. 9) gefundenen Stücke.
Scherben ‘marmorierter’ Gefäße, die sich im Tumulus V in Gordion, aus
dem die Schalen des Ergotimos stammen (Körte, Gordion 144), fanden,
weisen ins VI. Jahrhundert. Auch das Caeretaner Gefäß bestätigt diesen
Ansatz. Karos freundlichst mitgeteilten Notizen entnehtne ich, daß itn
selben Tumulus attische Vasen von der ersten Hälfte des VI. (sf. Pferde-
kopfamphora) bis zum Anfang des V. Jahrhunderts (rf. ‘strengschöner
Stil’) gefunden sind. Dagegen scheint nur das von Hirschfeld veröffent-
lichte Stück vom Dipylon zu sprechen, doch stammt es nicht aus dem
Grabe, dessen Öffnung Hirschfeld selbst beiwohnte. Die Gegend, in der
es gefunden wurde — an der Piräusstraße gegenüber dem Waisenhause,
westlich des Ludwigsplatzes (heutige nlavda ’Elsvd-EQias) — enthielt bis
zu vier Schichten von Gräbern übereinander, und hat auch Funde aus dem
sechsten (die ‘Netosamphora’), fiinften (Tonpinakes, Berlin Furtw. 1811
bis 1826)und viertenJahrhundert (SteleConze Nr. 419) ergeben (AM. XVI11
1893, 75). Bei einer so intensiven Benützung des Friedhofes ist es wohl
möglich, daß ein kleines Gefäß in eine tiefere Schicht gerät, wenn nicht
gar nur ungenaue Beobachtung der Ausgräber es zu den geometrischen
Vasen gesellte. Keinesfalls scheint inir dieser Einzelfall das Zeugnis der
Mus. Napoleon, Taf. 52 = Perrot IX 421, Abb. 211. Ein Becher dieser Form
wurde, wie ich Karos Notizen entnehme, mit dem Caeretaner Kugelgefäß im
selben Tumulus gefunden.
x) Ae'ktLov 1916, 198 Abb. 14 (Kuruniotis). Die Analogie aus der grie-
chischen Kolonie in Ägypten erscheint vielleicht etwas weit hergeholt. Indessen
dürfte der naukratitische Ursprung zum mindesten für einen Teil der Gattung
erschüttert sein. Die aufgebrannten Inschriften können nicht mehr zum untriig-
lichen Beweis der Herkunft dienen, seitdem sie außer in Ägina, das wegen ihres
rein ostionischen Dialekts und Alphabets nicht als Fabrikationsort in Frage
kommen kann, nunmehr auch in Chios (Aelxiov 1916, 199) gefunden sind,
wo die Vasengattung mehr noch als in Naukratis unter den keramischen Funden
die Hauptmasse darzustellen scheint. Chios als Herstellungsort würde gut zu
den engen Beziehungen der Ware zu den melischen Tongefäßen einerseits, den
‘rhodischen’ Vasen und klazomenischen Sarkophagen andererseits passen.
Sicherheit hieriiber können freilich erst weitere Funde auf Chios geben.
167
schwarzfigurigen Vasen aus der Mitte des VI. Jahrhunderts (BSA. XIV
Taf. 10) im selben Grabe gefundenen Bechers von Rhitsona (JHS. XXIX
1909, 332, Taf. 25). Dann scheint sich der Fuß noch mehr zu straffen x).
Die Masse der lydischen Kugelgefäße würde demnach in die Zeit des
Kroisos und danach gehören. Dazu stimmen die zahlreich in der Nekropole
des polykratischen Samos (Böhlau, Nekrop. 9) gefundenen Stücke.
Scherben ‘marmorierter’ Gefäße, die sich im Tumulus V in Gordion, aus
dem die Schalen des Ergotimos stammen (Körte, Gordion 144), fanden,
weisen ins VI. Jahrhundert. Auch das Caeretaner Gefäß bestätigt diesen
Ansatz. Karos freundlichst mitgeteilten Notizen entnehtne ich, daß itn
selben Tumulus attische Vasen von der ersten Hälfte des VI. (sf. Pferde-
kopfamphora) bis zum Anfang des V. Jahrhunderts (rf. ‘strengschöner
Stil’) gefunden sind. Dagegen scheint nur das von Hirschfeld veröffent-
lichte Stück vom Dipylon zu sprechen, doch stammt es nicht aus dem
Grabe, dessen Öffnung Hirschfeld selbst beiwohnte. Die Gegend, in der
es gefunden wurde — an der Piräusstraße gegenüber dem Waisenhause,
westlich des Ludwigsplatzes (heutige nlavda ’Elsvd-EQias) — enthielt bis
zu vier Schichten von Gräbern übereinander, und hat auch Funde aus dem
sechsten (die ‘Netosamphora’), fiinften (Tonpinakes, Berlin Furtw. 1811
bis 1826)und viertenJahrhundert (SteleConze Nr. 419) ergeben (AM. XVI11
1893, 75). Bei einer so intensiven Benützung des Friedhofes ist es wohl
möglich, daß ein kleines Gefäß in eine tiefere Schicht gerät, wenn nicht
gar nur ungenaue Beobachtung der Ausgräber es zu den geometrischen
Vasen gesellte. Keinesfalls scheint inir dieser Einzelfall das Zeugnis der
Mus. Napoleon, Taf. 52 = Perrot IX 421, Abb. 211. Ein Becher dieser Form
wurde, wie ich Karos Notizen entnehme, mit dem Caeretaner Kugelgefäß im
selben Tumulus gefunden.
x) Ae'ktLov 1916, 198 Abb. 14 (Kuruniotis). Die Analogie aus der grie-
chischen Kolonie in Ägypten erscheint vielleicht etwas weit hergeholt. Indessen
dürfte der naukratitische Ursprung zum mindesten für einen Teil der Gattung
erschüttert sein. Die aufgebrannten Inschriften können nicht mehr zum untriig-
lichen Beweis der Herkunft dienen, seitdem sie außer in Ägina, das wegen ihres
rein ostionischen Dialekts und Alphabets nicht als Fabrikationsort in Frage
kommen kann, nunmehr auch in Chios (Aelxiov 1916, 199) gefunden sind,
wo die Vasengattung mehr noch als in Naukratis unter den keramischen Funden
die Hauptmasse darzustellen scheint. Chios als Herstellungsort würde gut zu
den engen Beziehungen der Ware zu den melischen Tongefäßen einerseits, den
‘rhodischen’ Vasen und klazomenischen Sarkophagen andererseits passen.
Sicherheit hieriiber können freilich erst weitere Funde auf Chios geben.