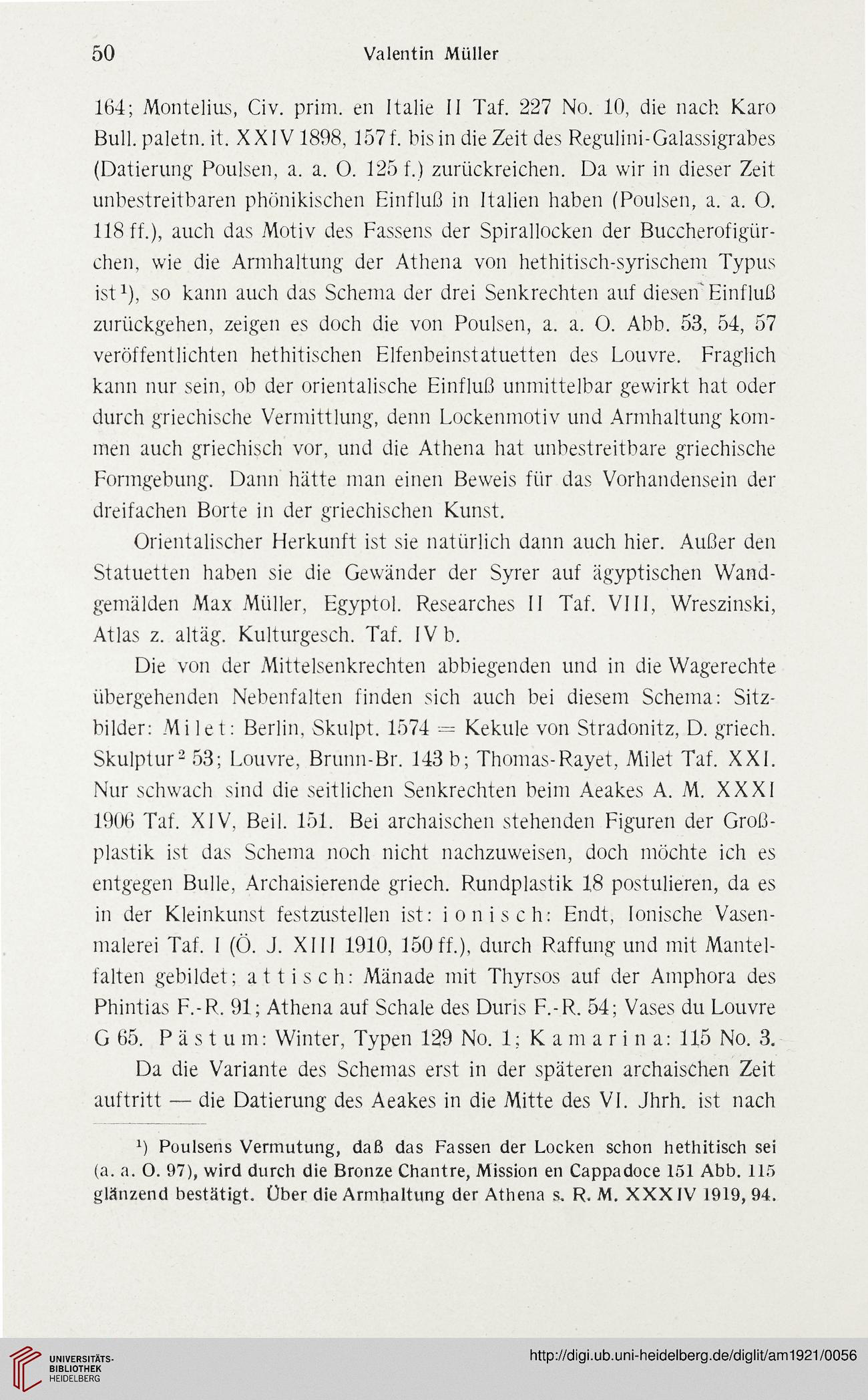50
Valentin Müller
164; Montelius, Civ. prim. en Italie II Taf. 227 No. 10, die nach Karo
Bull.paletn.it. XXIV 1898, 157f. bisindieZeit des Regulini-Galassigrabes
(Datierung Poulsen, a. a. 0. 125 f.) zurückreichen. Da wir in dieser Zeit
unbestreitbaren phönikischen Einfluß in Italien haben (Poulsen, a. a. O.
118 ff.), auch das Motiv des Fassens der Spirallocken der Buccherofigür-
chen, wie die Armhaltung der Athena von hethitisch-syrischem Typus
istx), so kann auch das Schema der drei Senkrechten auf dies-en' Einfluß
zuriickgehen, zeigen es doch die von Poulsen, a. a. O. Abb. 53, 54, 57
veröffentlichten hethitischen Elfenbeinstatuetten des Louvre. Fraglich
kann nur sein, ob der orientalische Einfluß unmittelbar gewirkt hat oder
durch griechische Vermittlung, denn Lockenmotiv und Arnrhaltung kom-
men auch griechisch vor, und die Athena hat unbestreitbare griechische
Formgebung. Dann hätte man einen Beweis für das Vorhandensein der
dreifachen Borte in der griechischen Kunst.
Orientalischer Herkunft ist sie natürlich dann auch hier. Außer den
Statuetten haben sie die Gewänder der Syrer auf ägyptischen Wand-
gemälden Max Müller, Egyptol. Researches II Taf. VIII, Wreszinski,
Atlas z. altäg. Kulturgesch. Taf. IV b.
Die von der Mittelsenkrechten abbiegenden und in die Wagerechte
übergehenden Nebenfalten finden sich auch bei diesem Schema: Sitz-
bilder: Milet: Berlin, Skulpt. 1574 — Kekule von Stradonitz, D. griech.
Skulptur2 53; Louvre, Brunn-Br. 143 b; Thomas-Rayet, Milet Taf. XXI.
Nur schwach sind die seitlichen Senkrechten beim Aeakes A. M. XXXI
1906 Taf. XIV, Beil. 151. Bei archaischen stehenden Figuren der Groß-
plastik ist das Schema noch nicht nachzuweisen, doch möchte ich es
entgegen Bulle, Archaisierende griech. Rundplastik 18 postulieren, da es
in der Kleinkunst festzustellen ist: ionisch: Endt, Ionische Vasen-
malerei Taf. I (Ö. J. XIII 1910, 150 ff.), durch Raffung und mit Mantel-
falten gebildet; attisch: Mänade mit Thyrsos auf der Amphora des
Phintias F.-R. 91; Athena auf Schale des Duris F.-R. 54; Vases du Louvre
G 65. Pästum: Winter, Typen 129 No. 1; Kamarina: 115 No. 3.
Da die Variante des Schemas erst in der späteren archaischen Zeit
auftritt — die Datierung des Aeakes in die Mitte des VI. Jhrh. ist nach
9 Poulsens Vermutung, daß das Fassen der Locken schon hethitisch sei
(a. a. O. 97), wird durch die Bronze Chantre, Mission en Cappadoce 151 Abb. 115
glänzend bestätigt. Über die Armhaltung der Athena s. R, M. XXXIV 1919, 94.
Valentin Müller
164; Montelius, Civ. prim. en Italie II Taf. 227 No. 10, die nach Karo
Bull.paletn.it. XXIV 1898, 157f. bisindieZeit des Regulini-Galassigrabes
(Datierung Poulsen, a. a. 0. 125 f.) zurückreichen. Da wir in dieser Zeit
unbestreitbaren phönikischen Einfluß in Italien haben (Poulsen, a. a. O.
118 ff.), auch das Motiv des Fassens der Spirallocken der Buccherofigür-
chen, wie die Armhaltung der Athena von hethitisch-syrischem Typus
istx), so kann auch das Schema der drei Senkrechten auf dies-en' Einfluß
zuriickgehen, zeigen es doch die von Poulsen, a. a. O. Abb. 53, 54, 57
veröffentlichten hethitischen Elfenbeinstatuetten des Louvre. Fraglich
kann nur sein, ob der orientalische Einfluß unmittelbar gewirkt hat oder
durch griechische Vermittlung, denn Lockenmotiv und Arnrhaltung kom-
men auch griechisch vor, und die Athena hat unbestreitbare griechische
Formgebung. Dann hätte man einen Beweis für das Vorhandensein der
dreifachen Borte in der griechischen Kunst.
Orientalischer Herkunft ist sie natürlich dann auch hier. Außer den
Statuetten haben sie die Gewänder der Syrer auf ägyptischen Wand-
gemälden Max Müller, Egyptol. Researches II Taf. VIII, Wreszinski,
Atlas z. altäg. Kulturgesch. Taf. IV b.
Die von der Mittelsenkrechten abbiegenden und in die Wagerechte
übergehenden Nebenfalten finden sich auch bei diesem Schema: Sitz-
bilder: Milet: Berlin, Skulpt. 1574 — Kekule von Stradonitz, D. griech.
Skulptur2 53; Louvre, Brunn-Br. 143 b; Thomas-Rayet, Milet Taf. XXI.
Nur schwach sind die seitlichen Senkrechten beim Aeakes A. M. XXXI
1906 Taf. XIV, Beil. 151. Bei archaischen stehenden Figuren der Groß-
plastik ist das Schema noch nicht nachzuweisen, doch möchte ich es
entgegen Bulle, Archaisierende griech. Rundplastik 18 postulieren, da es
in der Kleinkunst festzustellen ist: ionisch: Endt, Ionische Vasen-
malerei Taf. I (Ö. J. XIII 1910, 150 ff.), durch Raffung und mit Mantel-
falten gebildet; attisch: Mänade mit Thyrsos auf der Amphora des
Phintias F.-R. 91; Athena auf Schale des Duris F.-R. 54; Vases du Louvre
G 65. Pästum: Winter, Typen 129 No. 1; Kamarina: 115 No. 3.
Da die Variante des Schemas erst in der späteren archaischen Zeit
auftritt — die Datierung des Aeakes in die Mitte des VI. Jhrh. ist nach
9 Poulsens Vermutung, daß das Fassen der Locken schon hethitisch sei
(a. a. O. 97), wird durch die Bronze Chantre, Mission en Cappadoce 151 Abb. 115
glänzend bestätigt. Über die Armhaltung der Athena s. R, M. XXXIV 1919, 94.