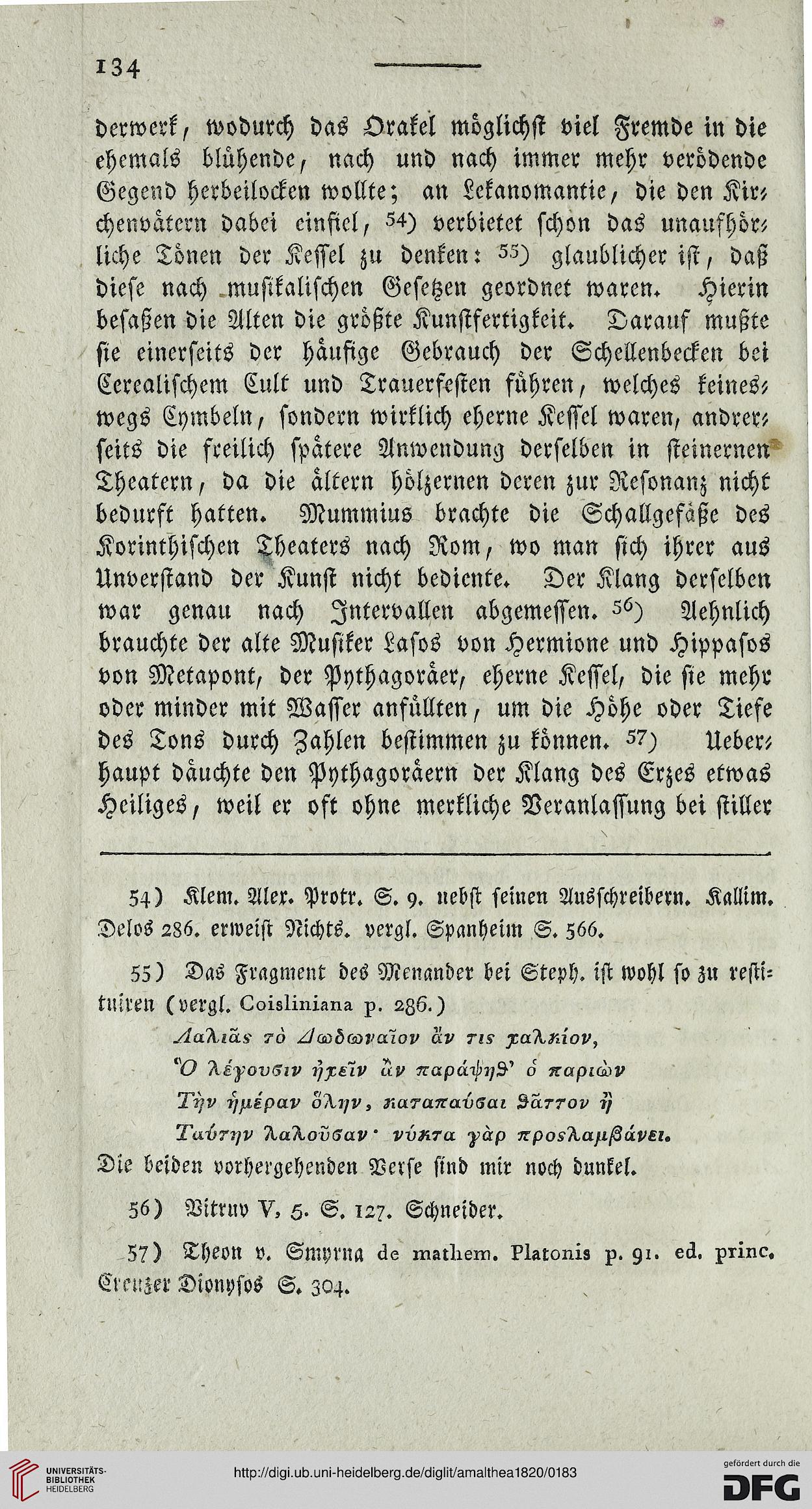134
derwerk, wodurch das Orakel möglichst viel Fremde in die
ehemals blühende, nach und nach immer mehr verödende
Gegend herbeilocken wollte; an Lekanomantie, die den Kir-
chenvätern dabei cinfiel, 54) verbietet schon das unaufhör-
liche Tönen der Kessel zu denken: 55) glaublicher ist, daß
diese nach musikalischen Gesetzen geordnet waren. Hierin
besaßen die Alten die größte Kunstfertigkeit. Darauf mußte
sie einerseits der häufige Gebrauch der Schellenbecken bei
Cerealischem Cult und Trauerfesten führen, welches keines-
wegs Cymbeln, sondern wirklich eherne Kessel waren, andrer-
seits die freilich spätere Anwendung derselben in steinernen
Theatern, da die filtern hölzernen deren zur Resonanz nicht
bedurft hatten. Mummius brachte die Schallgefäße des
Korinthischen Theaters nach Rom, wo man sich ihrer aus
Unverstand der Kunst nicht bediente. Der Klang derselben
war genau nach Intervallen abgemessen. 5°) Aehnlich
brauchte der alte Musiker Lasos von Hermione und Hippasos
von Metapont, der Pythagorfier, eherne Kessel, die sie mehr
oder minder mit Wasser anfüllten, um die Höhe oder Tiefe
des Tons durch Zahlen bestimmen zu können. 5?) Ueber-
haupt dfiuchte den Pythagorfiern der Klang des Erzes etwas
Heiliges, weil er oft ohne merkliche Veranlassung bei stiller
54) Klem. Aler. Protr. S. y. nebst seinen Ausschreibern. Kallim.
Delos 286. erweist Nichts, vergl. Spanheim S. 566.
55) Das Fragment des Menander bei Steph. ist wohl so zu restk-
tniren (vergl. Coisliniana p. 236.)
Aa\,ias To Zlaoöoovaiov av ns jca'A,niov,
lO AdyovGiv f/pelv uv xapä-ty-ifö' 6 napiaov
Tijv rjp.ipav oXr/v, naranavsai &ärrov 1}
TaürrjV TiaTiovSav ’ vvktcl yap JtposTia^ißüvei.
Die beiden vorhergehenden Verse sind mir noch dunkel.
56) Vitruv V, 5. S. 127. Schneider.
57) Theon v. Smyrna äs iristlism. Platonis p. 91. ed. princ,
Creuzer Dionysos S. 304.
derwerk, wodurch das Orakel möglichst viel Fremde in die
ehemals blühende, nach und nach immer mehr verödende
Gegend herbeilocken wollte; an Lekanomantie, die den Kir-
chenvätern dabei cinfiel, 54) verbietet schon das unaufhör-
liche Tönen der Kessel zu denken: 55) glaublicher ist, daß
diese nach musikalischen Gesetzen geordnet waren. Hierin
besaßen die Alten die größte Kunstfertigkeit. Darauf mußte
sie einerseits der häufige Gebrauch der Schellenbecken bei
Cerealischem Cult und Trauerfesten führen, welches keines-
wegs Cymbeln, sondern wirklich eherne Kessel waren, andrer-
seits die freilich spätere Anwendung derselben in steinernen
Theatern, da die filtern hölzernen deren zur Resonanz nicht
bedurft hatten. Mummius brachte die Schallgefäße des
Korinthischen Theaters nach Rom, wo man sich ihrer aus
Unverstand der Kunst nicht bediente. Der Klang derselben
war genau nach Intervallen abgemessen. 5°) Aehnlich
brauchte der alte Musiker Lasos von Hermione und Hippasos
von Metapont, der Pythagorfier, eherne Kessel, die sie mehr
oder minder mit Wasser anfüllten, um die Höhe oder Tiefe
des Tons durch Zahlen bestimmen zu können. 5?) Ueber-
haupt dfiuchte den Pythagorfiern der Klang des Erzes etwas
Heiliges, weil er oft ohne merkliche Veranlassung bei stiller
54) Klem. Aler. Protr. S. y. nebst seinen Ausschreibern. Kallim.
Delos 286. erweist Nichts, vergl. Spanheim S. 566.
55) Das Fragment des Menander bei Steph. ist wohl so zu restk-
tniren (vergl. Coisliniana p. 236.)
Aa\,ias To Zlaoöoovaiov av ns jca'A,niov,
lO AdyovGiv f/pelv uv xapä-ty-ifö' 6 napiaov
Tijv rjp.ipav oXr/v, naranavsai &ärrov 1}
TaürrjV TiaTiovSav ’ vvktcl yap JtposTia^ißüvei.
Die beiden vorhergehenden Verse sind mir noch dunkel.
56) Vitruv V, 5. S. 127. Schneider.
57) Theon v. Smyrna äs iristlism. Platonis p. 91. ed. princ,
Creuzer Dionysos S. 304.