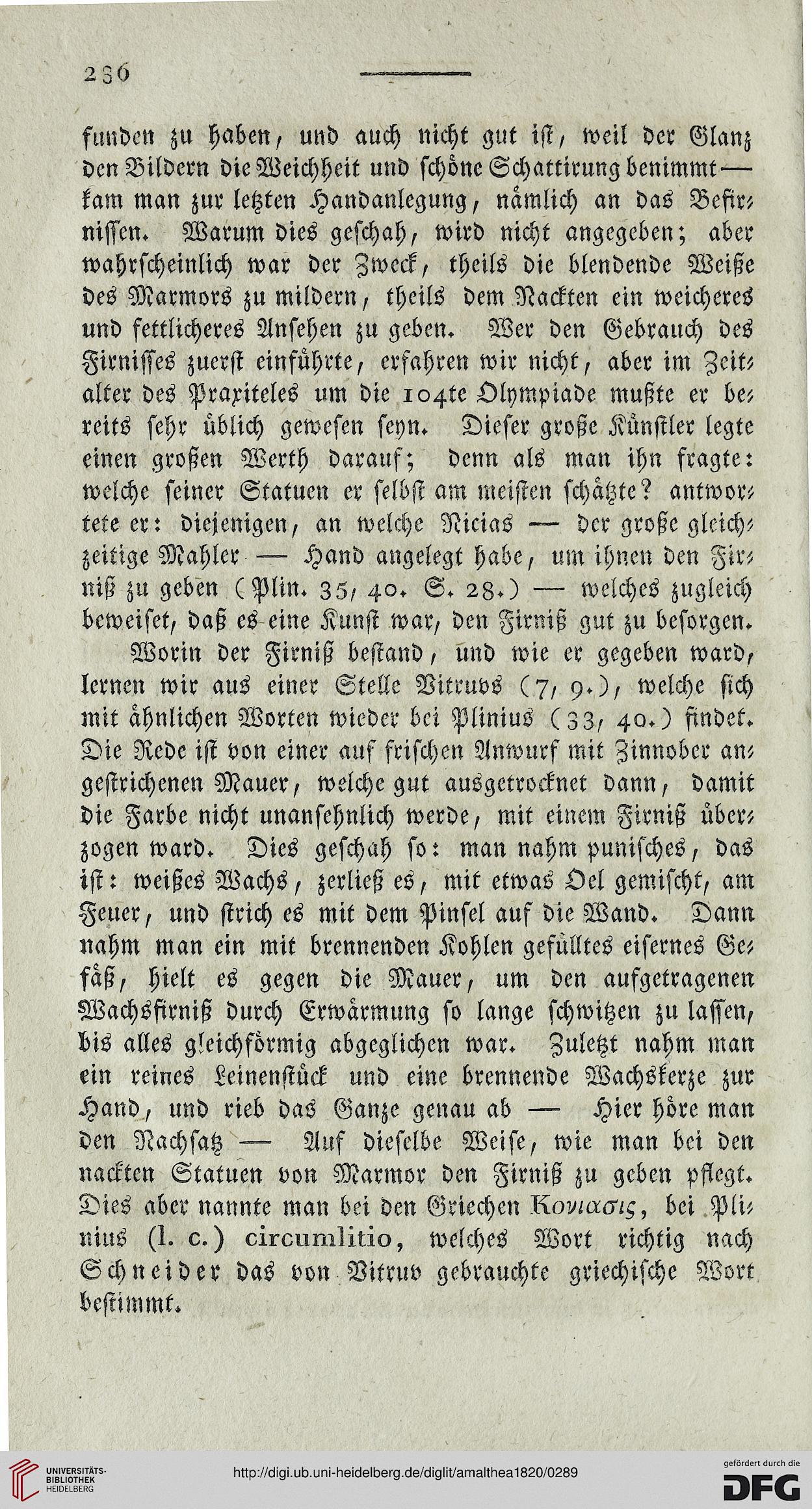236 ——-
funden zu haben, und auch nicht gut ist, weil der Glanz
den Bildern die Weichheit und schöne Schattirung benimmt—
kam man zur letzten Handanlegung, nämlich an das Bcfir-
nissen. Warum dies geschah, wird nicht angegeben; aber
wahrscheinlich war der Zweck, theils die blendende Weiße
des Marmors zu mildern, theils dem Nackten ein weicheres
und fettlicheres Ansehen zu geben. Wer den Gebrauch des
Firnisses zuerst einführte, erfahren wir nicht, aber im Zeit-
alter des Praxiteles um die 104(0 Olympiade mußte er be-
reits sehr üblich gewesen seyn. Dieser große Künstler legte
einen großen Werth darauf; denn als man ihn fragte:
welche seiner Statuen er selbst am meisten schätzte? antwor-
tete er: diejenigen, an welche Nicias — der große gleich-
zeitige Mahler — Hand angelegt habe, um ihnen den Fir-
niß zu geben (Plin. 35, 40. S. 23.) — welches zugleich
beweiset, daß cs eine Kunst war, den Firniß gut zu besorgen.
Worin der Firniß bestand, und wie er gegeben ward,
lernen wir aus einer Stelle Vitruvs (7, 9.), welche sich
mit ähnlichen Worten wieder bei Plinius (33, 40.) findet.
Die Rede ist von einer auf frischen Anwurf mit Zinnober an-
gestrichenen Mauer, welche gut ausgerrocknet dann, damit
die Farbe nicht unansehnlich werde, mit einem Firniß über-
zogen ward. Dies geschah so: man nahm punisches, das
ist: weißes Wachs, zerließ es, mit etwas Oel gemischt, am
Feuer, und strich es mit dem Pinsel auf die Wand. Dann
nahm man ein mit brennenden Kohlen gefülltes eisernes Ge-
fäß, hielt es gegen die Mauer, um den aufgetragenen
Wachsfirniß durch Erwärmung so lange schwitzen zu lassen,
bis alles gleichförmig abgeglichen war. Zuletzt nahm man
ein reines Leinenstück und eine brennende Wachskerze zur
Hand, und rieb das Ganze genau ab — Hier höre man
den Nachsatz — Auf dieselbe Weise, wie man bei den
nackten Statuen von Marmor den Firniß zu geben pflegt.
Dies aber nannte man bei den Griechen Koviaaig, bei Pli-
nius (l. c.) circumlitio, welches Wort richtig nach
Schneider das von Vitruv gebrauchte griechische Wort
bestimmt.
funden zu haben, und auch nicht gut ist, weil der Glanz
den Bildern die Weichheit und schöne Schattirung benimmt—
kam man zur letzten Handanlegung, nämlich an das Bcfir-
nissen. Warum dies geschah, wird nicht angegeben; aber
wahrscheinlich war der Zweck, theils die blendende Weiße
des Marmors zu mildern, theils dem Nackten ein weicheres
und fettlicheres Ansehen zu geben. Wer den Gebrauch des
Firnisses zuerst einführte, erfahren wir nicht, aber im Zeit-
alter des Praxiteles um die 104(0 Olympiade mußte er be-
reits sehr üblich gewesen seyn. Dieser große Künstler legte
einen großen Werth darauf; denn als man ihn fragte:
welche seiner Statuen er selbst am meisten schätzte? antwor-
tete er: diejenigen, an welche Nicias — der große gleich-
zeitige Mahler — Hand angelegt habe, um ihnen den Fir-
niß zu geben (Plin. 35, 40. S. 23.) — welches zugleich
beweiset, daß cs eine Kunst war, den Firniß gut zu besorgen.
Worin der Firniß bestand, und wie er gegeben ward,
lernen wir aus einer Stelle Vitruvs (7, 9.), welche sich
mit ähnlichen Worten wieder bei Plinius (33, 40.) findet.
Die Rede ist von einer auf frischen Anwurf mit Zinnober an-
gestrichenen Mauer, welche gut ausgerrocknet dann, damit
die Farbe nicht unansehnlich werde, mit einem Firniß über-
zogen ward. Dies geschah so: man nahm punisches, das
ist: weißes Wachs, zerließ es, mit etwas Oel gemischt, am
Feuer, und strich es mit dem Pinsel auf die Wand. Dann
nahm man ein mit brennenden Kohlen gefülltes eisernes Ge-
fäß, hielt es gegen die Mauer, um den aufgetragenen
Wachsfirniß durch Erwärmung so lange schwitzen zu lassen,
bis alles gleichförmig abgeglichen war. Zuletzt nahm man
ein reines Leinenstück und eine brennende Wachskerze zur
Hand, und rieb das Ganze genau ab — Hier höre man
den Nachsatz — Auf dieselbe Weise, wie man bei den
nackten Statuen von Marmor den Firniß zu geben pflegt.
Dies aber nannte man bei den Griechen Koviaaig, bei Pli-
nius (l. c.) circumlitio, welches Wort richtig nach
Schneider das von Vitruv gebrauchte griechische Wort
bestimmt.