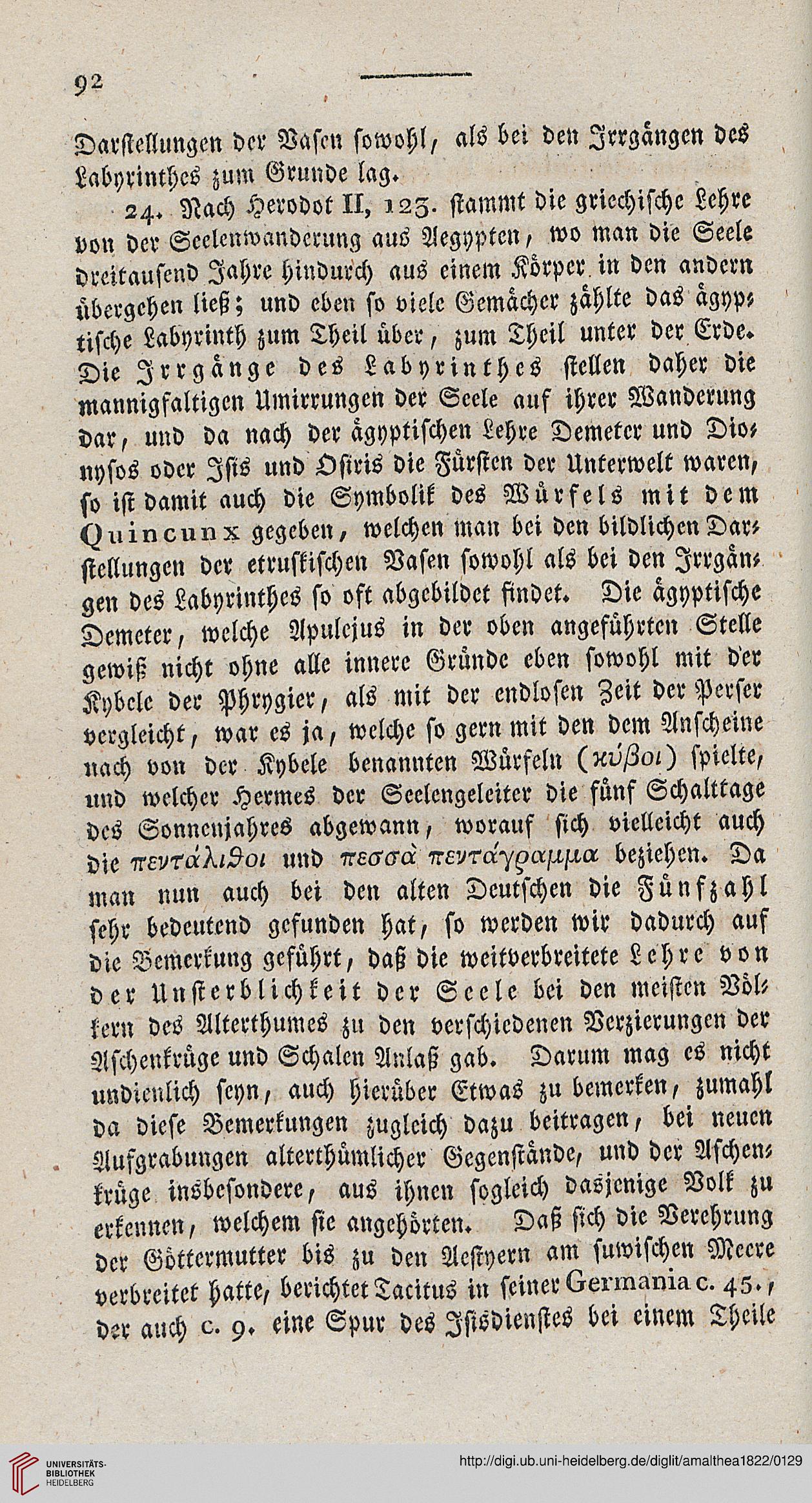92
Darstellungen der Vasen sowohl/ als bei den Jrrgängcn des
Labyrinthes zum Grunde lag.
24. Nach Herodot II, 12Z. stammt die griechische Lehre
von der Seelcnwandcrung aus Aegypten, wo man die Seele
dreitausend Jahre hindurch aus einem Körper in den andern
übergehen ließ; und eben so viele Gemacher zählte das ägyp-
tische Labyrinth zum Theil über, zum Thcil unter der Erde.
Die Jrrgängc des Labyrinthes stellen daher die
mannigfaltigen Umirrungen der Seele auf ihrer Wanderung
Dar, und da nach der ägyptischen Lehre Demeter und Dio-
nysos oder Isis und Osiris die Fürsten der Unterwelt waren,
so ist damit auch die Symbolik des Würfels mit dem
Quincunx gegeben/ welchen man bei den bildlichen Dar-
stellungen der etruskischen Vasen sowohl als bei den Jrrgän-
gen des Labyrinthes so oft abgcbildct findet. Die ägyptische
Demeter, welche Apulcjus in der oben angeführten Stelle
gewiß nicht ohne alle innere Gründe eben sowohl mit der
Kybcle der Phrygicr, als mit der endlosen Zeit der Perser
vergleicht, war cs ja, welche so gern mit den dem Anscheine
nach von der Kybele benannten Würfeln (xvßoi) spielte,
und welcher Hermes der Seelcngeleitcr die fünf Schalttage
des Sonncnjahrcs abgewann, worauf sich vielleicht auch
die irevrakiSoi und irecrcrä Trcvra'y^a/x/xa beziehen. Da
man nun auch bei den alten Deutschen die Fünfzahl
sehr bedeutend gefunden hat, so werden wir dadurch auf
die Bemerkung geführt, daß die weitverbreitete Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele bei den meisten Völ-
kern des Alterthumcs zu den verschiedenen Verzierungen der
Aschenkrüge und Schalen Anlaß gab. Darum mag cs nicht
undienlich scyn, auch hierüber Etwas zu bemerken, zumahl
da diese Bemerkungen zugleich dazu beitragen, bei neuen
Ausgrabungen alterthümlicher Gegenstände, und der Aschen-
krüge insbesondere, aus ihnen sogleich dasjenige Volk zu
erkennen, welchem sic angehörten. Daß sich die Verehrung
der Göttermutter bis zu den Acstyern am suwischcn Meere
verbreitet hatte, berichtetTacitus in seinerGermaniac. 45.,
der auch c. 9, eine Spur des Jsisdienstes bei einem Thcile
Darstellungen der Vasen sowohl/ als bei den Jrrgängcn des
Labyrinthes zum Grunde lag.
24. Nach Herodot II, 12Z. stammt die griechische Lehre
von der Seelcnwandcrung aus Aegypten, wo man die Seele
dreitausend Jahre hindurch aus einem Körper in den andern
übergehen ließ; und eben so viele Gemacher zählte das ägyp-
tische Labyrinth zum Theil über, zum Thcil unter der Erde.
Die Jrrgängc des Labyrinthes stellen daher die
mannigfaltigen Umirrungen der Seele auf ihrer Wanderung
Dar, und da nach der ägyptischen Lehre Demeter und Dio-
nysos oder Isis und Osiris die Fürsten der Unterwelt waren,
so ist damit auch die Symbolik des Würfels mit dem
Quincunx gegeben/ welchen man bei den bildlichen Dar-
stellungen der etruskischen Vasen sowohl als bei den Jrrgän-
gen des Labyrinthes so oft abgcbildct findet. Die ägyptische
Demeter, welche Apulcjus in der oben angeführten Stelle
gewiß nicht ohne alle innere Gründe eben sowohl mit der
Kybcle der Phrygicr, als mit der endlosen Zeit der Perser
vergleicht, war cs ja, welche so gern mit den dem Anscheine
nach von der Kybele benannten Würfeln (xvßoi) spielte,
und welcher Hermes der Seelcngeleitcr die fünf Schalttage
des Sonncnjahrcs abgewann, worauf sich vielleicht auch
die irevrakiSoi und irecrcrä Trcvra'y^a/x/xa beziehen. Da
man nun auch bei den alten Deutschen die Fünfzahl
sehr bedeutend gefunden hat, so werden wir dadurch auf
die Bemerkung geführt, daß die weitverbreitete Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele bei den meisten Völ-
kern des Alterthumcs zu den verschiedenen Verzierungen der
Aschenkrüge und Schalen Anlaß gab. Darum mag cs nicht
undienlich scyn, auch hierüber Etwas zu bemerken, zumahl
da diese Bemerkungen zugleich dazu beitragen, bei neuen
Ausgrabungen alterthümlicher Gegenstände, und der Aschen-
krüge insbesondere, aus ihnen sogleich dasjenige Volk zu
erkennen, welchem sic angehörten. Daß sich die Verehrung
der Göttermutter bis zu den Acstyern am suwischcn Meere
verbreitet hatte, berichtetTacitus in seinerGermaniac. 45.,
der auch c. 9, eine Spur des Jsisdienstes bei einem Thcile