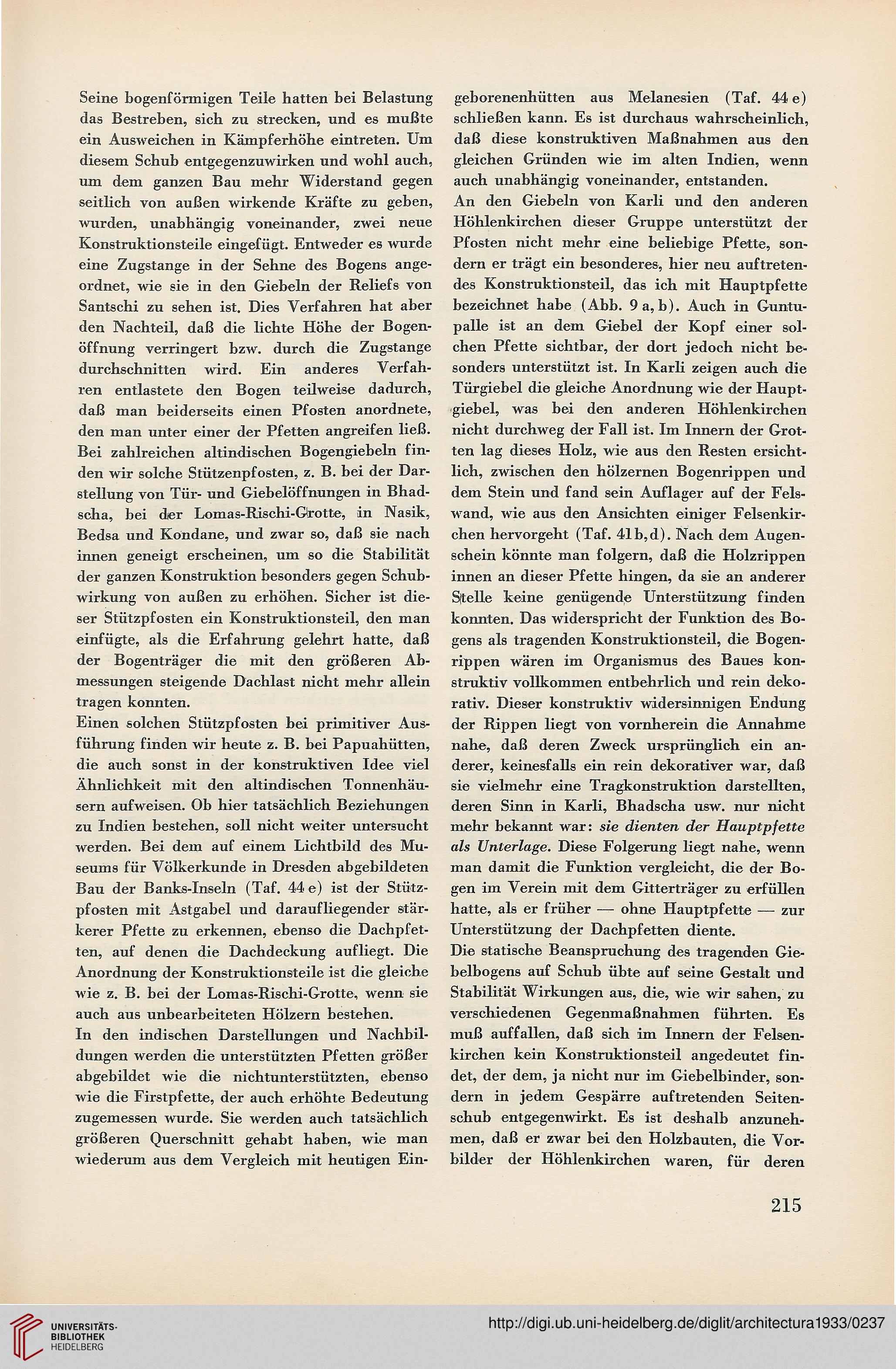Seine bogenförmigen Teile hatten bei Belastung
das Bestreben, sich zu strecken, und es mußte
ein Ausweichen in Kämpferhöhe eintreten. Um
diesem Schub entgegenzuwirken und wohl auch,
um dem ganzen Bau mehr Widerstand gegen
seitlich von außen wirkende Kräfte zu geben,
wurden, unabhängig voneinander, zwei neue
Konstruktionsteile eingefügt. Entweder es wurde
eine Zugstange in der Sehne des Bogens ange-
ordnet, wie sie in den Giebeln der Reliefs von
Santschi zu sehen ist. Dies Verfahren hat aber
den Nachteil, daß die lichte Höhe der Bogen-
öffnung verringert bzw. durch die Zugstange
durchschnitten wird. Ein anderes Verfah-
ren entlastete den Bogen teilweise dadurch,
daß man beiderseits einen Pfosten anordnete,
den man unter einer der Pfetten angreifen ließ.
Bei zahlreichen altindischen Bogengiebeln fin-
den wir solche Stützenpfosten, z. B. bei der Dar-
stellung von Tür- und Giebelöffnungen in Bhad-
scha, bei der Lomas-Rischi-Grotte, in Nasik,
Bedsa und Kondane, und zwar so, daß sie nach
innen geneigt erscheinen, um so die Stabilität
der ganzen Konstruktion besonders gegen Schub-
wirkung von außen zu erhöhen. Sicher ist die-
ser Stützpfosten ein Konstruktionsteil, den man
einfügte, als die Erfahrung gelehrt hatte, daß
der Bogenträger die mit den größeren Ab-
messungen steigende Dachlast nicht mehr allein
tragen konnten.
Einen solchen Stützpfosten bei primitiver Aus-
führung finden wir heute z. B. bei Papuahütten,
die auch sonst in der konstruktiven Idee viel
Ähnlichkeit mit den altindischen Tonnenhäu-
sern aufweisen. Ob hier tatsächlich Beziehungen
zu Indien bestehen, soll nicht weiter untersucht
werden. Bei dem auf einem Lichtbild des Mu-
seums für Völkerkunde in Dresden abgebildeten
Bau der Banks-Inseln (Taf. 44 e) ist der Stütz-
pfosten mit Astgabel und daraufliegender stär-
kerer Pfette zu erkennen, ebenso die Dachpfet-
ten, auf denen die Dachdeckung aufliegt. Die
Anordnung der Konstruktionsteile ist die gleiche
wie z. B. bei der Lomas-Rischi-Grotte, wenn sie
auch aus unbearbeiteten Hölzern bestehen.
In den indischen Darstellungen und Nachbil-
dungen werden die unterstützten Pfetten größer
abgebildet wie die nichtunterstützten, ebenso
wie die Firstpfette, der auch erhöhte Bedeutung
zugemessen wurde. Sie werden auch tatsächlich
größeren Querschnitt gehabt haben, wie man
wiederum aus dem Vergleich mit heutigen Ein-
geborenenhütten aus Melanesien (Taf. 44 e)
schließen kann. Es ist durchaus wahrscheinlich,
daß diese konstruktiven Maßnahmen aus den
gleichen Gründen wie im alten Indien, wenn
auch unabhängig voneinander, entstanden.
An den Giebeln von Karli und den anderen
Höhlenkirchen dieser Gruppe unterstützt der
Pfosten nicht mehr eine beliebige Pfette, son-
dern er trägt ein besonderes, hier neu auftreten-
des Konstruktionsteil, das ich mit Hauptpfette
bezeichnet habe (Abb. 9 a, b). Auch in Guntu-
palle ist an dem Giebel der Kopf einer sol-
chen Pfette sichtbar, der dort jedoch nicht be-
sonders unterstützt ist. In Karli zeigen auch die
Türgiebel die gleiche Anordnung wie der Haupt-
giebel, was bei den anderen Höhlenkirchen
nicht durchweg der Fall ist. Im Innern der Grot-
ten lag dieses Holz, wie aus den Resten ersicht-
lich, zwischen den hölzernen Bogenrippen und
dem Stein und fand sein Auflager auf der Fels-
wand, wie aus den Ansichten einiger Felsenkir-
chen hervorgeht (Taf. 41b,d). Nach dem Augen-
schein könnte man folgern, daß die Holzrippen
innen an dieser Pfette hingen, da sie an anderer
Sltelle keine genügende Unterstützung finden
konnten. Das widerspricht der Funktion des Bo-
gens als tragenden Konstruktionsteil, die Bogen-
rippen wären im Organismus des Baues kon-
struktiv vollkommen entbehrlich und rein deko-
rativ. Dieser konstruktiv widersinnigen Endung
der Rippen liegt von vornherein die Annahme
nahe, daß deren Zweck ursprünglich ein an-
derer, keinesfalls ein rein dekorativer war, daß
sie vielmehr eine Tragkonstruktion darstellten,
deren Sinn in Karli, Bhadscha usw. nur nicht
mehr bekannt war: sie dienten der Hauptpfette
als Unterlage. Diese Folgerung liegt nahe, wenn
man damit die Funktion vergleicht, die der Bo-
gen im Verein mit dem Gitterträger zu erfüllen
hatte, als er früher ■—• ohne Hauptpfette — zur
Unterstützung der Dachpfetten diente.
Die statische Beanspruchung des tragenden Gie-
belbogens auf Schub übte auf seine Gestalt und
Stabilität Wirkungen aus, die, wie wir sahen, zu
verschiedenen Gegenmaßnahmen führten. Es
muß auffallen, daß sich im Innern der Felsen-
kirchen kein Konstruktionsteil angedeutet fin-
det, der dem, ja nicht nur im Giebelbinder, son-
dern in jedem Gespärre auftretenden Seiten-
schub entgegenwirkt. Es ist deshalb anzuneh-
men, daß er zwar bei den Holzbauten, die Vor-
bilder der Höhlenkirchen waren, für deren
215
das Bestreben, sich zu strecken, und es mußte
ein Ausweichen in Kämpferhöhe eintreten. Um
diesem Schub entgegenzuwirken und wohl auch,
um dem ganzen Bau mehr Widerstand gegen
seitlich von außen wirkende Kräfte zu geben,
wurden, unabhängig voneinander, zwei neue
Konstruktionsteile eingefügt. Entweder es wurde
eine Zugstange in der Sehne des Bogens ange-
ordnet, wie sie in den Giebeln der Reliefs von
Santschi zu sehen ist. Dies Verfahren hat aber
den Nachteil, daß die lichte Höhe der Bogen-
öffnung verringert bzw. durch die Zugstange
durchschnitten wird. Ein anderes Verfah-
ren entlastete den Bogen teilweise dadurch,
daß man beiderseits einen Pfosten anordnete,
den man unter einer der Pfetten angreifen ließ.
Bei zahlreichen altindischen Bogengiebeln fin-
den wir solche Stützenpfosten, z. B. bei der Dar-
stellung von Tür- und Giebelöffnungen in Bhad-
scha, bei der Lomas-Rischi-Grotte, in Nasik,
Bedsa und Kondane, und zwar so, daß sie nach
innen geneigt erscheinen, um so die Stabilität
der ganzen Konstruktion besonders gegen Schub-
wirkung von außen zu erhöhen. Sicher ist die-
ser Stützpfosten ein Konstruktionsteil, den man
einfügte, als die Erfahrung gelehrt hatte, daß
der Bogenträger die mit den größeren Ab-
messungen steigende Dachlast nicht mehr allein
tragen konnten.
Einen solchen Stützpfosten bei primitiver Aus-
führung finden wir heute z. B. bei Papuahütten,
die auch sonst in der konstruktiven Idee viel
Ähnlichkeit mit den altindischen Tonnenhäu-
sern aufweisen. Ob hier tatsächlich Beziehungen
zu Indien bestehen, soll nicht weiter untersucht
werden. Bei dem auf einem Lichtbild des Mu-
seums für Völkerkunde in Dresden abgebildeten
Bau der Banks-Inseln (Taf. 44 e) ist der Stütz-
pfosten mit Astgabel und daraufliegender stär-
kerer Pfette zu erkennen, ebenso die Dachpfet-
ten, auf denen die Dachdeckung aufliegt. Die
Anordnung der Konstruktionsteile ist die gleiche
wie z. B. bei der Lomas-Rischi-Grotte, wenn sie
auch aus unbearbeiteten Hölzern bestehen.
In den indischen Darstellungen und Nachbil-
dungen werden die unterstützten Pfetten größer
abgebildet wie die nichtunterstützten, ebenso
wie die Firstpfette, der auch erhöhte Bedeutung
zugemessen wurde. Sie werden auch tatsächlich
größeren Querschnitt gehabt haben, wie man
wiederum aus dem Vergleich mit heutigen Ein-
geborenenhütten aus Melanesien (Taf. 44 e)
schließen kann. Es ist durchaus wahrscheinlich,
daß diese konstruktiven Maßnahmen aus den
gleichen Gründen wie im alten Indien, wenn
auch unabhängig voneinander, entstanden.
An den Giebeln von Karli und den anderen
Höhlenkirchen dieser Gruppe unterstützt der
Pfosten nicht mehr eine beliebige Pfette, son-
dern er trägt ein besonderes, hier neu auftreten-
des Konstruktionsteil, das ich mit Hauptpfette
bezeichnet habe (Abb. 9 a, b). Auch in Guntu-
palle ist an dem Giebel der Kopf einer sol-
chen Pfette sichtbar, der dort jedoch nicht be-
sonders unterstützt ist. In Karli zeigen auch die
Türgiebel die gleiche Anordnung wie der Haupt-
giebel, was bei den anderen Höhlenkirchen
nicht durchweg der Fall ist. Im Innern der Grot-
ten lag dieses Holz, wie aus den Resten ersicht-
lich, zwischen den hölzernen Bogenrippen und
dem Stein und fand sein Auflager auf der Fels-
wand, wie aus den Ansichten einiger Felsenkir-
chen hervorgeht (Taf. 41b,d). Nach dem Augen-
schein könnte man folgern, daß die Holzrippen
innen an dieser Pfette hingen, da sie an anderer
Sltelle keine genügende Unterstützung finden
konnten. Das widerspricht der Funktion des Bo-
gens als tragenden Konstruktionsteil, die Bogen-
rippen wären im Organismus des Baues kon-
struktiv vollkommen entbehrlich und rein deko-
rativ. Dieser konstruktiv widersinnigen Endung
der Rippen liegt von vornherein die Annahme
nahe, daß deren Zweck ursprünglich ein an-
derer, keinesfalls ein rein dekorativer war, daß
sie vielmehr eine Tragkonstruktion darstellten,
deren Sinn in Karli, Bhadscha usw. nur nicht
mehr bekannt war: sie dienten der Hauptpfette
als Unterlage. Diese Folgerung liegt nahe, wenn
man damit die Funktion vergleicht, die der Bo-
gen im Verein mit dem Gitterträger zu erfüllen
hatte, als er früher ■—• ohne Hauptpfette — zur
Unterstützung der Dachpfetten diente.
Die statische Beanspruchung des tragenden Gie-
belbogens auf Schub übte auf seine Gestalt und
Stabilität Wirkungen aus, die, wie wir sahen, zu
verschiedenen Gegenmaßnahmen führten. Es
muß auffallen, daß sich im Innern der Felsen-
kirchen kein Konstruktionsteil angedeutet fin-
det, der dem, ja nicht nur im Giebelbinder, son-
dern in jedem Gespärre auftretenden Seiten-
schub entgegenwirkt. Es ist deshalb anzuneh-
men, daß er zwar bei den Holzbauten, die Vor-
bilder der Höhlenkirchen waren, für deren
215