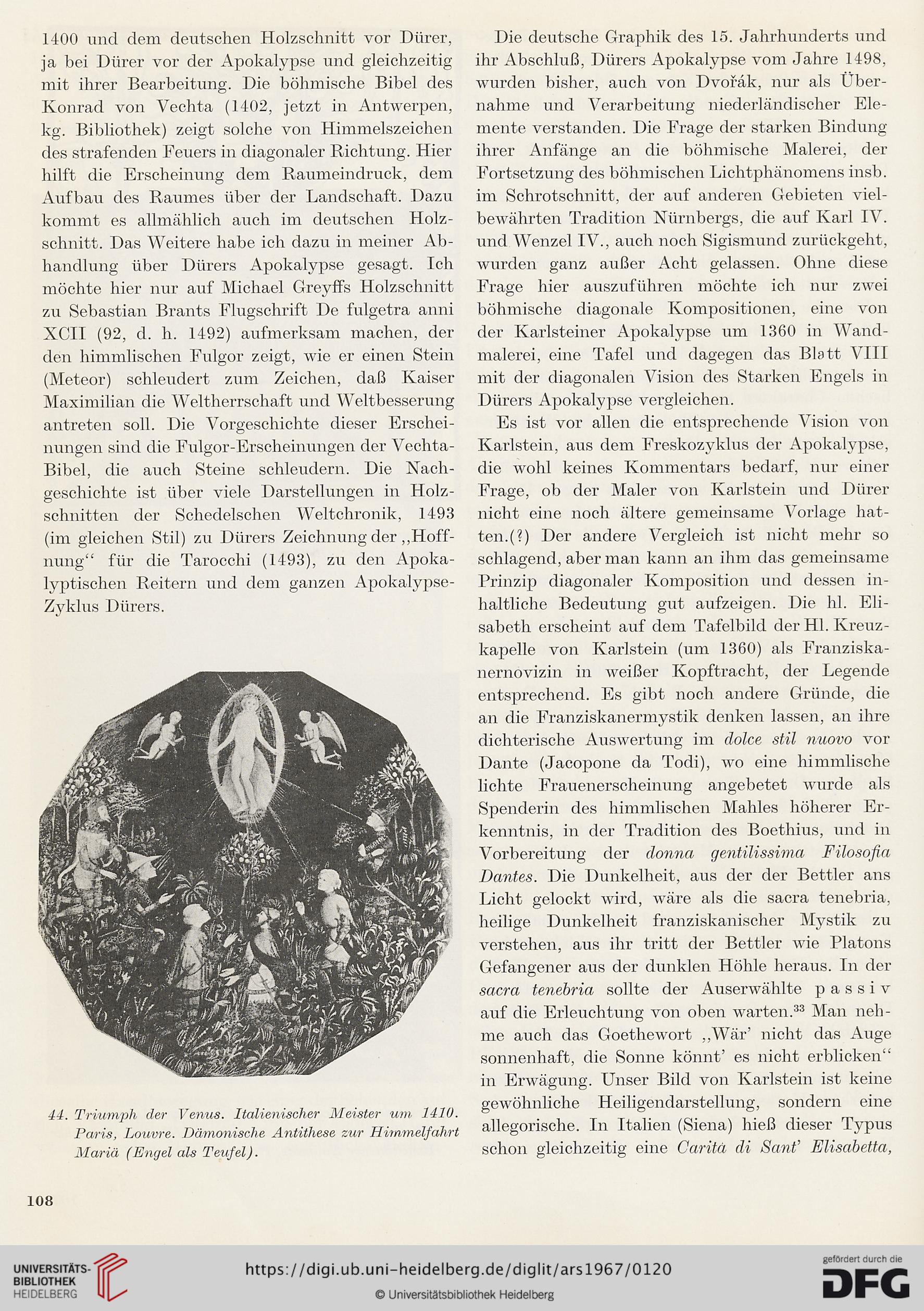1400 und dem deutschen Holzschnitt vor Dürer,
ja bei Dürer vor der Apokalypse und gleichzeitig
mit ihrer Bearbeitung. Die böhmische Bibel des
Konrad von Vechta (1402, jetzt in Antwerpen,
kg. Bibliothek) zeigt solche von Himmelszeichen
des strafenden Feuers in diagonaler Richtung. Hier
hilft die Erscheinung dem Raumeindruck, dem
Aufbau des Raumes über der Landschaft. Dazu
kommt es allmählich auch im deutschen Holz-
schnitt. Das Weitere habe ich dazu in meiner Ab-
handlung über Dürers Apokalypse gesagt. Ich
möchte hier nur auf Michael Greyffs Holzschnitt
zu Sebastian Brants Flugschrift De fulgetra anni
XCII (92, d. h. 1492) aufmerksam machen, der
den himmlischen Fulgor zeigt, wie er einen Stein
(Meteor) schleudert zum Zeichen, daß Kaiser
Maximilian die Weltherrschaft und Weltbesserung
antreten soll. Die Vorgeschichte dieser Erschei-
nungen sind die Fulgor-Erscheinungen der Vechta-
Bibel, die auch Steine schleudern. Die Nach-
geschichte ist über viele Darstellungen in Holz-
schnitten der Schedelschen Weltchronik, 1493
(im gleichen Stil) zu Dürers Zeichnung der „Hoff-
nung“ für die Tarocchi (1493), zu den Apoka-
lyptischen Reitern und dem ganzen Apokalypse-
Zyklus Dürers.
44. Triumph der Venus. Italienischer Meister um 1410.
Paris, Louvre. Dämonische Antithese zur Himmelfahrt
Mariä (Engel als Teufel).
Die deutsche Graphik des 15. Jahrhunderts und
ihr Abschluß, Dürers Apokalypse vom Jahre 1498,
wurden bisher, auch von Dvořák, nur als Über-
nahme und Verarbeitung niederländischer Ele-
mente verstanden. Die Frage der starken Bindung
ihrer Anfänge an die böhmische Malerei, der
Fortsetzung des böhmischen Lichtphänomens insb.
im Schrotschnitt, der auf anderen Gebieten viel-
bewährten Tradition Nürnbergs, die auf Karl IV.
und Wenzel IV., auch noch Sigismund zurückgeht,
wurden ganz außer Acht gelassen. Ohne diese
Frage hier auszuführen möchte ich nur zwei
böhmische diagonale Kompositionen, eine von
der Karlsteiner Apokalypse um 1360 in Wand-
malerei, eine Tafel und dagegen das Blatt VIII
mit der diagonalen Vision des Starken Engels in
Dürers Apokalypse vergleichen.
Es ist vor allen die entsprechende Vision von
Karlstein, aus dem Freskozyklus der Apokalypse,
die wohl keines Kommentars bedarf, nur einer
Frage, ob der Maler von Karlstein und Dürer
nicht eine noch ältere gemeinsame Vorlage hat-
ten^?) Der andere Vergleich ist nicht mehr so
schlagend, aber man kann an ihm das gemeinsame
Prinzip diagonaler Komposition und dessen in-
haltliche Bedeutung gut aufzeigen. Die hl. Eli-
sabeth erscheint auf dem Tafelbild der Hl. Kreuz-
kapelle von Karlstein (um 1360) als Franziska-
nernovizin in weißer Kopftracht, der Legende
entsprechend. Es gibt noch andere Gründe, die
an die Franziskanermystik denken lassen, an ihre
dichterische Auswertung im dolce stil nuovo vor
Dante (Jacopone da Todi), wo eine himmlische
lichte Frauenerscheinung angebetet wurde als
Spenderin des himmlischen Mahles höherer Er-
kenntnis, in der Tradition des Boethius, und in
Vorbereitung der donna gentilissima Filosofia
Dantes. Die Dunkelheit, aus der der Bettler ans
Licht gelockt wird, wäre als die sacra tenebria,
heilige Dunkelheit franziskanischer Mystik zu
verstehen, aus ihr tritt der Bettler wie Platons
Gefangener aus der dunklen Höhle heraus. In der
sacra tenebria sollte der Auserwählte passiv
auf die Erleuchtung von oben warten.33 Man neh-
me auch das Goethewort „Wär’ nicht das Auge
sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nicht erblicken“
in Erwägung. Unser Bild von Karlstein ist keine
gewöhnliche Heiligendarstellung, sondern eine
allegorische. In Italien (Siena) hieß dieser Typus
schon gleichzeitig eine Caritá di Sant’ Elisabetta,
108
ja bei Dürer vor der Apokalypse und gleichzeitig
mit ihrer Bearbeitung. Die böhmische Bibel des
Konrad von Vechta (1402, jetzt in Antwerpen,
kg. Bibliothek) zeigt solche von Himmelszeichen
des strafenden Feuers in diagonaler Richtung. Hier
hilft die Erscheinung dem Raumeindruck, dem
Aufbau des Raumes über der Landschaft. Dazu
kommt es allmählich auch im deutschen Holz-
schnitt. Das Weitere habe ich dazu in meiner Ab-
handlung über Dürers Apokalypse gesagt. Ich
möchte hier nur auf Michael Greyffs Holzschnitt
zu Sebastian Brants Flugschrift De fulgetra anni
XCII (92, d. h. 1492) aufmerksam machen, der
den himmlischen Fulgor zeigt, wie er einen Stein
(Meteor) schleudert zum Zeichen, daß Kaiser
Maximilian die Weltherrschaft und Weltbesserung
antreten soll. Die Vorgeschichte dieser Erschei-
nungen sind die Fulgor-Erscheinungen der Vechta-
Bibel, die auch Steine schleudern. Die Nach-
geschichte ist über viele Darstellungen in Holz-
schnitten der Schedelschen Weltchronik, 1493
(im gleichen Stil) zu Dürers Zeichnung der „Hoff-
nung“ für die Tarocchi (1493), zu den Apoka-
lyptischen Reitern und dem ganzen Apokalypse-
Zyklus Dürers.
44. Triumph der Venus. Italienischer Meister um 1410.
Paris, Louvre. Dämonische Antithese zur Himmelfahrt
Mariä (Engel als Teufel).
Die deutsche Graphik des 15. Jahrhunderts und
ihr Abschluß, Dürers Apokalypse vom Jahre 1498,
wurden bisher, auch von Dvořák, nur als Über-
nahme und Verarbeitung niederländischer Ele-
mente verstanden. Die Frage der starken Bindung
ihrer Anfänge an die böhmische Malerei, der
Fortsetzung des böhmischen Lichtphänomens insb.
im Schrotschnitt, der auf anderen Gebieten viel-
bewährten Tradition Nürnbergs, die auf Karl IV.
und Wenzel IV., auch noch Sigismund zurückgeht,
wurden ganz außer Acht gelassen. Ohne diese
Frage hier auszuführen möchte ich nur zwei
böhmische diagonale Kompositionen, eine von
der Karlsteiner Apokalypse um 1360 in Wand-
malerei, eine Tafel und dagegen das Blatt VIII
mit der diagonalen Vision des Starken Engels in
Dürers Apokalypse vergleichen.
Es ist vor allen die entsprechende Vision von
Karlstein, aus dem Freskozyklus der Apokalypse,
die wohl keines Kommentars bedarf, nur einer
Frage, ob der Maler von Karlstein und Dürer
nicht eine noch ältere gemeinsame Vorlage hat-
ten^?) Der andere Vergleich ist nicht mehr so
schlagend, aber man kann an ihm das gemeinsame
Prinzip diagonaler Komposition und dessen in-
haltliche Bedeutung gut aufzeigen. Die hl. Eli-
sabeth erscheint auf dem Tafelbild der Hl. Kreuz-
kapelle von Karlstein (um 1360) als Franziska-
nernovizin in weißer Kopftracht, der Legende
entsprechend. Es gibt noch andere Gründe, die
an die Franziskanermystik denken lassen, an ihre
dichterische Auswertung im dolce stil nuovo vor
Dante (Jacopone da Todi), wo eine himmlische
lichte Frauenerscheinung angebetet wurde als
Spenderin des himmlischen Mahles höherer Er-
kenntnis, in der Tradition des Boethius, und in
Vorbereitung der donna gentilissima Filosofia
Dantes. Die Dunkelheit, aus der der Bettler ans
Licht gelockt wird, wäre als die sacra tenebria,
heilige Dunkelheit franziskanischer Mystik zu
verstehen, aus ihr tritt der Bettler wie Platons
Gefangener aus der dunklen Höhle heraus. In der
sacra tenebria sollte der Auserwählte passiv
auf die Erleuchtung von oben warten.33 Man neh-
me auch das Goethewort „Wär’ nicht das Auge
sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nicht erblicken“
in Erwägung. Unser Bild von Karlstein ist keine
gewöhnliche Heiligendarstellung, sondern eine
allegorische. In Italien (Siena) hieß dieser Typus
schon gleichzeitig eine Caritá di Sant’ Elisabetta,
108