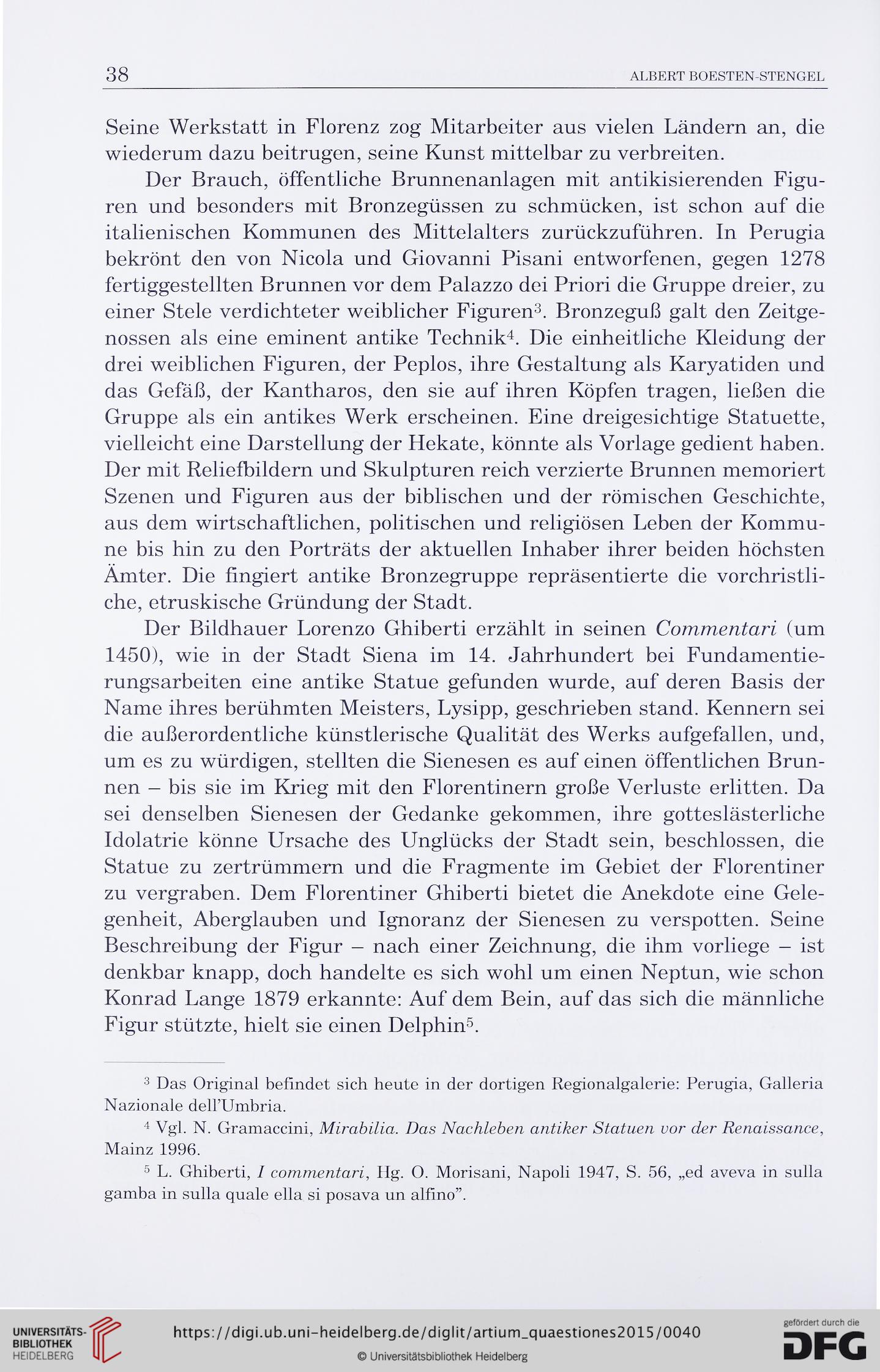38
ALBERT BOESTEN-STENGEL
Seine Werkstatt in Florenz zog Mitarbeiter aus vielen Ländern an, die
wiederum dazu beitrugen, seine Kunst mittelbar zu verbreiten.
Der Brauch, öffentliche Brunnenanlagen mit antikisierenden Figu-
ren und besonders mit Bronzegüssen zu schmücken, ist schon auf die
italienischen Kommunen des Mittelalters zurückzuführen. In Perugia
bekrönt den von Nicola und Giovanni Pisani entworfenen, gegen 1278
fertiggestellten Brunnen vor dem Palazzo dei Priori die Gruppe dreier, zu
einer Stele verdichteter weiblicher Figuren3. Bronzeguß galt den Zeitge-
nossen als eine eminent antike Technik4. Die einheitliche Kleidung der
drei weiblichen Figuren, der Peplos, ihre Gestaltung als Karyatiden und
das Gefäß, der Kantharos, den sie auf ihren Köpfen tragen, ließen die
Gruppe als ein antikes Werk erscheinen. Eine dreigesichtige Statuette,
vielleicht eine Darstellung der Hekate, könnte als Vorlage gedient haben.
Der mit Reliefbildem und Skulpturen reich verzierte Brunnen memoriert
Szenen und Figuren aus der biblischen und der römischen Geschichte,
aus dem wirtschaftlichen, politischen und religiösen Leben der Kommu-
ne bis hin zu den Porträts der aktuellen Inhaber ihrer beiden höchsten
Ämter. Die fingiert antike Bronzegruppe repräsentierte die vorchristli-
che, etruskische Gründung der Stadt.
Der Bildhauer Lorenzo Ghiberti erzählt in seinen Commentari (um
1450), wie in der Stadt Siena im 14. Jahrhundert bei Fundamentie-
rungsarbeiten eine antike Statue gefunden wurde, auf deren Basis der
Name ihres berühmten Meisters, Lysipp, geschrieben stand. Kennern sei
die außerordentliche künstlerische Qualität des Werks aufgefallen, und,
um es zu würdigen, stellten die Sienesen es auf einen öffentlichen Brun-
nen - bis sie im Krieg mit den Florentinern große Verluste erlitten. Da
sei denselben Sienesen der Gedanke gekommen, ihre gotteslästerliche
Idolatrie könne Ursache des Unglücks der Stadt sein, beschlossen, die
Statue zu zertrümmern und die Fragmente im Gebiet der Florentiner
zu vergraben. Dem Florentiner Ghiberti bietet die Anekdote eine Gele-
genheit, Aberglauben und Ignoranz der Sienesen zu verspotten. Seine
Beschreibung der Figur - nach einer Zeichnung, die ihm vorliege - ist
denkbar knapp, doch handelte es sich wohl um einen Neptun, wie schon
Konrad Lange 1879 erkannte: Auf dem Bein, auf das sich die männliche
Figur stützte, hielt sie einen Delphin5.
3 Das Original befindet sich heute in der dortigen Regionalgalerie: Perugia, Galleria
Nazionale dellUmbria.
4 Vgl. N. Gramaccini, Mirabilia. Das Nachleben antiker Statuen vor der Renaissance,
Mainz 1996.
5 L. Ghiberti, / commentari, Hg. O. Morisani, Napoli 1947, S. 56, „ed aveva in sulla
gamba in sulla quale ella si posava un alfino”.
ALBERT BOESTEN-STENGEL
Seine Werkstatt in Florenz zog Mitarbeiter aus vielen Ländern an, die
wiederum dazu beitrugen, seine Kunst mittelbar zu verbreiten.
Der Brauch, öffentliche Brunnenanlagen mit antikisierenden Figu-
ren und besonders mit Bronzegüssen zu schmücken, ist schon auf die
italienischen Kommunen des Mittelalters zurückzuführen. In Perugia
bekrönt den von Nicola und Giovanni Pisani entworfenen, gegen 1278
fertiggestellten Brunnen vor dem Palazzo dei Priori die Gruppe dreier, zu
einer Stele verdichteter weiblicher Figuren3. Bronzeguß galt den Zeitge-
nossen als eine eminent antike Technik4. Die einheitliche Kleidung der
drei weiblichen Figuren, der Peplos, ihre Gestaltung als Karyatiden und
das Gefäß, der Kantharos, den sie auf ihren Köpfen tragen, ließen die
Gruppe als ein antikes Werk erscheinen. Eine dreigesichtige Statuette,
vielleicht eine Darstellung der Hekate, könnte als Vorlage gedient haben.
Der mit Reliefbildem und Skulpturen reich verzierte Brunnen memoriert
Szenen und Figuren aus der biblischen und der römischen Geschichte,
aus dem wirtschaftlichen, politischen und religiösen Leben der Kommu-
ne bis hin zu den Porträts der aktuellen Inhaber ihrer beiden höchsten
Ämter. Die fingiert antike Bronzegruppe repräsentierte die vorchristli-
che, etruskische Gründung der Stadt.
Der Bildhauer Lorenzo Ghiberti erzählt in seinen Commentari (um
1450), wie in der Stadt Siena im 14. Jahrhundert bei Fundamentie-
rungsarbeiten eine antike Statue gefunden wurde, auf deren Basis der
Name ihres berühmten Meisters, Lysipp, geschrieben stand. Kennern sei
die außerordentliche künstlerische Qualität des Werks aufgefallen, und,
um es zu würdigen, stellten die Sienesen es auf einen öffentlichen Brun-
nen - bis sie im Krieg mit den Florentinern große Verluste erlitten. Da
sei denselben Sienesen der Gedanke gekommen, ihre gotteslästerliche
Idolatrie könne Ursache des Unglücks der Stadt sein, beschlossen, die
Statue zu zertrümmern und die Fragmente im Gebiet der Florentiner
zu vergraben. Dem Florentiner Ghiberti bietet die Anekdote eine Gele-
genheit, Aberglauben und Ignoranz der Sienesen zu verspotten. Seine
Beschreibung der Figur - nach einer Zeichnung, die ihm vorliege - ist
denkbar knapp, doch handelte es sich wohl um einen Neptun, wie schon
Konrad Lange 1879 erkannte: Auf dem Bein, auf das sich die männliche
Figur stützte, hielt sie einen Delphin5.
3 Das Original befindet sich heute in der dortigen Regionalgalerie: Perugia, Galleria
Nazionale dellUmbria.
4 Vgl. N. Gramaccini, Mirabilia. Das Nachleben antiker Statuen vor der Renaissance,
Mainz 1996.
5 L. Ghiberti, / commentari, Hg. O. Morisani, Napoli 1947, S. 56, „ed aveva in sulla
gamba in sulla quale ella si posava un alfino”.