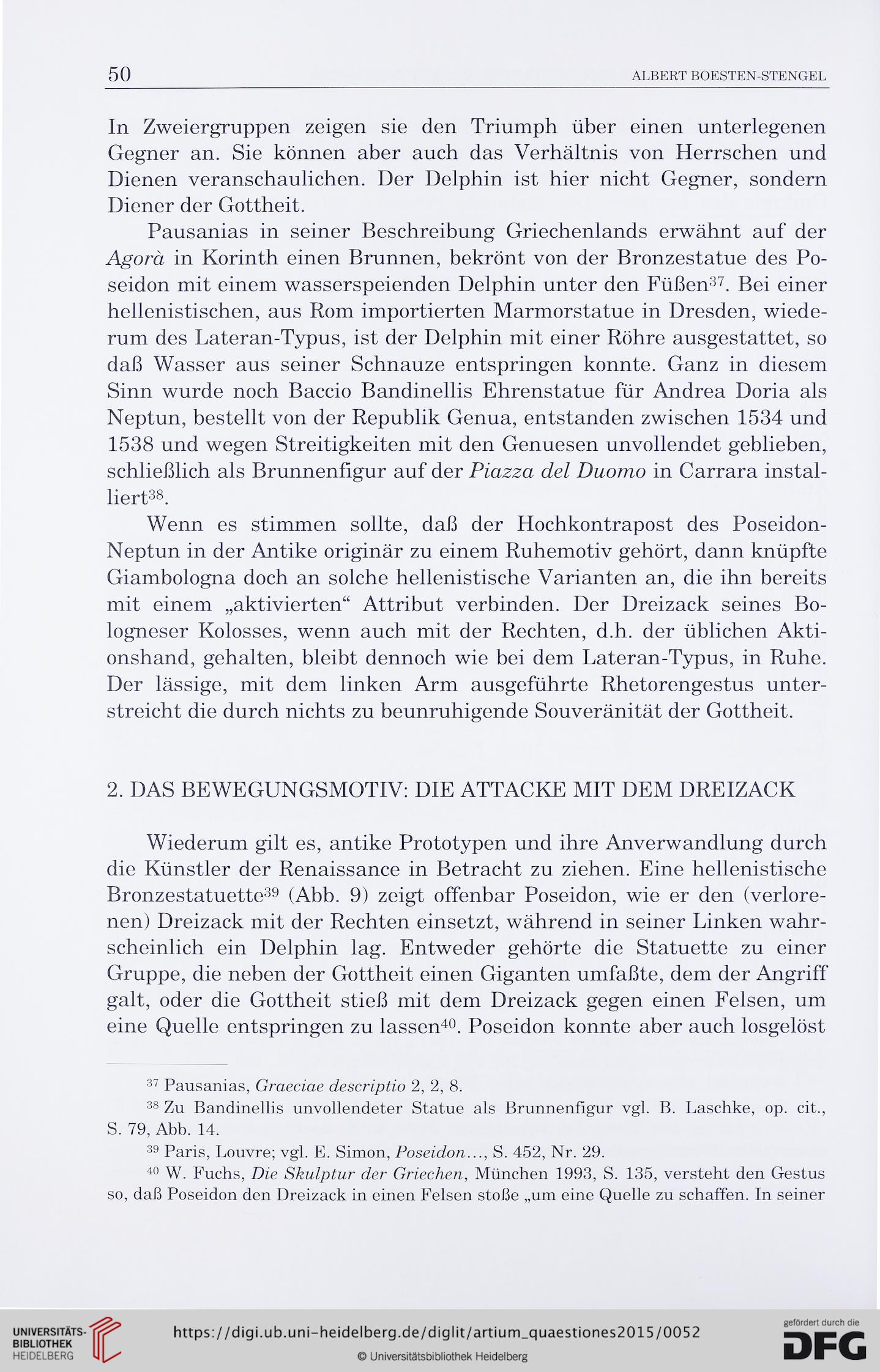50
ALBERT BOESTEN-STENGEL
In Zweiergruppen zeigen sie den Triumph über einen unterlegenen
Gegner an. Sie können aber auch das Verhältnis von Herrschen und
Dienen veranschaulichen. Der Delphin ist hier nicht Gegner, sondern
Diener der Gottheit.
Pausanias in seiner Beschreibung Griechenlands erwähnt auf der
Agorà in Korinth einen Brunnen, bekrönt von der Bronzestatue des Po-
seidon mit einem wasserspeienden Delphin unter den Füßen37. Bei einer
hellenistischen, aus Rom importierten Marmorstatue in Dresden, wiede-
rum des Lateran-Typus, ist der Delphin mit einer Röhre ausgestattet, so
daß Wasser aus seiner Schnauze entspringen konnte. Ganz in diesem
Sinn wurde noch Baccio Bandinellis Ehrenstatue für Andrea Doria als
Neptun, bestellt von der Republik Genua, entstanden zwischen 1534 und
1538 und wegen Streitigkeiten mit den Genuesen unvollendet geblieben,
schließlich als Brunnenfigur auf der Piazza del Duomo in Carrara instal-
liert38.
Wenn es stimmen sollte, daß der Hochkontrapost des Poseidon-
Neptun in der Antike originär zu einem Ruhemotiv gehört, dann knüpfte
Giambologna doch an solche hellenistische Varianten an, die ihn bereits
mit einem „aktivierten“ Attribut verbinden. Der Dreizack seines Bo-
logneser Kolosses, wenn auch mit der Rechten, d.h. der üblichen Akti-
onshand, gehalten, bleibt dennoch wie bei dem Lateran-Typus, in Ruhe.
Der lässige, mit dem linken Arm ausgeführte Rhetorengestus unter-
streicht die durch nichts zu beunruhigende Souveränität der Gottheit.
2. DAS BEWEGUNGSMOTIV: DIE ATTACKE MIT DEM DREIZACK
Wiederum gilt es, antike Prototypen und ihre Anverwandlung durch
die Künstler der Renaissance in Betracht zu ziehen. Eine hellenistische
Bronzestatuette39 (Abb. 9) zeigt offenbar Poseidon, wie er den (verlore-
nen) Dreizack mit der Rechten einsetzt, während in seiner Linken wahr-
scheinlich ein Delphin lag. Entweder gehörte die Statuette zu einer
Gruppe, die neben der Gottheit einen Giganten umfaßte, dem der Angriff
galt, oder die Gottheit stieß mit dem Dreizack gegen einen Felsen, um
eine Quelle entspringen zu lassen40. Poseidon konnte aber auch losgelöst
37 Pausanias, Graeciae descriptio 2, 2, 8.
38 Zu Bandinellis unvollendeter Statue als Brunnenfigur vgl. B. Laschke, op. cit.,
S. 79, Abb. 14.
39 Paris, Louvre; vgl. E. Simon, Poseidon..., S. 452, Nr. 29.
40 W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen, München 1993, S. 135, versteht den Gestus
so, daß Poseidon den Dreizack in einen Felsen stoße „um eine Quelle zu schaffen. In seiner
ALBERT BOESTEN-STENGEL
In Zweiergruppen zeigen sie den Triumph über einen unterlegenen
Gegner an. Sie können aber auch das Verhältnis von Herrschen und
Dienen veranschaulichen. Der Delphin ist hier nicht Gegner, sondern
Diener der Gottheit.
Pausanias in seiner Beschreibung Griechenlands erwähnt auf der
Agorà in Korinth einen Brunnen, bekrönt von der Bronzestatue des Po-
seidon mit einem wasserspeienden Delphin unter den Füßen37. Bei einer
hellenistischen, aus Rom importierten Marmorstatue in Dresden, wiede-
rum des Lateran-Typus, ist der Delphin mit einer Röhre ausgestattet, so
daß Wasser aus seiner Schnauze entspringen konnte. Ganz in diesem
Sinn wurde noch Baccio Bandinellis Ehrenstatue für Andrea Doria als
Neptun, bestellt von der Republik Genua, entstanden zwischen 1534 und
1538 und wegen Streitigkeiten mit den Genuesen unvollendet geblieben,
schließlich als Brunnenfigur auf der Piazza del Duomo in Carrara instal-
liert38.
Wenn es stimmen sollte, daß der Hochkontrapost des Poseidon-
Neptun in der Antike originär zu einem Ruhemotiv gehört, dann knüpfte
Giambologna doch an solche hellenistische Varianten an, die ihn bereits
mit einem „aktivierten“ Attribut verbinden. Der Dreizack seines Bo-
logneser Kolosses, wenn auch mit der Rechten, d.h. der üblichen Akti-
onshand, gehalten, bleibt dennoch wie bei dem Lateran-Typus, in Ruhe.
Der lässige, mit dem linken Arm ausgeführte Rhetorengestus unter-
streicht die durch nichts zu beunruhigende Souveränität der Gottheit.
2. DAS BEWEGUNGSMOTIV: DIE ATTACKE MIT DEM DREIZACK
Wiederum gilt es, antike Prototypen und ihre Anverwandlung durch
die Künstler der Renaissance in Betracht zu ziehen. Eine hellenistische
Bronzestatuette39 (Abb. 9) zeigt offenbar Poseidon, wie er den (verlore-
nen) Dreizack mit der Rechten einsetzt, während in seiner Linken wahr-
scheinlich ein Delphin lag. Entweder gehörte die Statuette zu einer
Gruppe, die neben der Gottheit einen Giganten umfaßte, dem der Angriff
galt, oder die Gottheit stieß mit dem Dreizack gegen einen Felsen, um
eine Quelle entspringen zu lassen40. Poseidon konnte aber auch losgelöst
37 Pausanias, Graeciae descriptio 2, 2, 8.
38 Zu Bandinellis unvollendeter Statue als Brunnenfigur vgl. B. Laschke, op. cit.,
S. 79, Abb. 14.
39 Paris, Louvre; vgl. E. Simon, Poseidon..., S. 452, Nr. 29.
40 W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen, München 1993, S. 135, versteht den Gestus
so, daß Poseidon den Dreizack in einen Felsen stoße „um eine Quelle zu schaffen. In seiner