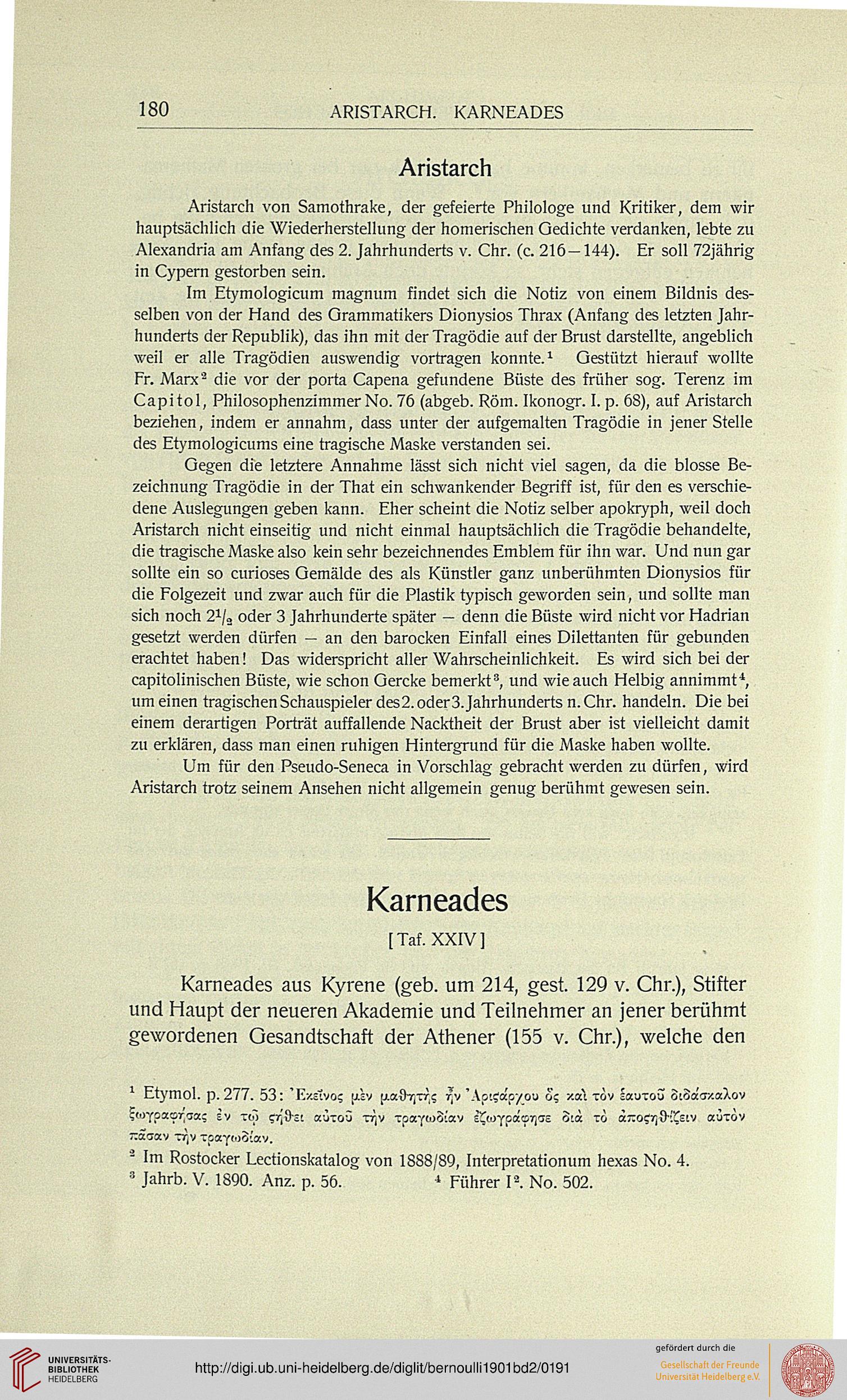180 ARISTARCH. KARNEADES
Aristarch
Aristarch von Samothrake, der gefeierte Philologe und Kritiker, dem wir
hauptsächlich die Wiederherstellung der homerischen Gedichte verdanken, lebte zu
Alexandria am Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. (c. 216-144). Er soll 72jährig
in Cypern gestorben sein.
Im Etymologicum magnum findet sich die Notiz von einem Bildnis des-
selben von der Hand des Grammatikers Dionysios Thrax (Anfang des letzten Jahr-
hunderts der Republik), das ihn mit der Tragödie auf der Brust darstellte, angeblich
weil er alle Tragödien auswendig vortragen konnte.1 Gestützt hierauf wollte
Fr. Marx2 die vor der porta Capena gefundene Büste des früher sog. Terenz im
Capitol, Philosophenzimmer No. 76 (abgeb. Rom. Ikonogr. I. p. 68), auf Aristarch
beziehen, indem er annahm, dass unter der aufgemalten Tragödie in jener Stelle
des Etymologieunis eine tragische Maske verstanden sei.
Gegen die letztere Annahme Iässt sich nicht viel sagen, da die blosse Be-
zeichnung Tragödie in der That ein schwankender Begriff ist, für den es verschie-
dene Auslegungen geben kann. Eher scheint die Notiz selber apokryph, weil doch
Aristarch nicht einseitig und nicht einmal hauptsächlich die Tragödie behandelte,
die tragische Maske also kein sehr bezeichnendes Emblem für ihn war. Und nun gar
sollte ein so curioses Gemälde des als Künstler ganz unberühmten Dionysios für
die Folgezeit und zwar auch für die Plastik typisch geworden sein, und sollte man
sich noch 2% oder 3 Jahrhunderte später - denn die Büste wird nicht vor Hadrian
gesetzt werden dürfen - an den barocken Einfall eines Dilettanten für gebunden
erachtet haben! Das widerspricht aller Wahrscheinlichkeit. Es wird sich bei der
capitolinischen Büste, wie schon Gercke bemerkt3, und wie auch Heibig annimmt1,
um einen tragischenSchauspielerdes2.oder3.Jahrhunderts n.Chr. handeln. Die bei
einem derartigen Porträt auffallende Nacktheit der Brust aber ist vielleicht damit
zu erklären, dass man einen ruhigen Hintergrund für die Maske haben wollte.
Um für den Pseudo-Seneca in Vorschlag gebracht werden zu dürfen, wird
Aristarch trotz seinem Ansehen nicht allgemein genug berühmt gewesen sein.
Karneades
[Taf. XXIV]
Karneades aus Kyrene (geb. um 214, gest. 129 v. Chr.), Stifter
und Haupt der neueren Akademie und Teilnehmer an jener berühmt
gewordenen Gesandtschaft der Athener (155 v. Chr.), welche den
1 Etymol. p. 277. 53: 'EzsTvo; filv [AaChrcr,? ry 'AptSap/ou o; xA tov lauxou StSäa/.aXov
^wCpaor^a; hl nji ;rjDc! aü-oü T^v ToaycoSiav &i>-ypäo7]3e 3:a tg ä-o;ri0-!t£iv aüxov
~aaav Tr(v -paytoSiav.
2 Im Rostocker Lectionskatalog von 1888/89, Interpretationum hexas No. 4.
3 Jahrb. V. 1890. Anz. p. 56. i Führer I2. No. 502.
Aristarch
Aristarch von Samothrake, der gefeierte Philologe und Kritiker, dem wir
hauptsächlich die Wiederherstellung der homerischen Gedichte verdanken, lebte zu
Alexandria am Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. (c. 216-144). Er soll 72jährig
in Cypern gestorben sein.
Im Etymologicum magnum findet sich die Notiz von einem Bildnis des-
selben von der Hand des Grammatikers Dionysios Thrax (Anfang des letzten Jahr-
hunderts der Republik), das ihn mit der Tragödie auf der Brust darstellte, angeblich
weil er alle Tragödien auswendig vortragen konnte.1 Gestützt hierauf wollte
Fr. Marx2 die vor der porta Capena gefundene Büste des früher sog. Terenz im
Capitol, Philosophenzimmer No. 76 (abgeb. Rom. Ikonogr. I. p. 68), auf Aristarch
beziehen, indem er annahm, dass unter der aufgemalten Tragödie in jener Stelle
des Etymologieunis eine tragische Maske verstanden sei.
Gegen die letztere Annahme Iässt sich nicht viel sagen, da die blosse Be-
zeichnung Tragödie in der That ein schwankender Begriff ist, für den es verschie-
dene Auslegungen geben kann. Eher scheint die Notiz selber apokryph, weil doch
Aristarch nicht einseitig und nicht einmal hauptsächlich die Tragödie behandelte,
die tragische Maske also kein sehr bezeichnendes Emblem für ihn war. Und nun gar
sollte ein so curioses Gemälde des als Künstler ganz unberühmten Dionysios für
die Folgezeit und zwar auch für die Plastik typisch geworden sein, und sollte man
sich noch 2% oder 3 Jahrhunderte später - denn die Büste wird nicht vor Hadrian
gesetzt werden dürfen - an den barocken Einfall eines Dilettanten für gebunden
erachtet haben! Das widerspricht aller Wahrscheinlichkeit. Es wird sich bei der
capitolinischen Büste, wie schon Gercke bemerkt3, und wie auch Heibig annimmt1,
um einen tragischenSchauspielerdes2.oder3.Jahrhunderts n.Chr. handeln. Die bei
einem derartigen Porträt auffallende Nacktheit der Brust aber ist vielleicht damit
zu erklären, dass man einen ruhigen Hintergrund für die Maske haben wollte.
Um für den Pseudo-Seneca in Vorschlag gebracht werden zu dürfen, wird
Aristarch trotz seinem Ansehen nicht allgemein genug berühmt gewesen sein.
Karneades
[Taf. XXIV]
Karneades aus Kyrene (geb. um 214, gest. 129 v. Chr.), Stifter
und Haupt der neueren Akademie und Teilnehmer an jener berühmt
gewordenen Gesandtschaft der Athener (155 v. Chr.), welche den
1 Etymol. p. 277. 53: 'EzsTvo; filv [AaChrcr,? ry 'AptSap/ou o; xA tov lauxou StSäa/.aXov
^wCpaor^a; hl nji ;rjDc! aü-oü T^v ToaycoSiav &i>-ypäo7]3e 3:a tg ä-o;ri0-!t£iv aüxov
~aaav Tr(v -paytoSiav.
2 Im Rostocker Lectionskatalog von 1888/89, Interpretationum hexas No. 4.
3 Jahrb. V. 1890. Anz. p. 56. i Führer I2. No. 502.