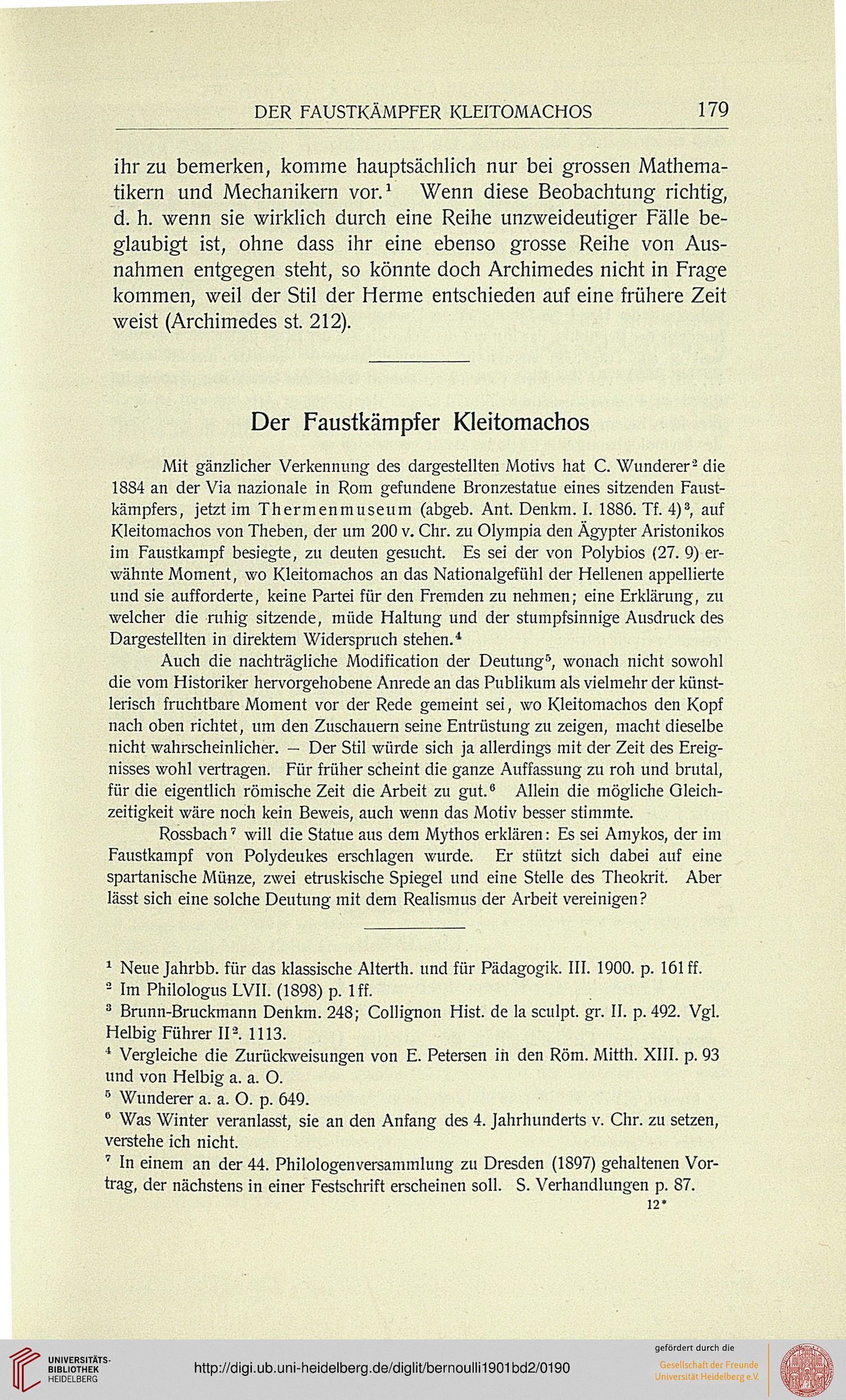DER FAUSTKÄMPFER KLEITOMACHOS 179
ihr zu bemerken, komme hauptsächlich nur bei grossen Mathema-
tikern und Mechanikern vor.1 Wenn diese Beobachtung richtig,
d. h. wenn sie wirklich durch eine Reihe unzweideutiger Fälle be-
glaubigt ist, ohne dass ihr eine ebenso grosse Reihe von Aus-
nahmen entgegen steht, so könnte doch Archimedes nicht in Frage
kommen, weil der Stil der Herme entschieden auf eine frühere Zeit
weist (Archimedes st. 212).
Der Faustkämpfer Kleitomachos
Mit gänzlicher Verkennung des dargestellten Motivs hat C. Wunderer- die
1884 an der Via nazionale in Rom gefundene Bronzestatue eines sitzenden Faust-
kämpfers, jetzt im Thermenmuseum (abgeb. Ant. Denkm. I. 1886. Tf. 4)3, auf
Kleitomachos von Theben, der um 200 v. Chr. zu Olympia den Ägypter Aristonikos
im Faustkampf besiegte, zu deuten gesucht. Es sei der von Polybios (27. 9) er-
wähnte Moment, wo Kleitomachos an das Nationalgefühl der Hellenen appellierte
und sie aufforderte, keine Partei für den Fremden zu nehmen; eine Erklärung, zu
welcher die ruhig sitzende, müde Haltung und der stumpfsinnige Ausdruck des
Dargestellten in direktem Widerspruch stehen.4
Auch die nachträgliche Modification der Deutung5, wonach nicht sowohl
die vom Historiker hervorgehobene Anrede an das Publikum als vielmehr der künst-
lerisch fruchtbare Moment vor der Rede gemeint sei, wo Kleitomachos den Kopf
nach oben richtet, um den Zuschauern seine Entrüstung zu zeigen, macht dieselbe
nicht wahrscheinlicher. — Der Stil würde sich ja allerdings mit der Zeit des Ereig-
nisses wohl vertragen. Für früher scheint die ganze Auffassung zu roh und brutal,
für die eigentlich römische Zeit die Arbeit zu gut.0 Allein die mögliche Oleich-
zeitigkeit wäre noch kein Beweis, auch wenn das Motiv besser stimmte.
Rossbach7 will die Statue aus dem Mythos erklären: Es sei Amykos, der im
Faustkampf von Polydeukes erschlagen wurde. Er stützt sich dabei auf eine
spartanische Münze, zwei etruskische Spiegel und eine Stelle des Theokrit. Aber
lässt sich eine solche Deutung mit dem Realismus der Arbeit vereinigen?
1 Neuejahrbb. für das klassische Alterth. und für Pädagogik. III. 1900. p. 161 ff.
2 Im Philologus LVII. (1898) p. lff.
3 Brunn-Bruckmann Denkm. 248; Collignon Hist. de la sculpt. gr. II. p. 492. Vgl.
Heibig Führer II*-. 1113.
* Vergleiche die Zurückweisungen von E. Petersen in den Rom. Mitth. XIII. p. 93
und von Heibig a. a. O.
8 Wunderer a. a. O. p. 649.
6 Was Winter veranlasst, sie an den Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. zu setzen,
verstehe ich nicht.
' In einem an der 44. Philologenversammlung zu Dresden (1897) gehaltenen Vor-
trag, der nächstens in einer Festschrift erscheinen soll. S. Verhandlungen p. 87.
12*
ihr zu bemerken, komme hauptsächlich nur bei grossen Mathema-
tikern und Mechanikern vor.1 Wenn diese Beobachtung richtig,
d. h. wenn sie wirklich durch eine Reihe unzweideutiger Fälle be-
glaubigt ist, ohne dass ihr eine ebenso grosse Reihe von Aus-
nahmen entgegen steht, so könnte doch Archimedes nicht in Frage
kommen, weil der Stil der Herme entschieden auf eine frühere Zeit
weist (Archimedes st. 212).
Der Faustkämpfer Kleitomachos
Mit gänzlicher Verkennung des dargestellten Motivs hat C. Wunderer- die
1884 an der Via nazionale in Rom gefundene Bronzestatue eines sitzenden Faust-
kämpfers, jetzt im Thermenmuseum (abgeb. Ant. Denkm. I. 1886. Tf. 4)3, auf
Kleitomachos von Theben, der um 200 v. Chr. zu Olympia den Ägypter Aristonikos
im Faustkampf besiegte, zu deuten gesucht. Es sei der von Polybios (27. 9) er-
wähnte Moment, wo Kleitomachos an das Nationalgefühl der Hellenen appellierte
und sie aufforderte, keine Partei für den Fremden zu nehmen; eine Erklärung, zu
welcher die ruhig sitzende, müde Haltung und der stumpfsinnige Ausdruck des
Dargestellten in direktem Widerspruch stehen.4
Auch die nachträgliche Modification der Deutung5, wonach nicht sowohl
die vom Historiker hervorgehobene Anrede an das Publikum als vielmehr der künst-
lerisch fruchtbare Moment vor der Rede gemeint sei, wo Kleitomachos den Kopf
nach oben richtet, um den Zuschauern seine Entrüstung zu zeigen, macht dieselbe
nicht wahrscheinlicher. — Der Stil würde sich ja allerdings mit der Zeit des Ereig-
nisses wohl vertragen. Für früher scheint die ganze Auffassung zu roh und brutal,
für die eigentlich römische Zeit die Arbeit zu gut.0 Allein die mögliche Oleich-
zeitigkeit wäre noch kein Beweis, auch wenn das Motiv besser stimmte.
Rossbach7 will die Statue aus dem Mythos erklären: Es sei Amykos, der im
Faustkampf von Polydeukes erschlagen wurde. Er stützt sich dabei auf eine
spartanische Münze, zwei etruskische Spiegel und eine Stelle des Theokrit. Aber
lässt sich eine solche Deutung mit dem Realismus der Arbeit vereinigen?
1 Neuejahrbb. für das klassische Alterth. und für Pädagogik. III. 1900. p. 161 ff.
2 Im Philologus LVII. (1898) p. lff.
3 Brunn-Bruckmann Denkm. 248; Collignon Hist. de la sculpt. gr. II. p. 492. Vgl.
Heibig Führer II*-. 1113.
* Vergleiche die Zurückweisungen von E. Petersen in den Rom. Mitth. XIII. p. 93
und von Heibig a. a. O.
8 Wunderer a. a. O. p. 649.
6 Was Winter veranlasst, sie an den Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. zu setzen,
verstehe ich nicht.
' In einem an der 44. Philologenversammlung zu Dresden (1897) gehaltenen Vor-
trag, der nächstens in einer Festschrift erscheinen soll. S. Verhandlungen p. 87.
12*