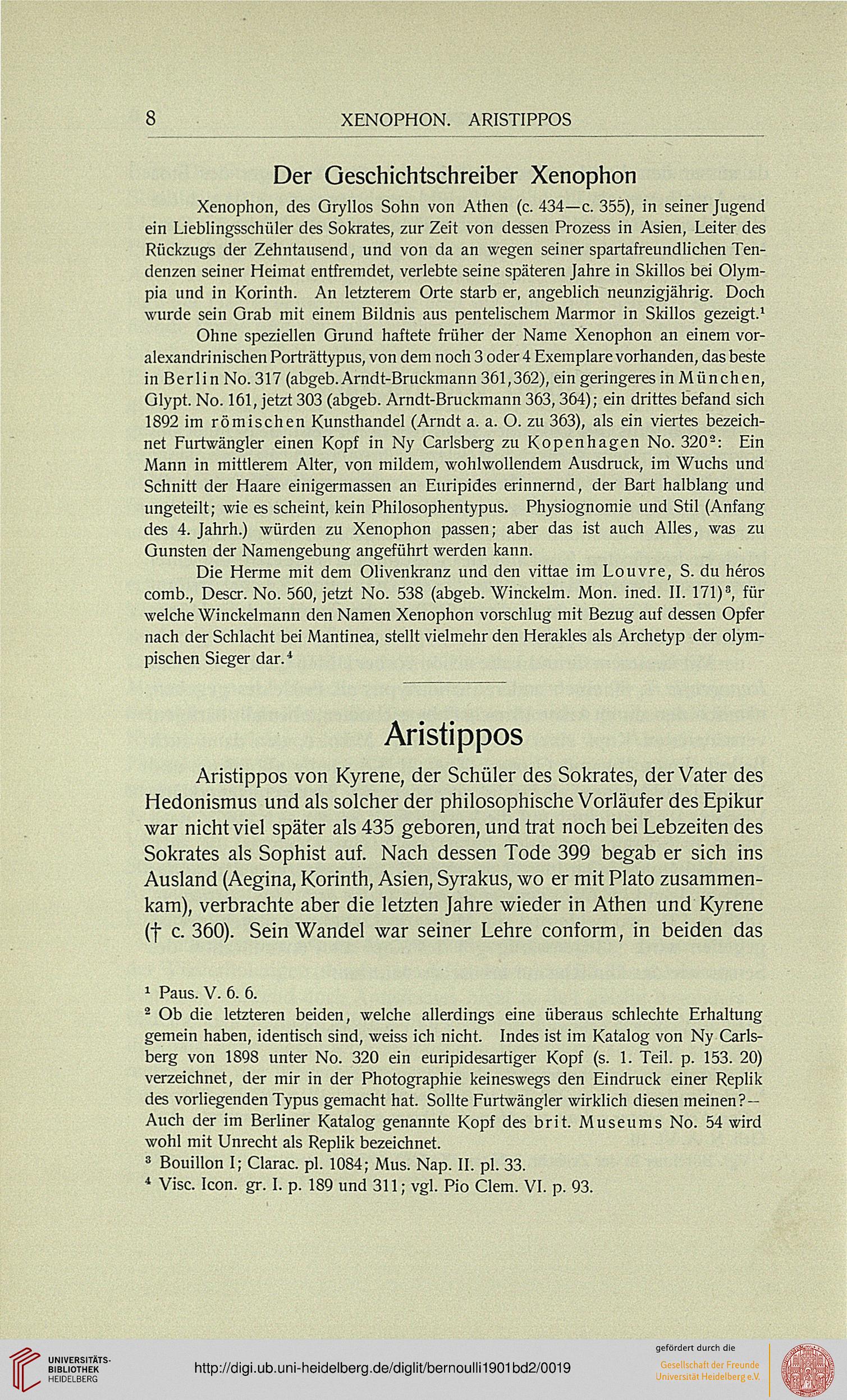8 XENOPHON. ARISTIPPOS
Der Geschichtschreiber Xenophon
Xenophon, des Gryllos Sohn von Athen (c. 434—c. 355), in seiner Jugend
ein Lieblingsschüler des Sokrates, zur Zeit von dessen Prozess in Asien, Leiter des
Rückzugs der Zehntausend, und von da an wegen seiner spartafreundlichen Ten-
denzen seiner Heimat entfremdet, verlebte seine späteren Jahre in Skillos bei Olym-
pia und in Korinth. An letzterem Orte starb er, angeblich neunzigjährig. Doch
wurde sein Grab mit einem Bildnis aus pentelischem Marmor in Skillos gezeigt.1
Ohne speziellen Grund haftete früher der Name Xenophon an einem vor-
alexandrinischen Porträttypus, von dem noch 3 oder 4 Exemplare vorhanden, das beste
in Berlin No. 317 (abgeb.Arndt-Bruckmann 361,362), ein geringeres in München,
Glypt. No. 161, jetzt 303 (abgeb. Arndt-Bruckmann 363, 364); ein drittes befand sich
1892 im römischen Kunsthandel (Arndt a. a. O. zu 363), als ein viertes bezeich-
net Furtwängler einen Kopf in Ny Carlsberg zu Kopenhagen No. 3202: Ein
Mann in mittlerem Alter, von mildem, wohlwollendem Ausdruck, im Wuchs und
Schnitt der Haare einigermassen an Euripides erinnernd, der Bart halblang und
ungeteilt; wie es scheint, kein Philosophentypus. Physiognomie und Stil (Anfang
des 4. Jahrh.) würden zu Xenophon passen; aber das ist auch Alles, was zu
Gunsten der Namengebung angeführt werden kann.
Die Herme mit dem Olivenkranz und den vittae im Louvre, S. du heros
comb., Descr. No. 560, jetzt No. 538 (abgeb. Winckelm. Mon. ined. II. 171)3, für
welche Winckelmann den Namen Xenophon vorschlug mit Bezug auf dessen Opfer
nach der Schlacht bei Mantinea, stellt vielmehr den Herakles als Archetyp der olym-
pischen Sieger dar.4
Aristippos
Aristippos von Kyrene, der Schüler des Sokrates, der Vater des
fiedonismus und als solcher der philosophische Vorläufer des Epikur
war nicht viel später als 435 geboren, und trat noch bei Lebzeiten des
Sokrates als Sophist auf. Nach dessen Tode 399 begab er sich ins
Ausland (Aegina, Korinth, Asien, Syrakus, wo er mit Plato zusammen-
kam), verbrachte aber die letzten Jahre wieder in Athen und Kyrene
(f c. 360). Sein Wandel war seiner Lehre conform, in beiden das
1 Paus. V. 6. 6.
- Ob die letzteren beiden, welche allerdings eine überaus schlechte Erhaltung
gemein haben, identisch sind, weiss ich nicht. Indes ist im Katalog von Ny Carls-
berg von 1898 unter No. 320 ein euripidesartiger Kopf (s. 1. Teil. p. 153. 20)
verzeichnet, der mir in der Photographie keineswegs den Eindruck einer Replik
des vorliegenden Typus gemacht hat. Sollte Furtwängler wirklich diesen meinen ?-
Auch der im Berliner Katalog genannte Kopf des brit. Museums No. 54 wird
wohl mit Unrecht als Replik bezeichnet.
3 Bouillon I; Clarac. pl. 1084; Mus. Nap. IL pl. 33.
4 Visc. Icon. gr. I. p. 189 und 311; vgl. Pio Clem. VI. p. 93.
Der Geschichtschreiber Xenophon
Xenophon, des Gryllos Sohn von Athen (c. 434—c. 355), in seiner Jugend
ein Lieblingsschüler des Sokrates, zur Zeit von dessen Prozess in Asien, Leiter des
Rückzugs der Zehntausend, und von da an wegen seiner spartafreundlichen Ten-
denzen seiner Heimat entfremdet, verlebte seine späteren Jahre in Skillos bei Olym-
pia und in Korinth. An letzterem Orte starb er, angeblich neunzigjährig. Doch
wurde sein Grab mit einem Bildnis aus pentelischem Marmor in Skillos gezeigt.1
Ohne speziellen Grund haftete früher der Name Xenophon an einem vor-
alexandrinischen Porträttypus, von dem noch 3 oder 4 Exemplare vorhanden, das beste
in Berlin No. 317 (abgeb.Arndt-Bruckmann 361,362), ein geringeres in München,
Glypt. No. 161, jetzt 303 (abgeb. Arndt-Bruckmann 363, 364); ein drittes befand sich
1892 im römischen Kunsthandel (Arndt a. a. O. zu 363), als ein viertes bezeich-
net Furtwängler einen Kopf in Ny Carlsberg zu Kopenhagen No. 3202: Ein
Mann in mittlerem Alter, von mildem, wohlwollendem Ausdruck, im Wuchs und
Schnitt der Haare einigermassen an Euripides erinnernd, der Bart halblang und
ungeteilt; wie es scheint, kein Philosophentypus. Physiognomie und Stil (Anfang
des 4. Jahrh.) würden zu Xenophon passen; aber das ist auch Alles, was zu
Gunsten der Namengebung angeführt werden kann.
Die Herme mit dem Olivenkranz und den vittae im Louvre, S. du heros
comb., Descr. No. 560, jetzt No. 538 (abgeb. Winckelm. Mon. ined. II. 171)3, für
welche Winckelmann den Namen Xenophon vorschlug mit Bezug auf dessen Opfer
nach der Schlacht bei Mantinea, stellt vielmehr den Herakles als Archetyp der olym-
pischen Sieger dar.4
Aristippos
Aristippos von Kyrene, der Schüler des Sokrates, der Vater des
fiedonismus und als solcher der philosophische Vorläufer des Epikur
war nicht viel später als 435 geboren, und trat noch bei Lebzeiten des
Sokrates als Sophist auf. Nach dessen Tode 399 begab er sich ins
Ausland (Aegina, Korinth, Asien, Syrakus, wo er mit Plato zusammen-
kam), verbrachte aber die letzten Jahre wieder in Athen und Kyrene
(f c. 360). Sein Wandel war seiner Lehre conform, in beiden das
1 Paus. V. 6. 6.
- Ob die letzteren beiden, welche allerdings eine überaus schlechte Erhaltung
gemein haben, identisch sind, weiss ich nicht. Indes ist im Katalog von Ny Carls-
berg von 1898 unter No. 320 ein euripidesartiger Kopf (s. 1. Teil. p. 153. 20)
verzeichnet, der mir in der Photographie keineswegs den Eindruck einer Replik
des vorliegenden Typus gemacht hat. Sollte Furtwängler wirklich diesen meinen ?-
Auch der im Berliner Katalog genannte Kopf des brit. Museums No. 54 wird
wohl mit Unrecht als Replik bezeichnet.
3 Bouillon I; Clarac. pl. 1084; Mus. Nap. IL pl. 33.
4 Visc. Icon. gr. I. p. 189 und 311; vgl. Pio Clem. VI. p. 93.