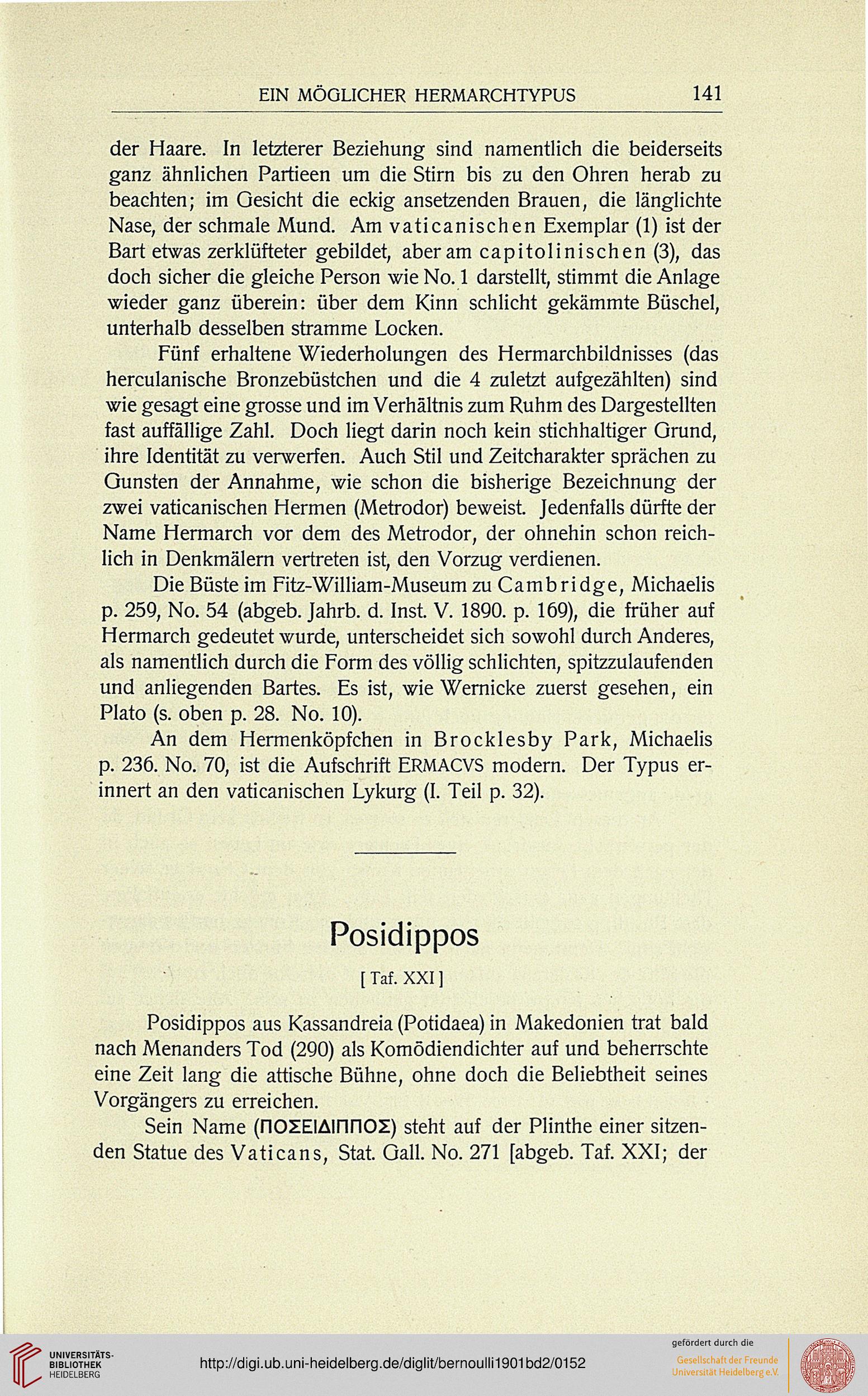EIN MÖGLICHER HERMARCHTYPUS 141
der Haare. In letzterer Beziehung sind namentlich die beiderseits
ganz ähnlichen Partieen um die Stirn bis zu den Ohren herab zu
beachten; im Gesicht die eckig ansetzenden Brauen, die länglichte
Nase, der schmale Mund. Am vaticanischen Exemplar (1) ist der
Bart etwas zerklüfteter gebildet, aber am capitolinischen (3), das
doch sicher die gleiche Person wie No. 1 darstellt, stimmt die Anlage
wieder ganz überein: über dem Kinn schlicht gekämmte Büschel,
unterhalb desselben stramme Locken.
Fünf erhaltene Wiederholungen des Hermarchbildnisses (das
herculanische Bronzebüstchen und die 4 zuletzt aufgezählten) sind
wie gesagt eine grosse und im Verhältnis zum Ruhm des Dargestellten
fast auffällige Zahl. Doch liegt darin noch kein stichhaltiger Grund,
ihre Identität zu verwerfen. Auch Stil und Zeitcharakter sprächen zu
Gunsten der Annahme, wie schon die bisherige Bezeichnung der
zwei vaticanischen Hermen (Metrodor) beweist. Jedenfalls dürfte der
Name Hermarch vor dem des Metrodor, der ohnehin schon reich-
lich in Denkmälern vertreten ist, den Vorzug verdienen.
Die Büste im Fitz-William-Museum zu Cambridge, Michaelis
p. 259, No. 54 (abgeb. Jahrb. d. Inst. V. 1890. p. 169), die früher auf
Hermarch gedeutet wurde, unterscheidet sich sowohl durch Anderes,
als namentlich durch die Form des völlig schlichten, spitzzulaufenden
und anliegenden Bartes. Es ist, wie Wernicke zuerst gesehen, ein
Plato (s. oben p. 28. No. 10).
An dem Hermenköpfchen in Brocklesby Park, Michaelis
p. 236. No. 70, ist die Aufschrift ERMACVS modern. Der Typus er-
innert an den vaticanischen Lykurg (I. Teil p. 32).
Posidippos
[ Taf. XXI ]
Posidippos aus Kassandreia (Potidaea) in Makedonien trat bald
nach Menanders Tod (290) als Komödiendichter auf und beherrschte
eine Zeit lang die attische Bühne, ohne doch die Beliebtheit seines
Vorgängers zu erreichen.
Sein Name (nOZEIAinnOZ) steht auf der Plinthe einer sitzen-
den Statue des Vaticans, Stat. Gall. No. 271 [abgeb. Taf. XXI; der
der Haare. In letzterer Beziehung sind namentlich die beiderseits
ganz ähnlichen Partieen um die Stirn bis zu den Ohren herab zu
beachten; im Gesicht die eckig ansetzenden Brauen, die länglichte
Nase, der schmale Mund. Am vaticanischen Exemplar (1) ist der
Bart etwas zerklüfteter gebildet, aber am capitolinischen (3), das
doch sicher die gleiche Person wie No. 1 darstellt, stimmt die Anlage
wieder ganz überein: über dem Kinn schlicht gekämmte Büschel,
unterhalb desselben stramme Locken.
Fünf erhaltene Wiederholungen des Hermarchbildnisses (das
herculanische Bronzebüstchen und die 4 zuletzt aufgezählten) sind
wie gesagt eine grosse und im Verhältnis zum Ruhm des Dargestellten
fast auffällige Zahl. Doch liegt darin noch kein stichhaltiger Grund,
ihre Identität zu verwerfen. Auch Stil und Zeitcharakter sprächen zu
Gunsten der Annahme, wie schon die bisherige Bezeichnung der
zwei vaticanischen Hermen (Metrodor) beweist. Jedenfalls dürfte der
Name Hermarch vor dem des Metrodor, der ohnehin schon reich-
lich in Denkmälern vertreten ist, den Vorzug verdienen.
Die Büste im Fitz-William-Museum zu Cambridge, Michaelis
p. 259, No. 54 (abgeb. Jahrb. d. Inst. V. 1890. p. 169), die früher auf
Hermarch gedeutet wurde, unterscheidet sich sowohl durch Anderes,
als namentlich durch die Form des völlig schlichten, spitzzulaufenden
und anliegenden Bartes. Es ist, wie Wernicke zuerst gesehen, ein
Plato (s. oben p. 28. No. 10).
An dem Hermenköpfchen in Brocklesby Park, Michaelis
p. 236. No. 70, ist die Aufschrift ERMACVS modern. Der Typus er-
innert an den vaticanischen Lykurg (I. Teil p. 32).
Posidippos
[ Taf. XXI ]
Posidippos aus Kassandreia (Potidaea) in Makedonien trat bald
nach Menanders Tod (290) als Komödiendichter auf und beherrschte
eine Zeit lang die attische Bühne, ohne doch die Beliebtheit seines
Vorgängers zu erreichen.
Sein Name (nOZEIAinnOZ) steht auf der Plinthe einer sitzen-
den Statue des Vaticans, Stat. Gall. No. 271 [abgeb. Taf. XXI; der