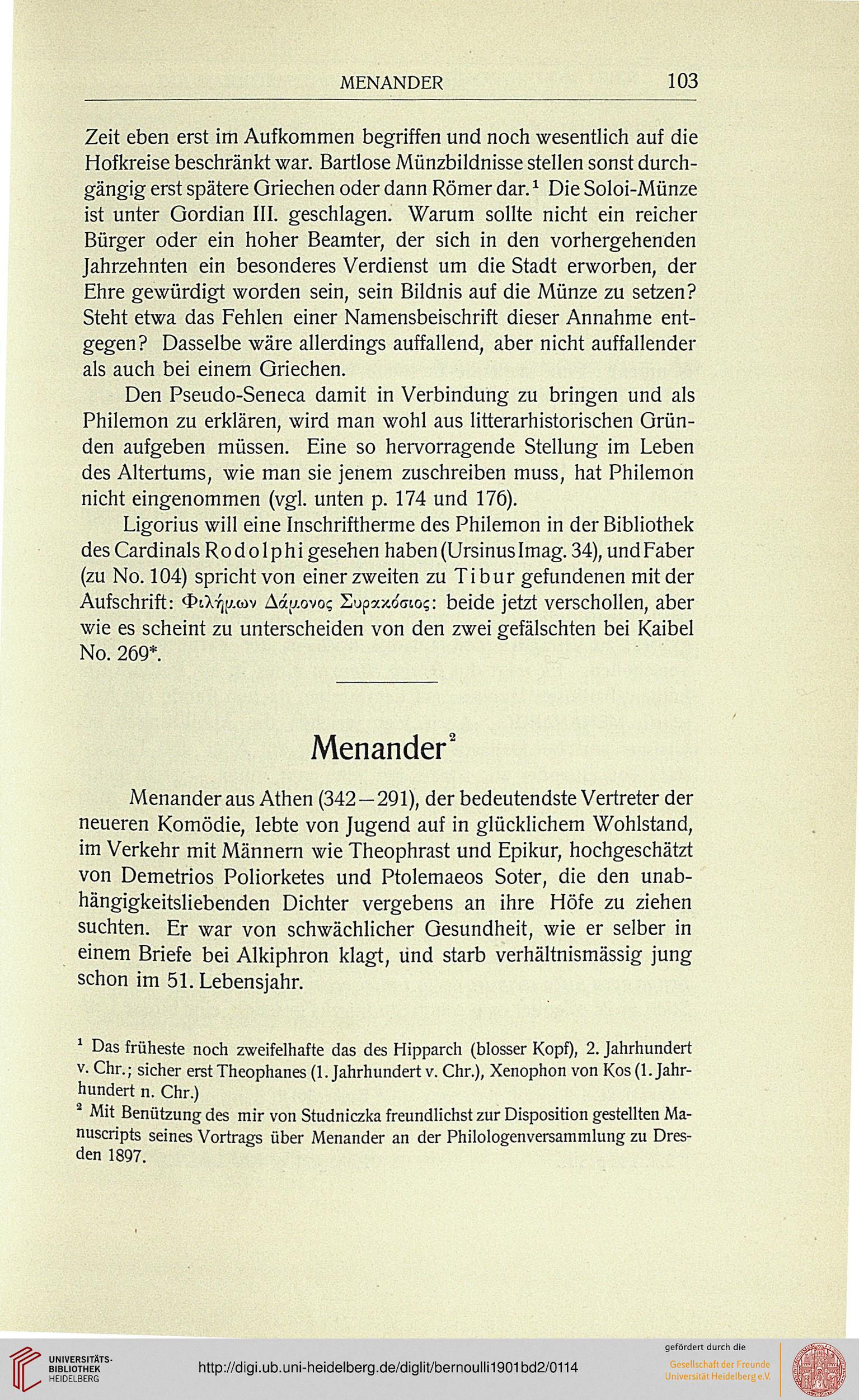MENANDER 103
Zeit eben erst im Aufkommen begriffen und noch wesentlich auf die
Hofkreise beschränkt war. Bartlose Münzbildnisse stellen sonst durch-
gängig erst spätere Griechen oder dann Römer dar.1 Die Soloi-Münze
ist unter Gordian III. geschlagen. Warum sollte nicht ein reicher
Bürger oder ein hoher Beamter, der sich in den vorhergehenden
Jahrzehnten ein besonderes Verdienst um die Stadt erworben, der
Ehre gewürdigt worden sein, sein Bildnis auf die Münze zu setzen?
Steht etwa das Fehlen einer Namensbeischrift dieser Annahme ent-
gegen? Dasselbe wäre allerdings auffallend, aber nicht auffallender
als auch bei einem Griechen.
Den Pseudo-Seneca damit in Verbindung zu bringen und als
Philemon zu erklären, wird man wohl aus litterarhistorischen Grün-
den aufgeben müssen. Eine so hervorragende Stellung im Leben
des Altertums, wie man sie jenem zuschreiben muss, hat Philemon
nicht eingenommen (vgl. unten p. 174 und 176).
Ligorius will eine Inschriftherme des Philemon in der Bibliothek
des Cardinais Rodolphi gesehen haben (Ursinuslmag. 34), und Faber
(zu No. 104) spricht von einer zweiten zu Tibur gefundenen mit der
Aufschrift: 'Pilr^.a^ Aa^ovo; Supax.oaio?: beide jetzt verschollen, aber
wie es scheint zu unterscheiden von den zwei gefälschten bei Kaibel
No. 269*.
Menander2
Menander aus Athen (342—291), der bedeutendste Vertreter der
neueren Komödie, lebte von Jugend auf in glücklichem Wohlstand,
im Verkehr mit Männern wie Theophrast und Epikur, hochgeschätzt
von Demetrios Poliorketes und Ptolemaeos Soter, die den unab-
hängigkeitsliebenden Dichter vergebens an ihre Höfe zu ziehen
suchten. Er war von schwächlicher Gesundheit, wie er selber in
einem Briefe bei Alkiphron klagt, und starb verhältnismässig jung
schon im 51. Lebensjahr.
1 Das früheste noch zweifelhafte das des Hipparch (blosser Kopf), 2. Jahrhundert
v. Chr.; sicher erst Theophanes (1. Jahrhundert v. Chr.), Xenophon von Kos (1. Jahr-
hundert n. Chr.)
Mit Benützung des mir von Studniczka freundlichst zur Disposition gestellten Ma-
nuscripts seines Vortrags über Menander an der Philologenversammlung zu Dres-
den 1897.
Zeit eben erst im Aufkommen begriffen und noch wesentlich auf die
Hofkreise beschränkt war. Bartlose Münzbildnisse stellen sonst durch-
gängig erst spätere Griechen oder dann Römer dar.1 Die Soloi-Münze
ist unter Gordian III. geschlagen. Warum sollte nicht ein reicher
Bürger oder ein hoher Beamter, der sich in den vorhergehenden
Jahrzehnten ein besonderes Verdienst um die Stadt erworben, der
Ehre gewürdigt worden sein, sein Bildnis auf die Münze zu setzen?
Steht etwa das Fehlen einer Namensbeischrift dieser Annahme ent-
gegen? Dasselbe wäre allerdings auffallend, aber nicht auffallender
als auch bei einem Griechen.
Den Pseudo-Seneca damit in Verbindung zu bringen und als
Philemon zu erklären, wird man wohl aus litterarhistorischen Grün-
den aufgeben müssen. Eine so hervorragende Stellung im Leben
des Altertums, wie man sie jenem zuschreiben muss, hat Philemon
nicht eingenommen (vgl. unten p. 174 und 176).
Ligorius will eine Inschriftherme des Philemon in der Bibliothek
des Cardinais Rodolphi gesehen haben (Ursinuslmag. 34), und Faber
(zu No. 104) spricht von einer zweiten zu Tibur gefundenen mit der
Aufschrift: 'Pilr^.a^ Aa^ovo; Supax.oaio?: beide jetzt verschollen, aber
wie es scheint zu unterscheiden von den zwei gefälschten bei Kaibel
No. 269*.
Menander2
Menander aus Athen (342—291), der bedeutendste Vertreter der
neueren Komödie, lebte von Jugend auf in glücklichem Wohlstand,
im Verkehr mit Männern wie Theophrast und Epikur, hochgeschätzt
von Demetrios Poliorketes und Ptolemaeos Soter, die den unab-
hängigkeitsliebenden Dichter vergebens an ihre Höfe zu ziehen
suchten. Er war von schwächlicher Gesundheit, wie er selber in
einem Briefe bei Alkiphron klagt, und starb verhältnismässig jung
schon im 51. Lebensjahr.
1 Das früheste noch zweifelhafte das des Hipparch (blosser Kopf), 2. Jahrhundert
v. Chr.; sicher erst Theophanes (1. Jahrhundert v. Chr.), Xenophon von Kos (1. Jahr-
hundert n. Chr.)
Mit Benützung des mir von Studniczka freundlichst zur Disposition gestellten Ma-
nuscripts seines Vortrags über Menander an der Philologenversammlung zu Dres-
den 1897.