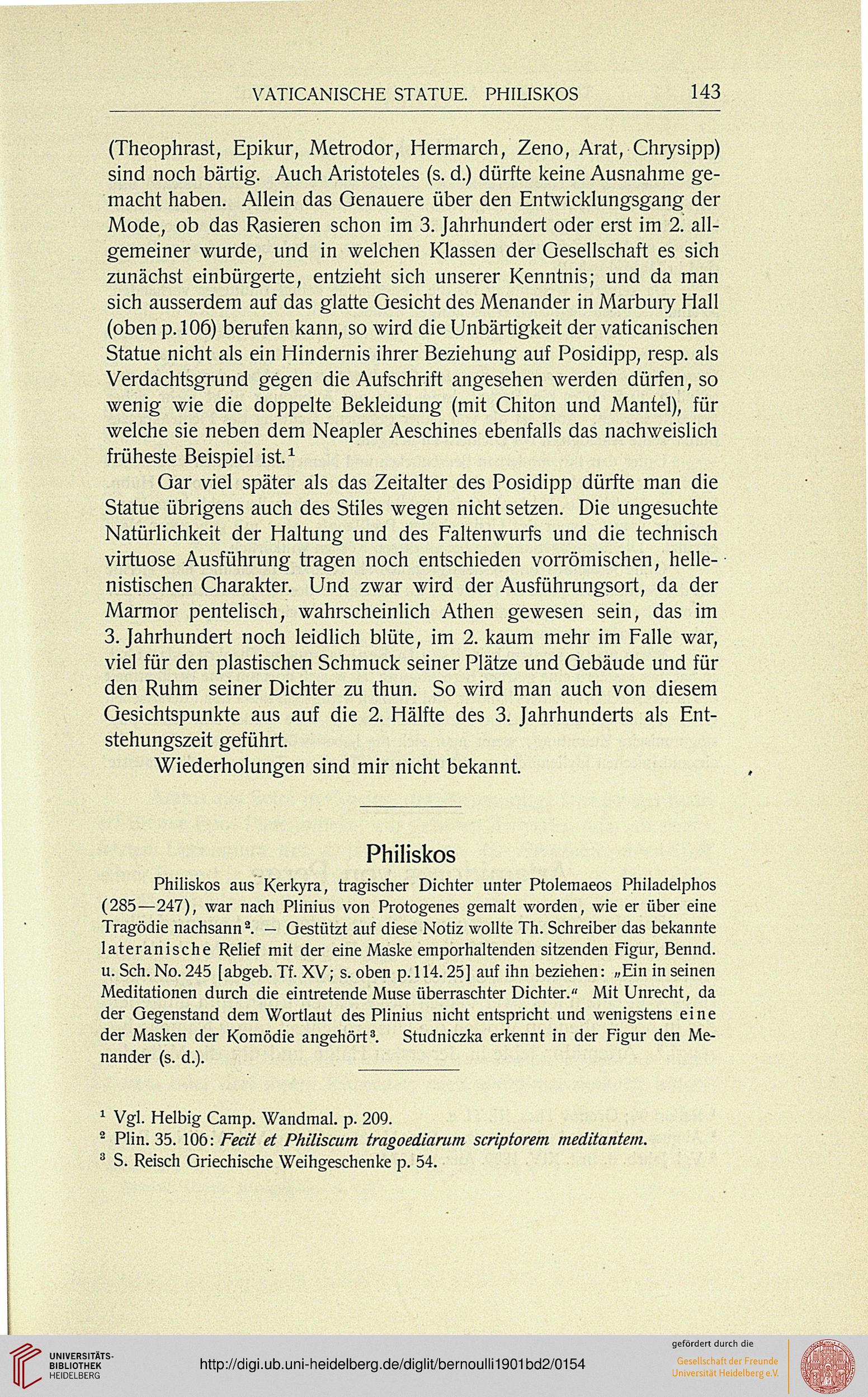VATICANISCHE STATUE. PHILISKOS 143
(Theophrast, Epikur, Metrodor, Hermarch, Zeno, Arat, Chrysipp)
sind noch bärtig. Auch Aristoteles (s. d.) dürfte keine Ausnahme ge-
macht haben. Allein das Genauere über den Entwicklungsgang der
Mode, ob das Rasieren schon im 3. Jahrhundert oder erst im 2. all-
gemeiner wurde, und in welchen Klassen der Gesellschaft es sich
zunächst einbürgerte, entzieht sich unserer Kenntnis; und da man
sich ausserdem auf das glatte Gesicht des Menander in Marbury Hall
(oben p. 106) berufen kann, so wird die Unbärtigkeit der vaticanischen
Statue nicht als ein Hindernis ihrer Beziehung auf Posidipp, resp. als
Verdachtsgrund gegen die Aufschrift angesehen werden dürfen, so
wenig wie die doppelte Bekleidung (mit Chiton und Mantel), für
welche sie neben dem Neapler Aeschines ebenfalls das nachweislich
früheste Beispiel ist.1
Gar viel später als das Zeitalter des Posidipp dürfte man die
Statue übrigens auch des Stiles wegen nicht setzen. Die ungesuchte
Natürlichkeit der Haltung und des Faltenwurfs und die technisch
virtuose Ausführung tragen noch entschieden vorrömischen, helle-
nistischen Charakter. Und zwar wird der Ausführungsort, da der
Marmor pentelisch, wahrscheinlich Athen gewesen sein, das im
3. Jahrhundert noch leidlich blute, im 2. kaum mehr im Falle war,
viel für den plastischen Schmuck seiner Plätze und Gebäude und für
den Ruhm seiner Dichter zu thun. So wird man auch von diesem
Gesichtspunkte aus auf die 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts als Ent-
stehungszeit geführt.
Wiederholungen sind mir nicht bekannt.
Philiskos
Philiskos aus Kerkyra, tragischer Dichter unter Ptolemaeos Philadelphos
(285—247), war nach Plinius von Protogenes gemalt worden, wie er über eine
Tragödie nachsann2. — Gestützt auf diese Notiz wollte Th. Schreiber das bekannte
lateranische Relief mit der eine Maske emporhaltenden sitzenden Figur, Bennd.
u. Seh. No. 245 [abgeb. Tf. XV; s. oben p. 114.25] auf ihn beziehen: „Ein in seinen
Meditationen durch die eintretende Muse überraschter Dichter." Mit Unrecht, da
der Gegenstand dem Wortlaut des Plinius nicht entspricht und wenigstens eine
der Masken der Komödie angehört3. Studniczka erkennt in der Figur den Me-
nander (s. d.).
1 Vgl. Heibig Camp. Wandmal. p. 209.
2 Plin. 35. 106: Fecit et Philiscum tragoediarum scriptoretn meditantem.
3 S. Reisch Griechische Weihgeschenke p. 54.
(Theophrast, Epikur, Metrodor, Hermarch, Zeno, Arat, Chrysipp)
sind noch bärtig. Auch Aristoteles (s. d.) dürfte keine Ausnahme ge-
macht haben. Allein das Genauere über den Entwicklungsgang der
Mode, ob das Rasieren schon im 3. Jahrhundert oder erst im 2. all-
gemeiner wurde, und in welchen Klassen der Gesellschaft es sich
zunächst einbürgerte, entzieht sich unserer Kenntnis; und da man
sich ausserdem auf das glatte Gesicht des Menander in Marbury Hall
(oben p. 106) berufen kann, so wird die Unbärtigkeit der vaticanischen
Statue nicht als ein Hindernis ihrer Beziehung auf Posidipp, resp. als
Verdachtsgrund gegen die Aufschrift angesehen werden dürfen, so
wenig wie die doppelte Bekleidung (mit Chiton und Mantel), für
welche sie neben dem Neapler Aeschines ebenfalls das nachweislich
früheste Beispiel ist.1
Gar viel später als das Zeitalter des Posidipp dürfte man die
Statue übrigens auch des Stiles wegen nicht setzen. Die ungesuchte
Natürlichkeit der Haltung und des Faltenwurfs und die technisch
virtuose Ausführung tragen noch entschieden vorrömischen, helle-
nistischen Charakter. Und zwar wird der Ausführungsort, da der
Marmor pentelisch, wahrscheinlich Athen gewesen sein, das im
3. Jahrhundert noch leidlich blute, im 2. kaum mehr im Falle war,
viel für den plastischen Schmuck seiner Plätze und Gebäude und für
den Ruhm seiner Dichter zu thun. So wird man auch von diesem
Gesichtspunkte aus auf die 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts als Ent-
stehungszeit geführt.
Wiederholungen sind mir nicht bekannt.
Philiskos
Philiskos aus Kerkyra, tragischer Dichter unter Ptolemaeos Philadelphos
(285—247), war nach Plinius von Protogenes gemalt worden, wie er über eine
Tragödie nachsann2. — Gestützt auf diese Notiz wollte Th. Schreiber das bekannte
lateranische Relief mit der eine Maske emporhaltenden sitzenden Figur, Bennd.
u. Seh. No. 245 [abgeb. Tf. XV; s. oben p. 114.25] auf ihn beziehen: „Ein in seinen
Meditationen durch die eintretende Muse überraschter Dichter." Mit Unrecht, da
der Gegenstand dem Wortlaut des Plinius nicht entspricht und wenigstens eine
der Masken der Komödie angehört3. Studniczka erkennt in der Figur den Me-
nander (s. d.).
1 Vgl. Heibig Camp. Wandmal. p. 209.
2 Plin. 35. 106: Fecit et Philiscum tragoediarum scriptoretn meditantem.
3 S. Reisch Griechische Weihgeschenke p. 54.