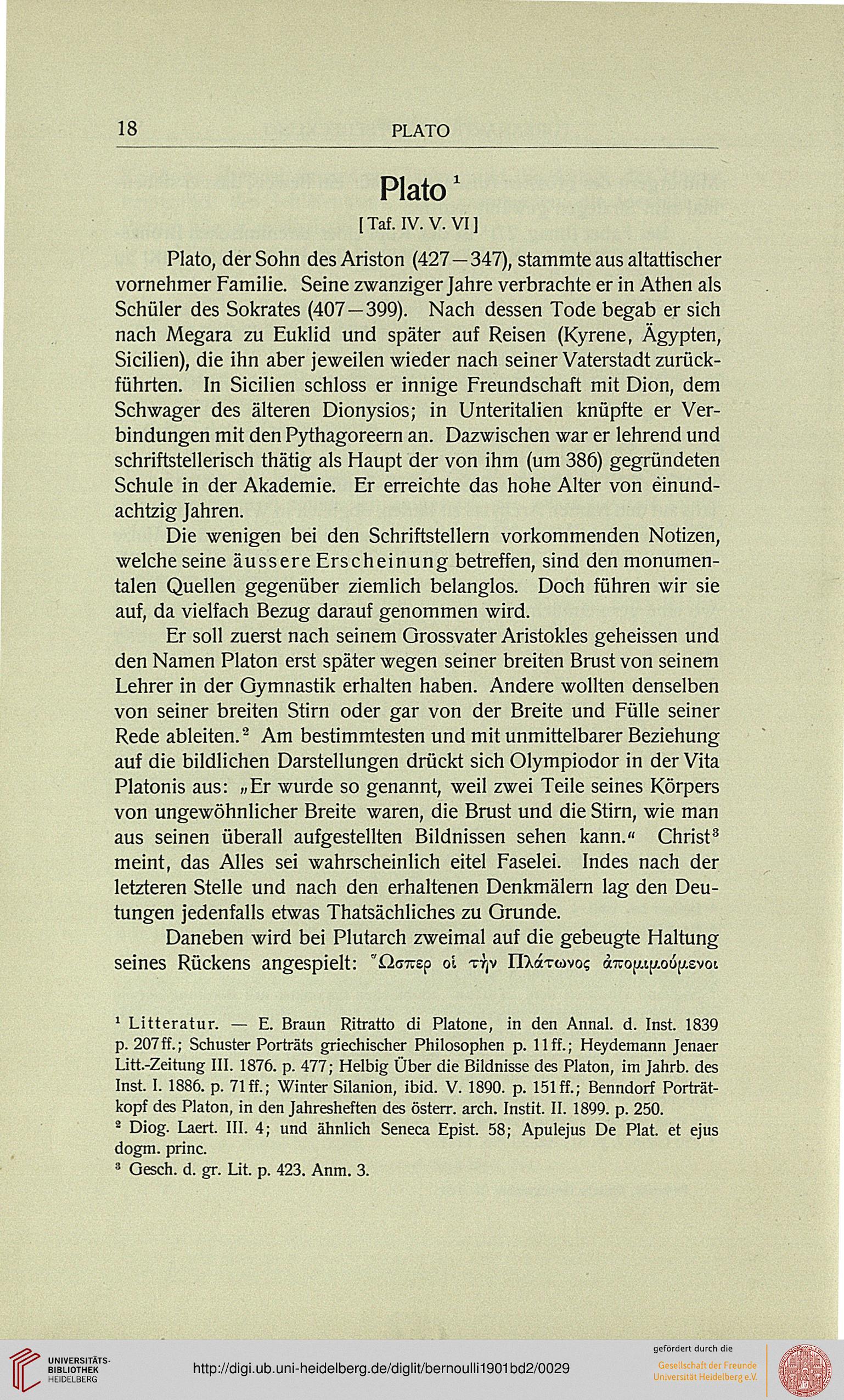18 PLATO
Plato *
[Taf. IV. V. VI]
Plato, der Sohn des Ariston (427—347), stammte aus altattischer
vornehmer Familie. Seine zwanziger Jahre verbrachte er in Athen als
Schüler des Sokrates (407—399). Nach dessen Tode begab er sich
nach Megara zu Euklid und später auf Reisen (Kyrene, Ägypten,
Sicilien), die ihn aber jeweilen wieder nach seiner Vaterstadt zurück-
führten. In Sicilien schloss er innige Freundschaft mit Dion, dem
Schwager des älteren Dionysios; in Unteritalien knüpfte er Ver-
bindungen mit den Pythagoreern an. Dazwischen war er lehrend und
schriftstellerisch thätig als Haupt der von ihm (um 386) gegründeten
Schule in der Akademie. Er erreichte das hohe Alter von einund-
achtzig Jahren.
Die wenigen bei den Schriftstellern vorkommenden Notizen,
welche seine äussere Erscheinung betreffen, sind den monumen-
talen Quellen gegenüber ziemlich belanglos. Doch führen wir sie
auf, da vielfach Bezug darauf genommen wird.
Er soll zuerst nach seinem Grossvater Aristokles geheissen und
den Namen Piaton erst später wegen seiner breiten Brust von seinem
Lehrer in der Gymnastik erhalten haben. Andere wollten denselben
von seiner breiten Stirn oder gar von der Breite und Fülle seiner
Rede ableiten.2 Am bestimmtesten und mit unmittelbarer Beziehung
auf die bildlichen Darstellungen drückt sich Olympiodor in der Vita
Piatonis aus: «Er wurde so genannt, weil zwei Teile seines Körpers
von ungewöhnlicher Breite waren, die Brust und die Stirn, wie man
aus seinen überall aufgestellten Bildnissen sehen kann." Christ3
meint, das Alles sei wahrscheinlich eitel Faselei. Indes nach der
letzteren Stelle und nach den erhaltenen Denkmälern lag den Deu-
tungen jedenfalls etwas Thatsächliches zu Grunde.
Daneben wird bei Plutarch zweimal auf die gebeugte Haltung
seines Rückens angespielt: "Clans? oi -rijv UXaTtövo; <xxo(«(y.otf[/.Evoi
1 Litteratur. — E. Braun Ritratto di Piatone, in den Annal. d. Inst. 1839
p. 207ff.; Schuster Porträts griechischer Philosophen p. 11 ff.; Heydemann Jenaer
Litt.-Zeitung III. 1876. p. 477; Heibig Über die Bildnisse des Piaton, im Jahrb. des
Inst. I. 1886. p. 71 ff.; Winter Silanion, ibid. V. 1890. p. 151ff.; Benndorf Porträt-
kopf des Piaton, in den Jahresheften des österr. arch. Instit. II. 1899. p. 250.
2 Diog. Laert. III. 4; und ähnlich Seneca Epist. 58; Apulejus De Plat. et ejus
dogm. princ.
3 Gesch. d. gr. Lit. p. 423. Anm. 3.
Plato *
[Taf. IV. V. VI]
Plato, der Sohn des Ariston (427—347), stammte aus altattischer
vornehmer Familie. Seine zwanziger Jahre verbrachte er in Athen als
Schüler des Sokrates (407—399). Nach dessen Tode begab er sich
nach Megara zu Euklid und später auf Reisen (Kyrene, Ägypten,
Sicilien), die ihn aber jeweilen wieder nach seiner Vaterstadt zurück-
führten. In Sicilien schloss er innige Freundschaft mit Dion, dem
Schwager des älteren Dionysios; in Unteritalien knüpfte er Ver-
bindungen mit den Pythagoreern an. Dazwischen war er lehrend und
schriftstellerisch thätig als Haupt der von ihm (um 386) gegründeten
Schule in der Akademie. Er erreichte das hohe Alter von einund-
achtzig Jahren.
Die wenigen bei den Schriftstellern vorkommenden Notizen,
welche seine äussere Erscheinung betreffen, sind den monumen-
talen Quellen gegenüber ziemlich belanglos. Doch führen wir sie
auf, da vielfach Bezug darauf genommen wird.
Er soll zuerst nach seinem Grossvater Aristokles geheissen und
den Namen Piaton erst später wegen seiner breiten Brust von seinem
Lehrer in der Gymnastik erhalten haben. Andere wollten denselben
von seiner breiten Stirn oder gar von der Breite und Fülle seiner
Rede ableiten.2 Am bestimmtesten und mit unmittelbarer Beziehung
auf die bildlichen Darstellungen drückt sich Olympiodor in der Vita
Piatonis aus: «Er wurde so genannt, weil zwei Teile seines Körpers
von ungewöhnlicher Breite waren, die Brust und die Stirn, wie man
aus seinen überall aufgestellten Bildnissen sehen kann." Christ3
meint, das Alles sei wahrscheinlich eitel Faselei. Indes nach der
letzteren Stelle und nach den erhaltenen Denkmälern lag den Deu-
tungen jedenfalls etwas Thatsächliches zu Grunde.
Daneben wird bei Plutarch zweimal auf die gebeugte Haltung
seines Rückens angespielt: "Clans? oi -rijv UXaTtövo; <xxo(«(y.otf[/.Evoi
1 Litteratur. — E. Braun Ritratto di Piatone, in den Annal. d. Inst. 1839
p. 207ff.; Schuster Porträts griechischer Philosophen p. 11 ff.; Heydemann Jenaer
Litt.-Zeitung III. 1876. p. 477; Heibig Über die Bildnisse des Piaton, im Jahrb. des
Inst. I. 1886. p. 71 ff.; Winter Silanion, ibid. V. 1890. p. 151ff.; Benndorf Porträt-
kopf des Piaton, in den Jahresheften des österr. arch. Instit. II. 1899. p. 250.
2 Diog. Laert. III. 4; und ähnlich Seneca Epist. 58; Apulejus De Plat. et ejus
dogm. princ.
3 Gesch. d. gr. Lit. p. 423. Anm. 3.