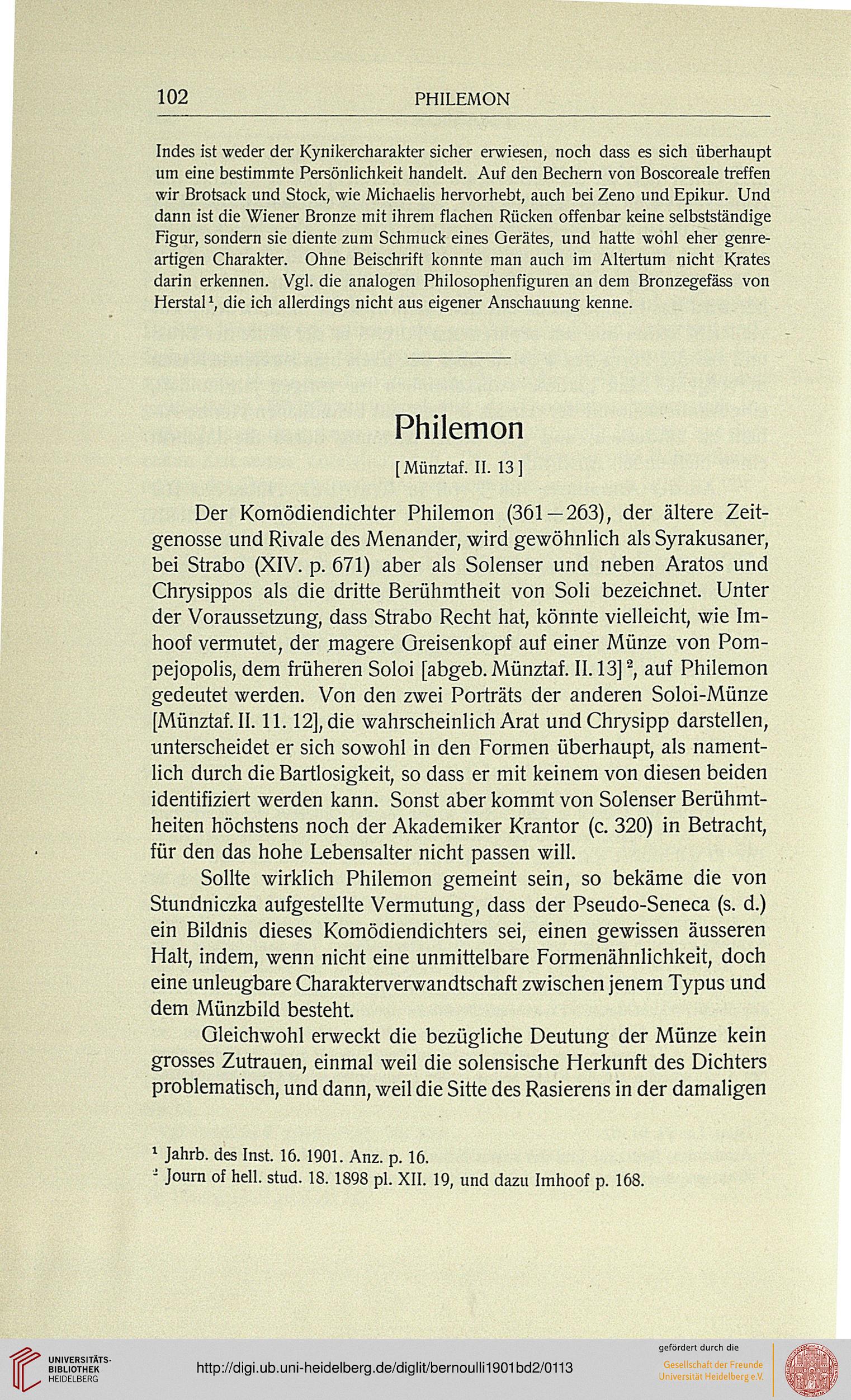102 PHILEMON
Indes ist weder der Kynikercharakter sicher erwiesen, noch dass es sich überhaupt
um eine bestimmte Persönlichkeit handelt. Auf den Bechern von Boscoreale treffen
wir Brotsack und Stock, wie Michaelis hervorhebt, auch bei Zeno und Epikur. Und
dann ist die Wiener Bronze mit ihrem flachen Rücken offenbar keine selbstständige
Figur, sondern sie diente zum Schmuck eines Gerätes, und hatte wohl eher genre-
artigen Charakter. Ohne Beischrift konnte man auch im Altertum nicht Krates
darin erkennen. Vgl. die analogen Philosophenfiguren an dem Bronzegefäss von
Herstall, die ich allerdings nicht aus eigener Anschauung kenne.
Philemon
f Münztaf. II. 13]
Der Komödiendichter Philemon (361 — 263), der ältere Zeit-
genosse und Rivale des Menander, wird gewöhnlich als Syrakusaner,
bei Strabo (XIV. p. 671) aber als Solenser und neben Aratos und
Chrysippos als die dritte Berühmtheit von Soli bezeichnet. Unter
der Voraussetzung, dass Strabo Recht hat, könnte vielleicht, wie Im-
hoof vermutet, der magere Qreisenkopf auf einer Münze von Pom-
pejopolis, dem früheren Soloi [abgeb. Münztaf. II. 13]2, auf Philemon
gedeutet werden. Von den zwei Porträts der anderen Soloi-Münze
[Münztaf. II. 11.12], die wahrscheinlich Arat undChrysipp darstellen,
unterscheidet er sich sowohl in den Formen überhaupt, als nament-
lich durch die Bartlosigkeit, so dass er mit keinem von diesen beiden
identifiziert werden kann. Sonst aber kommt von Solenser Berühmt-
heiten höchstens noch der Akademiker Krantor (c. 320) in Betracht,
für den das hohe Lebensalter nicht passen will.
Sollte wirklich Philemon gemeint sein, so bekäme die von
Stundniczka aufgestellte Vermutung, dass der Pseudo-Seneca (s. d.)
ein Bildnis dieses Komödiendichters sei, einen gewissen äusseren
Halt, indem, wenn nicht eine unmittelbare Formenähnlichkeit, doch
eine unleugbare Charakterverwandtschaft zwischen jenem Typus und
dem Münzbild besteht.
Gleichwohl erweckt die bezügliche Deutung der Münze kein
grosses Zutrauen, einmal weil die solensische Herkunft des Dichters
problematisch, und dann, weil die Sitte des Rasierens in der damaligen
1 Jahrb. des Inst. 16. 1901. Anz. p. 16.
- Journ of hell. stud. 18.1898 pl. XII. 19, und dazu Imhoof p. 168.
Indes ist weder der Kynikercharakter sicher erwiesen, noch dass es sich überhaupt
um eine bestimmte Persönlichkeit handelt. Auf den Bechern von Boscoreale treffen
wir Brotsack und Stock, wie Michaelis hervorhebt, auch bei Zeno und Epikur. Und
dann ist die Wiener Bronze mit ihrem flachen Rücken offenbar keine selbstständige
Figur, sondern sie diente zum Schmuck eines Gerätes, und hatte wohl eher genre-
artigen Charakter. Ohne Beischrift konnte man auch im Altertum nicht Krates
darin erkennen. Vgl. die analogen Philosophenfiguren an dem Bronzegefäss von
Herstall, die ich allerdings nicht aus eigener Anschauung kenne.
Philemon
f Münztaf. II. 13]
Der Komödiendichter Philemon (361 — 263), der ältere Zeit-
genosse und Rivale des Menander, wird gewöhnlich als Syrakusaner,
bei Strabo (XIV. p. 671) aber als Solenser und neben Aratos und
Chrysippos als die dritte Berühmtheit von Soli bezeichnet. Unter
der Voraussetzung, dass Strabo Recht hat, könnte vielleicht, wie Im-
hoof vermutet, der magere Qreisenkopf auf einer Münze von Pom-
pejopolis, dem früheren Soloi [abgeb. Münztaf. II. 13]2, auf Philemon
gedeutet werden. Von den zwei Porträts der anderen Soloi-Münze
[Münztaf. II. 11.12], die wahrscheinlich Arat undChrysipp darstellen,
unterscheidet er sich sowohl in den Formen überhaupt, als nament-
lich durch die Bartlosigkeit, so dass er mit keinem von diesen beiden
identifiziert werden kann. Sonst aber kommt von Solenser Berühmt-
heiten höchstens noch der Akademiker Krantor (c. 320) in Betracht,
für den das hohe Lebensalter nicht passen will.
Sollte wirklich Philemon gemeint sein, so bekäme die von
Stundniczka aufgestellte Vermutung, dass der Pseudo-Seneca (s. d.)
ein Bildnis dieses Komödiendichters sei, einen gewissen äusseren
Halt, indem, wenn nicht eine unmittelbare Formenähnlichkeit, doch
eine unleugbare Charakterverwandtschaft zwischen jenem Typus und
dem Münzbild besteht.
Gleichwohl erweckt die bezügliche Deutung der Münze kein
grosses Zutrauen, einmal weil die solensische Herkunft des Dichters
problematisch, und dann, weil die Sitte des Rasierens in der damaligen
1 Jahrb. des Inst. 16. 1901. Anz. p. 16.
- Journ of hell. stud. 18.1898 pl. XII. 19, und dazu Imhoof p. 168.