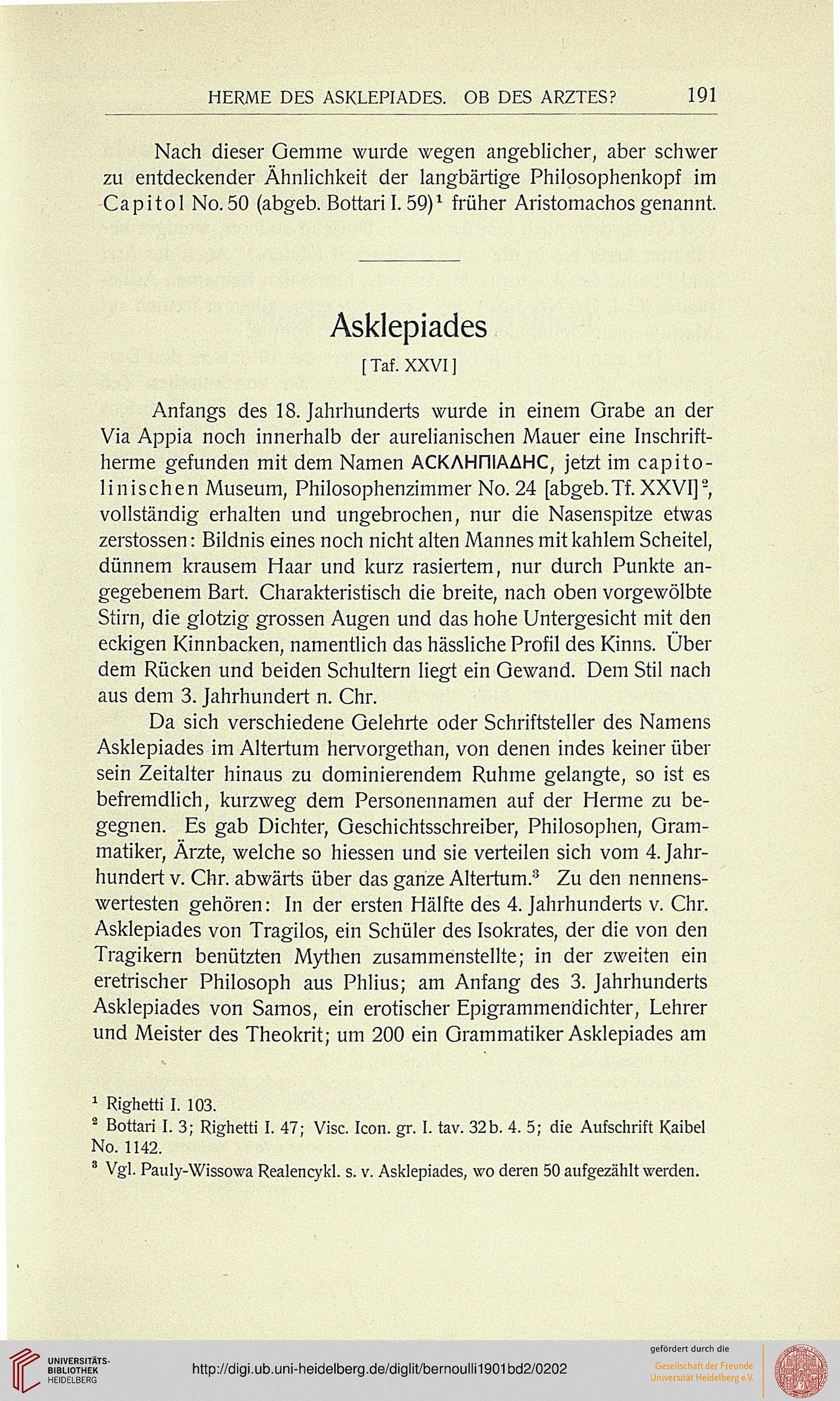HERME DES ASKLEPIADES. OB DES ARZTES? 191
Nach dieser Gemme wurde wegen angeblicher, aber schwer
zu entdeckender Ähnlichkeit der langbärtige Philosophenkopf im
Capitol No.50 (abgeb.BottariI.5Q)1 früher Aristomachosgenannt.
Asklepiades
[Taf. XXVI]
Anfangs des 18. Jahrhunderts wurde in einem Grabe an der
Via Appia noch innerhalb der aurelianischen Mauer eine Inschrift-
herme gefunden mit dem Namen ACKAHniAAHC, jetzt im capito-
linischen Museum, Philosophenzimmer No. 24 [abgeb.Tf. XXVI]2,
vollständig erhalten und ungebrochen, nur die Nasenspitze etwas
zerstossen: Bildnis eines noch nicht alten Mannes mit kahlem Scheitel,
dünnem krausem Haar und kurz rasiertem, nur durch Punkte an-
gegebenem Bart. Charakteristisch die breite, nach oben vorgewölbte
Stirn, die glotzig grossen Augen und das hohe Untergesicht mit den
eckigen Kinnbacken, namentlich das hässliche Profil des Kinns. Über
dem Rücken und beiden Schultern liegt ein Gewand. Dem Stil nach
aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.
Da sich verschiedene Gelehrte oder Schriftsteller des Namens
Asklepiades im Altertum hervorgethan, von denen indes keiner über
sein Zeitalter hinaus zu dominierendem Ruhme gelangte, so ist es
befremdlich, kurzweg dem Personennamen auf der Herme zu be-
gegnen. Es gab Dichter, Geschichtsschreiber, Philosophen, Gram-
matiker, Ärzte, welche so hiessen und sie verteilen sich vom 4. Jahr-
hundert v. Chr. abwärts über das ganze Altertum.3 Zu den nennens-
wertesten gehören: In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr.
Asklepiades von Tragilos, ein Schüler des Isokrates, der die von den
Tragikern benützten Mythen zusammenstellte; in der zweiten ein
eretrischer Philosoph aus Phlius; am Anfang des 3. Jahrhunderts
Asklepiades von Samos, ein erotischer Epigrammendichter, Lehrer
und Meister des Theokrit; um 200 ein Grammatiker Asklepiades am
1 Righetti I. 103.
2 Bottari I. 3; Righetti I. 47; Visc. Icon. gr. I. tav. 32 b. 4. 5; die Aufschrift Kaibel
No. 1142.
3 Vgl. Pauly-Wissowa Realencykl. s. v. Asklepiades, wo deren 50 aufgezählt werden.
Nach dieser Gemme wurde wegen angeblicher, aber schwer
zu entdeckender Ähnlichkeit der langbärtige Philosophenkopf im
Capitol No.50 (abgeb.BottariI.5Q)1 früher Aristomachosgenannt.
Asklepiades
[Taf. XXVI]
Anfangs des 18. Jahrhunderts wurde in einem Grabe an der
Via Appia noch innerhalb der aurelianischen Mauer eine Inschrift-
herme gefunden mit dem Namen ACKAHniAAHC, jetzt im capito-
linischen Museum, Philosophenzimmer No. 24 [abgeb.Tf. XXVI]2,
vollständig erhalten und ungebrochen, nur die Nasenspitze etwas
zerstossen: Bildnis eines noch nicht alten Mannes mit kahlem Scheitel,
dünnem krausem Haar und kurz rasiertem, nur durch Punkte an-
gegebenem Bart. Charakteristisch die breite, nach oben vorgewölbte
Stirn, die glotzig grossen Augen und das hohe Untergesicht mit den
eckigen Kinnbacken, namentlich das hässliche Profil des Kinns. Über
dem Rücken und beiden Schultern liegt ein Gewand. Dem Stil nach
aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.
Da sich verschiedene Gelehrte oder Schriftsteller des Namens
Asklepiades im Altertum hervorgethan, von denen indes keiner über
sein Zeitalter hinaus zu dominierendem Ruhme gelangte, so ist es
befremdlich, kurzweg dem Personennamen auf der Herme zu be-
gegnen. Es gab Dichter, Geschichtsschreiber, Philosophen, Gram-
matiker, Ärzte, welche so hiessen und sie verteilen sich vom 4. Jahr-
hundert v. Chr. abwärts über das ganze Altertum.3 Zu den nennens-
wertesten gehören: In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr.
Asklepiades von Tragilos, ein Schüler des Isokrates, der die von den
Tragikern benützten Mythen zusammenstellte; in der zweiten ein
eretrischer Philosoph aus Phlius; am Anfang des 3. Jahrhunderts
Asklepiades von Samos, ein erotischer Epigrammendichter, Lehrer
und Meister des Theokrit; um 200 ein Grammatiker Asklepiades am
1 Righetti I. 103.
2 Bottari I. 3; Righetti I. 47; Visc. Icon. gr. I. tav. 32 b. 4. 5; die Aufschrift Kaibel
No. 1142.
3 Vgl. Pauly-Wissowa Realencykl. s. v. Asklepiades, wo deren 50 aufgezählt werden.