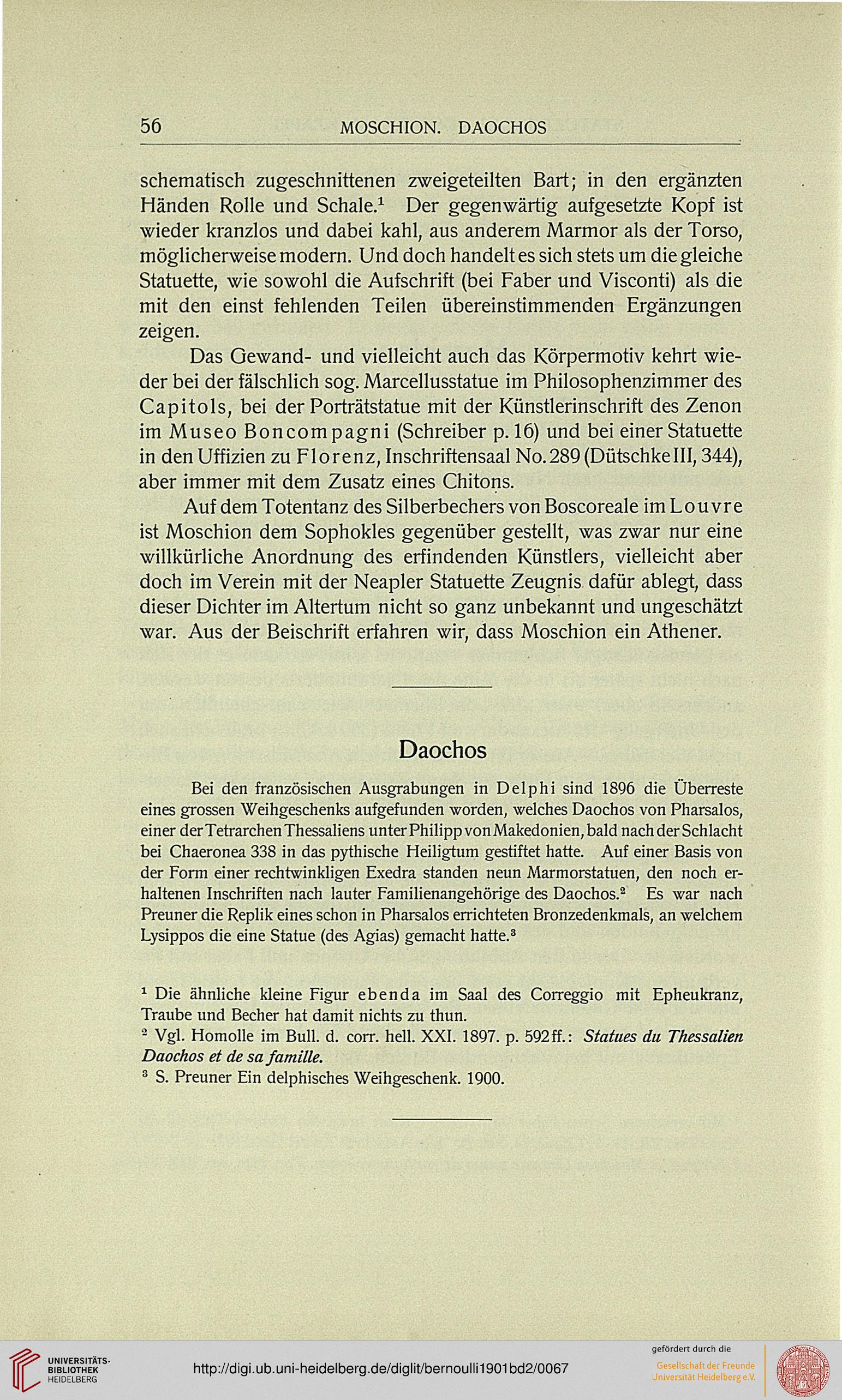56 MOSCHION. DAOCHOS
schematisch zugeschnittenen zweigeteilten Bart; in den ergänzten
Händen Rolle und Schale.1 Der gegenwärtig aufgesetzte Kopf ist
wieder kranzlos und dabei kahl, aus anderem Marmor als der Torso,
möglicherweise modern. Und doch handelt es sich stets um die gleiche
Statuette, wie sowohl die Aufschrift (bei Faber und Visconti) als die
mit den einst fehlenden Teilen übereinstimmenden Ergänzungen
zeigen.
Das Gewand- und vielleicht auch das Körpermotiv kehrt wie-
der bei der fälschlich sog. Marcellusstatue im Philosophenzimmer des
Capitols, bei der Porträtstatue mit der Künstlerinschrift des Zenon
imMuseoBoncompagni (Schreiber p. 16) und bei einer Statuette
in denUffizien zu Florenz, Inschriftensaal No.289(Dütschkelll, 344),
aber immer mit dem Zusatz eines Chitons.
Auf dem Totentanz des Silberbechers von Boscoreale im Louvre
ist Moschion dem Sophokles gegenüber gestellt, was zwar nur eine
willkürliche Anordnung des erfindenden Künstlers, vielleicht aber
doch im Verein mit der Neapler Statuette Zeugnis dafür ablegt, dass
dieser Dichter im Altertum nicht so ganz unbekannt und ungeschätzt
war. Aus der Beischrift erfahren wir, dass Moschion ein Athener.
Daochos
Bei den französischen Ausgrabungen in Delphi sind 1896 die Oberreste
eines grossen Weihgeschenks aufgefunden worden, welches Daochos von Pharsalos,
einer der Tetrarchen Thessaliens unter Philipp von Makedonien, bald nach der Schlacht
bei Chaeronea 338 in das pythische Heiligtum gestiftet hatte. Auf einer Basis von
der Form einer rechtwinkligen Exedra standen neun Marmorstatuen, den noch er-
haltenen Inschriften nach lauter Familienangehörige des Daochos.2 Es war nach
Preuner die Replik eines schon in Pharsalos errichteten Bronzedenkmals, an welchem
Lysippos die eine Statue (des Agias) gemacht hatte.3
1 Die ähnliche kleine Figur ebenda im Saal des Correggio mit Epheukranz,
Traube und Becher hat damit nichts zu thun.
- Vgl. Homolle im Bull. d. corr. hell. XXI. 1897. p. 592ff.: Statues du Thessalien
Daochos et de safamille.
3 S. Preuner Ein delphisches Weihgeschenk. 1900.
schematisch zugeschnittenen zweigeteilten Bart; in den ergänzten
Händen Rolle und Schale.1 Der gegenwärtig aufgesetzte Kopf ist
wieder kranzlos und dabei kahl, aus anderem Marmor als der Torso,
möglicherweise modern. Und doch handelt es sich stets um die gleiche
Statuette, wie sowohl die Aufschrift (bei Faber und Visconti) als die
mit den einst fehlenden Teilen übereinstimmenden Ergänzungen
zeigen.
Das Gewand- und vielleicht auch das Körpermotiv kehrt wie-
der bei der fälschlich sog. Marcellusstatue im Philosophenzimmer des
Capitols, bei der Porträtstatue mit der Künstlerinschrift des Zenon
imMuseoBoncompagni (Schreiber p. 16) und bei einer Statuette
in denUffizien zu Florenz, Inschriftensaal No.289(Dütschkelll, 344),
aber immer mit dem Zusatz eines Chitons.
Auf dem Totentanz des Silberbechers von Boscoreale im Louvre
ist Moschion dem Sophokles gegenüber gestellt, was zwar nur eine
willkürliche Anordnung des erfindenden Künstlers, vielleicht aber
doch im Verein mit der Neapler Statuette Zeugnis dafür ablegt, dass
dieser Dichter im Altertum nicht so ganz unbekannt und ungeschätzt
war. Aus der Beischrift erfahren wir, dass Moschion ein Athener.
Daochos
Bei den französischen Ausgrabungen in Delphi sind 1896 die Oberreste
eines grossen Weihgeschenks aufgefunden worden, welches Daochos von Pharsalos,
einer der Tetrarchen Thessaliens unter Philipp von Makedonien, bald nach der Schlacht
bei Chaeronea 338 in das pythische Heiligtum gestiftet hatte. Auf einer Basis von
der Form einer rechtwinkligen Exedra standen neun Marmorstatuen, den noch er-
haltenen Inschriften nach lauter Familienangehörige des Daochos.2 Es war nach
Preuner die Replik eines schon in Pharsalos errichteten Bronzedenkmals, an welchem
Lysippos die eine Statue (des Agias) gemacht hatte.3
1 Die ähnliche kleine Figur ebenda im Saal des Correggio mit Epheukranz,
Traube und Becher hat damit nichts zu thun.
- Vgl. Homolle im Bull. d. corr. hell. XXI. 1897. p. 592ff.: Statues du Thessalien
Daochos et de safamille.
3 S. Preuner Ein delphisches Weihgeschenk. 1900.