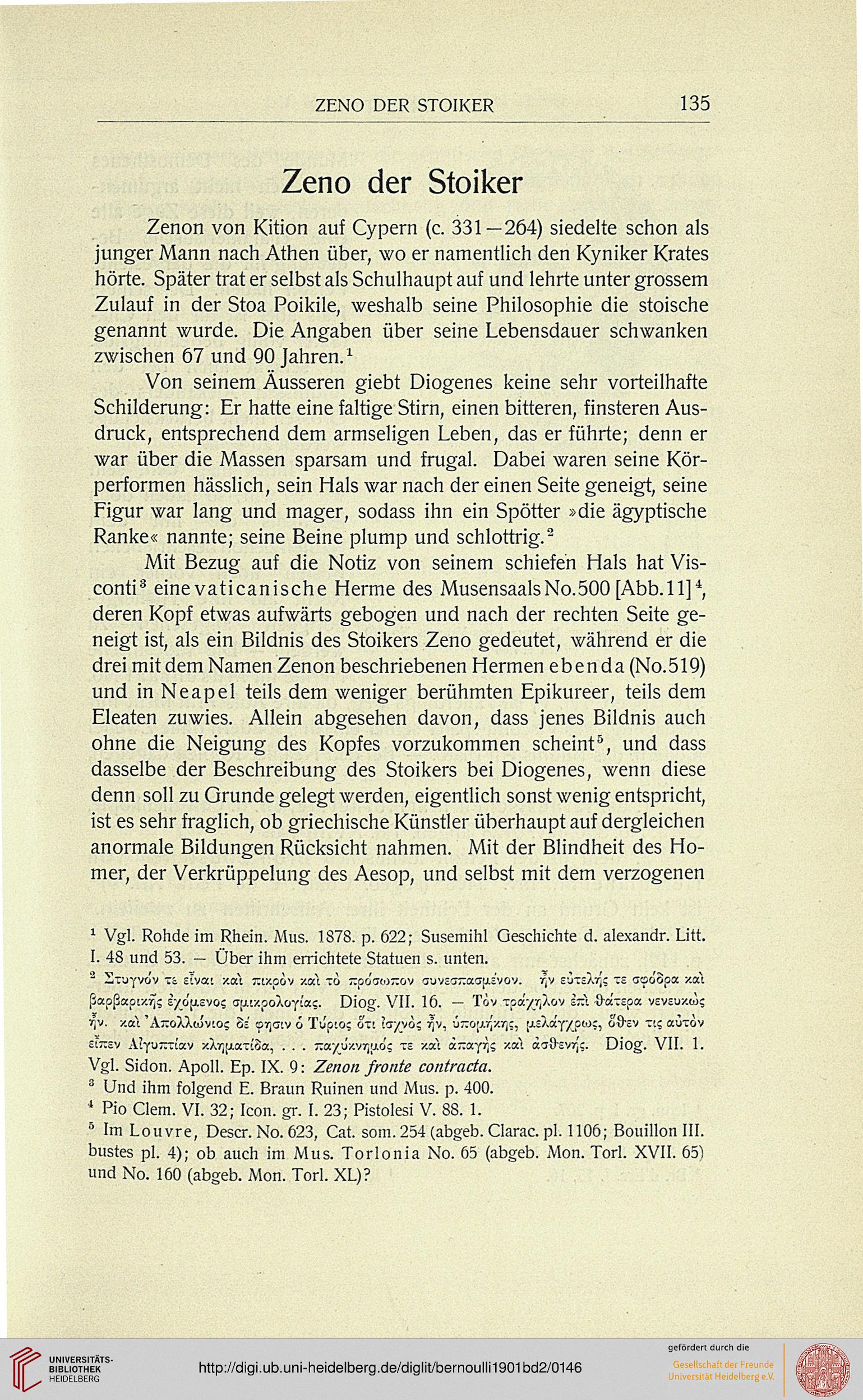ZENO DER STOIKER 135
Zeno der Stoiker
Zenon von Kition auf Cypern (c. 331—264) siedelte schon als
junger Mann nach Athen über, wo er namentlich den Kyniker Krates
hörte. Später trat er selbst als Schulhaupt auf und lehrte unter grossem
Zulauf in der Stoa Poikile, weshalb seine Philosophie die stoische
genannt wurde. Die Angaben über seine Lebensdauer schwanken
zwischen 67 und 90 Jahren.1
Von seinem Äusseren giebt Diogenes keine sehr vorteilhafte
Schilderung: Er hatte eine faltige Stirn, einen bitteren, finsteren Aus-
druck, entsprechend dem armseligen Leben, das er führte; denn er
war über die Massen sparsam und frugal. Dabei waren seine Kör-
performen hässlich, sein Hals war nach der einen Seite geneigt, seine
Figur war lang und mager, sodass ihn ein Spötter »die ägyptische
Ranke« nannte; seine Beine plump und schlottrig.2
Mit Bezug auf die Notiz von seinem schiefen Hals hat Vis-
conti8 einevaticanische Herme des MusensaalsNo.500[Abb. 11]*,
deren Kopf etwas aufwärts gebogen und nach der rechten Seite ge-
neigt ist, als ein Bildnis des Stoikers Zeno gedeutet, während er die
drei mit dem Namen Zenon beschriebenen Hermen ebenda (No.519)
und in Neapel teils dem weniger berühmten Epikureer, teils dem
Eleaten zuwies. Allein abgesehen davon, dass jenes Bildnis auch
ohne die Neigung des Kopfes vorzukommen scheint5, und dass
dasselbe der Beschreibung des Stoikers bei Diogenes, wenn diese
denn soll zu Grunde gelegt werden, eigentlich sonst wenig entspricht,
ist es sehr fraglich, ob griechische Künstler überhaupt auf dergleichen
anormale Bildungen Rücksicht nahmen. Mit der Blindheit des Ho-
mer, der Verkrüppelung des Aesop, und selbst mit dem verzogenen
1 Vgl. Rohde im Rhein. Mus. 1878. p. 622; Susemihl Geschichte d. alexandr. Litt.
I. 48 und 53. — Ober ihm errichtete Statuen s. unten.
2 — rjyvo'v -i. Eivai y.a\ r.iy.pov xai to :tpö<j<D7cov a'jvssTrasjjLs'vov. 7;v eüirsÄr^ ts enpoSpa xal
ßapßapucjjs Ey_op.Evog arj.izpoÄoy;'as. Diog. VII. 16. — Töv Tpa')(7)Xov i-X &a'-:spa vevsuxco;
v)V. y.a\ 'ÄtcoXXojvio; 3e orp'.v L Tu'p'.o; Ott la/vö; r?i. ÜKO'pjxijf, ;j.s).a"f/.pw?i SO'Ev -'.; aüiov
Ei-sv A'y«—iav xXrjjjiaTtSaj . . . -a/;J/.v7;ao; -z zai ä-ayr,; y.«l aaO-svrjg. Diog. VII. 1.
Vgl. Sidon. Apoll. Ep. IX. 9: Zenon fronte contractu.
3 Und ihm folgend E. Braun Ruinen und Mus. p. 400.
4 Pio Clem. VI. 32; Icon. gr. I. 23; Pistolesi V. 88. 1.
6 Im Louvre, Descr. No. 623, Cat. som. 254 (abgeb. Clarac. pl. 1106; Bouillon III.
bustes pl. 4); ob auch im Mus. Torlonia No. 65 (abgeb. Mon. Tori. XVII. 65)
und No. 160 (abgeb. Mon. Tori. XL)?
Zeno der Stoiker
Zenon von Kition auf Cypern (c. 331—264) siedelte schon als
junger Mann nach Athen über, wo er namentlich den Kyniker Krates
hörte. Später trat er selbst als Schulhaupt auf und lehrte unter grossem
Zulauf in der Stoa Poikile, weshalb seine Philosophie die stoische
genannt wurde. Die Angaben über seine Lebensdauer schwanken
zwischen 67 und 90 Jahren.1
Von seinem Äusseren giebt Diogenes keine sehr vorteilhafte
Schilderung: Er hatte eine faltige Stirn, einen bitteren, finsteren Aus-
druck, entsprechend dem armseligen Leben, das er führte; denn er
war über die Massen sparsam und frugal. Dabei waren seine Kör-
performen hässlich, sein Hals war nach der einen Seite geneigt, seine
Figur war lang und mager, sodass ihn ein Spötter »die ägyptische
Ranke« nannte; seine Beine plump und schlottrig.2
Mit Bezug auf die Notiz von seinem schiefen Hals hat Vis-
conti8 einevaticanische Herme des MusensaalsNo.500[Abb. 11]*,
deren Kopf etwas aufwärts gebogen und nach der rechten Seite ge-
neigt ist, als ein Bildnis des Stoikers Zeno gedeutet, während er die
drei mit dem Namen Zenon beschriebenen Hermen ebenda (No.519)
und in Neapel teils dem weniger berühmten Epikureer, teils dem
Eleaten zuwies. Allein abgesehen davon, dass jenes Bildnis auch
ohne die Neigung des Kopfes vorzukommen scheint5, und dass
dasselbe der Beschreibung des Stoikers bei Diogenes, wenn diese
denn soll zu Grunde gelegt werden, eigentlich sonst wenig entspricht,
ist es sehr fraglich, ob griechische Künstler überhaupt auf dergleichen
anormale Bildungen Rücksicht nahmen. Mit der Blindheit des Ho-
mer, der Verkrüppelung des Aesop, und selbst mit dem verzogenen
1 Vgl. Rohde im Rhein. Mus. 1878. p. 622; Susemihl Geschichte d. alexandr. Litt.
I. 48 und 53. — Ober ihm errichtete Statuen s. unten.
2 — rjyvo'v -i. Eivai y.a\ r.iy.pov xai to :tpö<j<D7cov a'jvssTrasjjLs'vov. 7;v eüirsÄr^ ts enpoSpa xal
ßapßapucjjs Ey_op.Evog arj.izpoÄoy;'as. Diog. VII. 16. — Töv Tpa')(7)Xov i-X &a'-:spa vevsuxco;
v)V. y.a\ 'ÄtcoXXojvio; 3e orp'.v L Tu'p'.o; Ott la/vö; r?i. ÜKO'pjxijf, ;j.s).a"f/.pw?i SO'Ev -'.; aüiov
Ei-sv A'y«—iav xXrjjjiaTtSaj . . . -a/;J/.v7;ao; -z zai ä-ayr,; y.«l aaO-svrjg. Diog. VII. 1.
Vgl. Sidon. Apoll. Ep. IX. 9: Zenon fronte contractu.
3 Und ihm folgend E. Braun Ruinen und Mus. p. 400.
4 Pio Clem. VI. 32; Icon. gr. I. 23; Pistolesi V. 88. 1.
6 Im Louvre, Descr. No. 623, Cat. som. 254 (abgeb. Clarac. pl. 1106; Bouillon III.
bustes pl. 4); ob auch im Mus. Torlonia No. 65 (abgeb. Mon. Tori. XVII. 65)
und No. 160 (abgeb. Mon. Tori. XL)?