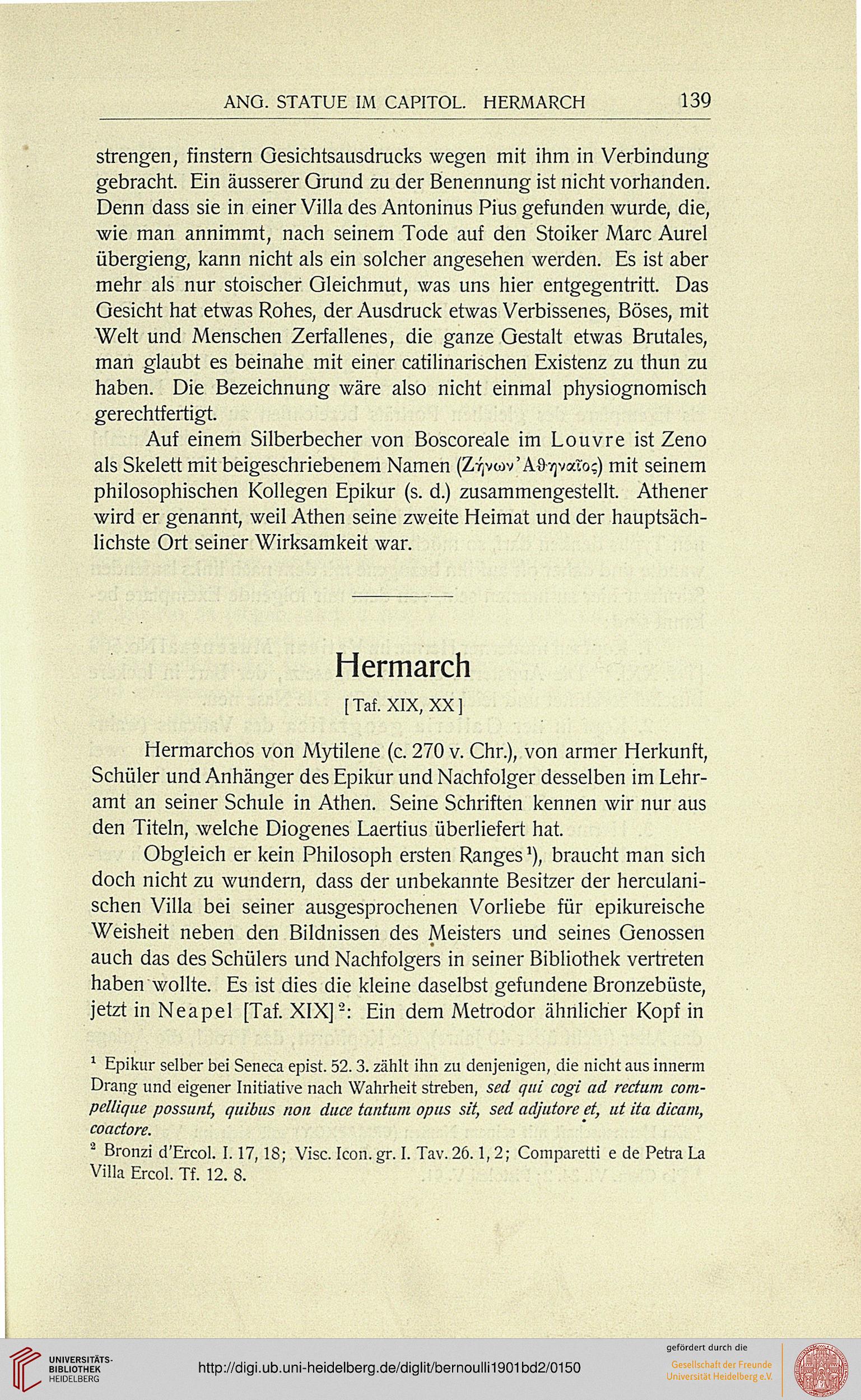ANG. STATUE IM CAPITOL. HERMARCH 139
strengen, finstern Gesichtsausdrucks wegen mit ihm in Verbindung
gebracht. Ein äusserer Grund zu der Benennung ist nicht vorhanden.
Denn dass sie in einer Villa des Antoninus Pius gefunden wurde, die,
wie man annimmt, nach seinem Tode auf den Stoiker Marc Aurel
übergieng, kann nicht als ein solcher angesehen werden. Es ist aber
mehr als nur stoischer Gleichmut, was uns hier entgegentritt. Das
Gesicht hat etwas Rohes, der Ausdruck etwas Verbissenes, Böses, mit
Welt und Menschen Zerfallenes, die ganze Gestalt etwas Brutales,
man glaubt es beinahe mit einer catilinarischen Existenz zu thun zu
haben. Die Bezeichnung wäre also nicht einmal physiognomisch
gerechtfertigt.
Auf einem Silberbecher von Boscoreale im Louvre ist Zeno
als Skelett mit beigeschriebenem Namen (Zrjvtov'A/Jhjvaro;) mit seinem
philosophischen Kollegen Epikur (s. d.) zusammengestellt. Athener
wird er genannt, weil Athen seine zweite Heimat und der hauptsäch-
lichste Ort seiner Wirksamkeit war.
Hermarch
[Taf. XIX, XX]
Hermarchos von Mytilene (c. 270 v. Chr.), von armer Herkunft,
Schüler und Anhänger des Epikur und Nachfolger desselben im Lehr-
amt an seiner Schule in Athen. Seine Schriften kennen wir nur aus
den Titeln, welche Diogenes Laertius überliefert hat.
Obgleich er kein Philosoph ersten Ranges]), braucht man sich
doch nicht zu wundern, dass der unbekannte Besitzer der herculani-
schen Villa bei seiner ausgesprochenen Vorliebe für epikureische
Weisheit neben den Bildnissen des Meisters und seines Genossen
auch das des Schülers und Nachfolgers in seiner Bibliothek vertreten
haben wollte. Es ist dies die kleine daselbst gefundene Bronzebüste,
jetzt in Neapel [Taf. XIX]2: Ein dem Metrodor ähnlicher Kopf in
1 Epikur selber bei Seneca epist. 52.3. zählt ihn zu denjenigen, die nicht aus innerm
Drang und eigener Initiative nach Wahrheit streben, sed qui cogi ad reäum com-
pellique possunt, quibus non duce tantum opus sit, sed adjutore et, ut ita dicam,
coadore.
2 Bronzi d'Ercol. 1.17,18; Visc. Icon. gr. I. Tav. 26.1,2; Comparetti e de Petra La
Villa Ercol. Tf. 12. 8.
strengen, finstern Gesichtsausdrucks wegen mit ihm in Verbindung
gebracht. Ein äusserer Grund zu der Benennung ist nicht vorhanden.
Denn dass sie in einer Villa des Antoninus Pius gefunden wurde, die,
wie man annimmt, nach seinem Tode auf den Stoiker Marc Aurel
übergieng, kann nicht als ein solcher angesehen werden. Es ist aber
mehr als nur stoischer Gleichmut, was uns hier entgegentritt. Das
Gesicht hat etwas Rohes, der Ausdruck etwas Verbissenes, Böses, mit
Welt und Menschen Zerfallenes, die ganze Gestalt etwas Brutales,
man glaubt es beinahe mit einer catilinarischen Existenz zu thun zu
haben. Die Bezeichnung wäre also nicht einmal physiognomisch
gerechtfertigt.
Auf einem Silberbecher von Boscoreale im Louvre ist Zeno
als Skelett mit beigeschriebenem Namen (Zrjvtov'A/Jhjvaro;) mit seinem
philosophischen Kollegen Epikur (s. d.) zusammengestellt. Athener
wird er genannt, weil Athen seine zweite Heimat und der hauptsäch-
lichste Ort seiner Wirksamkeit war.
Hermarch
[Taf. XIX, XX]
Hermarchos von Mytilene (c. 270 v. Chr.), von armer Herkunft,
Schüler und Anhänger des Epikur und Nachfolger desselben im Lehr-
amt an seiner Schule in Athen. Seine Schriften kennen wir nur aus
den Titeln, welche Diogenes Laertius überliefert hat.
Obgleich er kein Philosoph ersten Ranges]), braucht man sich
doch nicht zu wundern, dass der unbekannte Besitzer der herculani-
schen Villa bei seiner ausgesprochenen Vorliebe für epikureische
Weisheit neben den Bildnissen des Meisters und seines Genossen
auch das des Schülers und Nachfolgers in seiner Bibliothek vertreten
haben wollte. Es ist dies die kleine daselbst gefundene Bronzebüste,
jetzt in Neapel [Taf. XIX]2: Ein dem Metrodor ähnlicher Kopf in
1 Epikur selber bei Seneca epist. 52.3. zählt ihn zu denjenigen, die nicht aus innerm
Drang und eigener Initiative nach Wahrheit streben, sed qui cogi ad reäum com-
pellique possunt, quibus non duce tantum opus sit, sed adjutore et, ut ita dicam,
coadore.
2 Bronzi d'Ercol. 1.17,18; Visc. Icon. gr. I. Tav. 26.1,2; Comparetti e de Petra La
Villa Ercol. Tf. 12. 8.