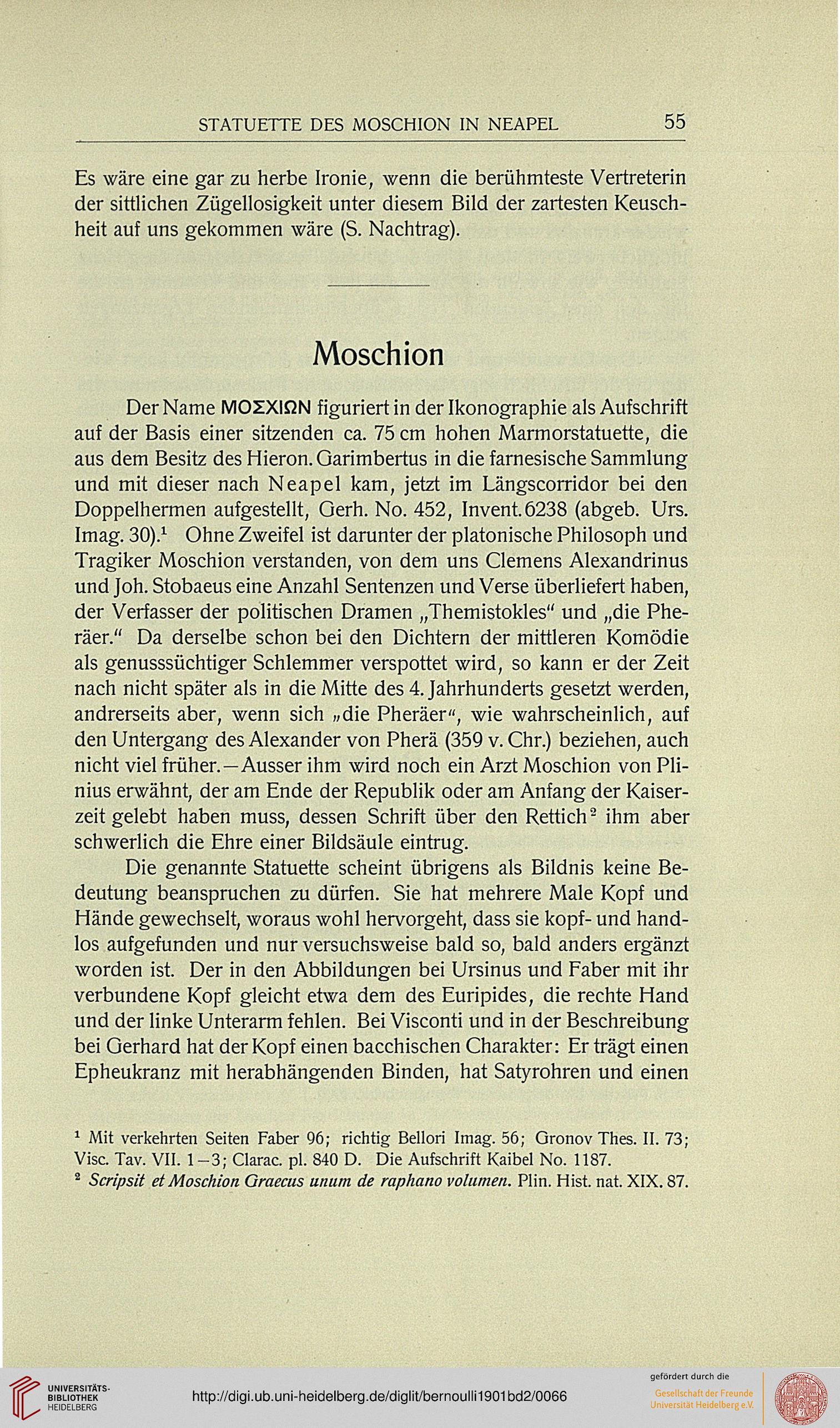STATUETTE DES MOSCHION IN NEAPEL 55
Es wäre eine gar zu herbe Ironie, wenn die berühmteste Vertreterin
der sittlichen Zügellosigkeit unter diesem Bild der zartesten Keusch-
heit auf uns gekommen wäre (S. Nachtrag).
Mosch ion
Der Name MOZX1QN figuriert in der Ikonographie als Aufschrift
auf der Basis einer sitzenden ca. 75 cm hohen Marmorstatuette, die
aus dem Besitz des Hieron. Garimbertus in die farnesische Sammlung
und mit dieser nach Neapel kam, jetzt im Längscorridor bei den
Doppelhermen aufgestellt, Oerh. No. 452, Invent.6238 (abgeb. Urs.
Imag. 30).1 Ohne Zweifel ist darunter der platonische Philosoph und
Tragiker Moschion verstanden, von dem uns Clemens Alexandrinus
und Joh. Stobaeus eine Anzahl Sentenzen und Verse überliefert haben,
der Verfasser der politischen Dramen „Themistokles" und „die Phe-
räer." Da derselbe schon bei den Dichtern der mittleren Komödie
als genusssüchtiger Schlemmer verspottet wird, so kann er der Zeit
nach nicht später als in die Mitte des 4. Jahrhunderts gesetzt werden,
andrerseits aber, wenn sich „die Pheräer", wie wahrscheinlich, auf
den Untergang des Alexander von Pherä (359 v. Chr.) beziehen, auch
nicht viel früher.—Ausser ihm wird noch ein Arzt Moschion von Pli-
nius erwähnt, der am Ende der Republik oder am Anfang der Kaiser-
zeit gelebt haben muss, dessen Schrift über den Rettich - ihm aber
schwerlich die Ehre einer Bildsäule eintrug.
Die genannte Statuette scheint übrigens als Bildnis keine Be-
deutung beanspruchen zu dürfen. Sie hat mehrere Male Kopf und
Hände gewechselt, woraus wohl hervorgeht, dass sie köpf- und hand-
los aufgefunden und nur versuchsweise bald so, bald anders ergänzt
worden ist. Der in den Abbildungen bei Ursinus und Faber mit ihr
verbundene Kopf gleicht etwa dem des Euripides, die rechte Hand
und der linke Unterarm fehlen. Bei Visconti und in der Beschreibung
bei Gerhard hat der Kopf einen bacchischen Charakter: Er trägt einen
Epheukranz mit herabhängenden Binden, hat Satyrohren und einen
1 Mit verkehrten Seiten Faber 96; richtig Bellori Imag. 56; Oronov Thes. II. 73;
Visc. Tav. VII. 1-3; Clarac. pl. 840 D. Die Aufschrift Kaibel No. 1187.
2 Scripsit et Moschion Qraecus unum de raphano volumen. Plin. Hist. nat. XIX. 87.
Es wäre eine gar zu herbe Ironie, wenn die berühmteste Vertreterin
der sittlichen Zügellosigkeit unter diesem Bild der zartesten Keusch-
heit auf uns gekommen wäre (S. Nachtrag).
Mosch ion
Der Name MOZX1QN figuriert in der Ikonographie als Aufschrift
auf der Basis einer sitzenden ca. 75 cm hohen Marmorstatuette, die
aus dem Besitz des Hieron. Garimbertus in die farnesische Sammlung
und mit dieser nach Neapel kam, jetzt im Längscorridor bei den
Doppelhermen aufgestellt, Oerh. No. 452, Invent.6238 (abgeb. Urs.
Imag. 30).1 Ohne Zweifel ist darunter der platonische Philosoph und
Tragiker Moschion verstanden, von dem uns Clemens Alexandrinus
und Joh. Stobaeus eine Anzahl Sentenzen und Verse überliefert haben,
der Verfasser der politischen Dramen „Themistokles" und „die Phe-
räer." Da derselbe schon bei den Dichtern der mittleren Komödie
als genusssüchtiger Schlemmer verspottet wird, so kann er der Zeit
nach nicht später als in die Mitte des 4. Jahrhunderts gesetzt werden,
andrerseits aber, wenn sich „die Pheräer", wie wahrscheinlich, auf
den Untergang des Alexander von Pherä (359 v. Chr.) beziehen, auch
nicht viel früher.—Ausser ihm wird noch ein Arzt Moschion von Pli-
nius erwähnt, der am Ende der Republik oder am Anfang der Kaiser-
zeit gelebt haben muss, dessen Schrift über den Rettich - ihm aber
schwerlich die Ehre einer Bildsäule eintrug.
Die genannte Statuette scheint übrigens als Bildnis keine Be-
deutung beanspruchen zu dürfen. Sie hat mehrere Male Kopf und
Hände gewechselt, woraus wohl hervorgeht, dass sie köpf- und hand-
los aufgefunden und nur versuchsweise bald so, bald anders ergänzt
worden ist. Der in den Abbildungen bei Ursinus und Faber mit ihr
verbundene Kopf gleicht etwa dem des Euripides, die rechte Hand
und der linke Unterarm fehlen. Bei Visconti und in der Beschreibung
bei Gerhard hat der Kopf einen bacchischen Charakter: Er trägt einen
Epheukranz mit herabhängenden Binden, hat Satyrohren und einen
1 Mit verkehrten Seiten Faber 96; richtig Bellori Imag. 56; Oronov Thes. II. 73;
Visc. Tav. VII. 1-3; Clarac. pl. 840 D. Die Aufschrift Kaibel No. 1187.
2 Scripsit et Moschion Qraecus unum de raphano volumen. Plin. Hist. nat. XIX. 87.