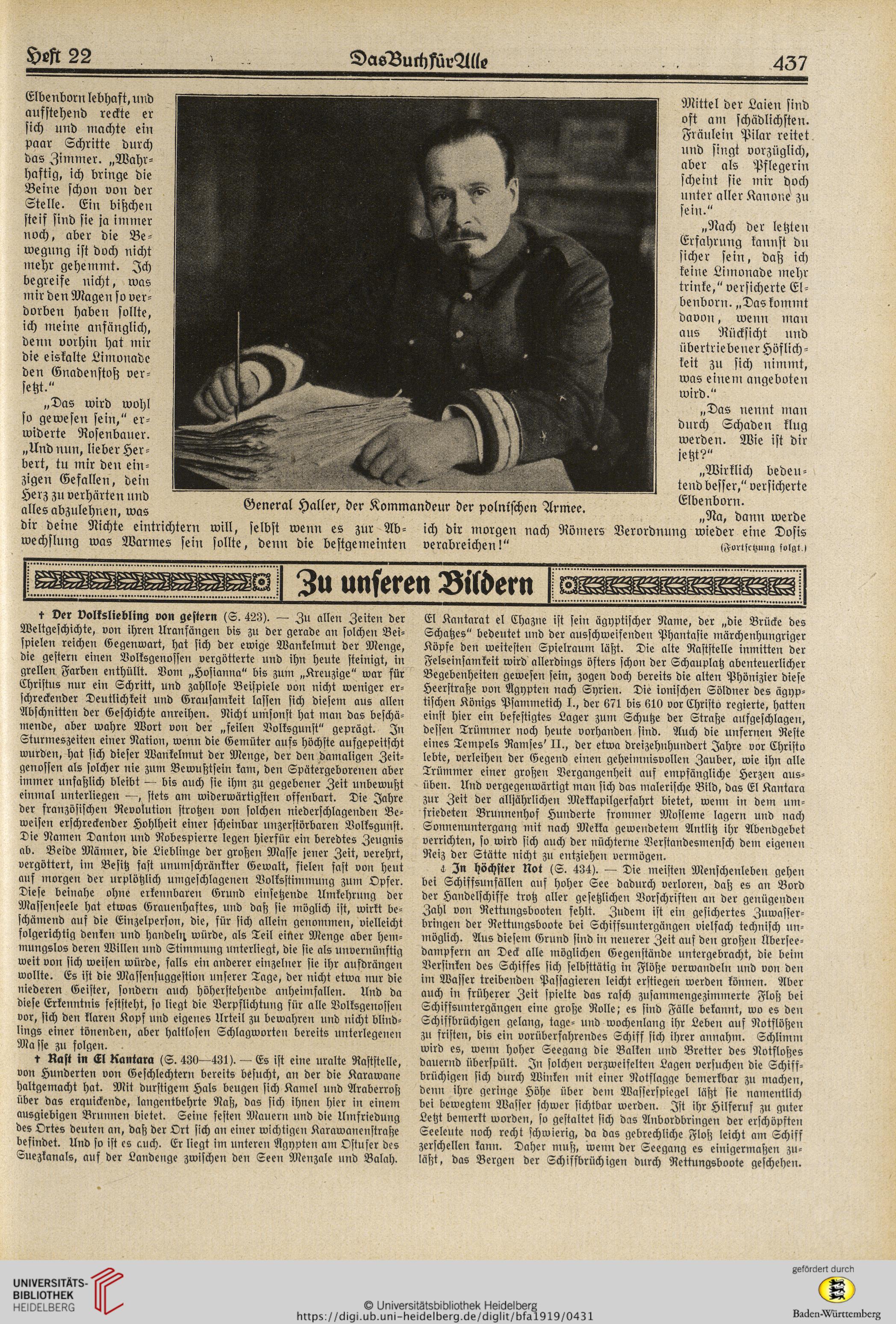Heft 22
DaeBuchfüvAlle
/
Mittel der Laien sind
oft an, schädlichsten.
Fräulein Pilar reitet
und singt vorzüglich,
aber als Pflegerin
scheint sie nur d^och
unter aller Kanone zu
sein."
„Nach der letzten
Erfahrung kannst du
sicher sein, daß ich
keine Limonade mehr
trinke," versicherte El-
benboru. „Das kommt
davon, wenn man
aus Rücksicht und
übertriebener Höflich-
keit zu sich nimmt,
was einen, angeboten
wird."
„Das nennt man
durch Schaden klug
werden. Wie ist dir
jetzt?"
„Wirklich bedeu-
tend besser," versicherte
Elbenborn.
„Na, dann werde
Elbenborn lebhaft, und
aufstehend recüe er
sich und machte ein
paar Schritte durch
das Zimmer. „Wahr¬
haftig, ich bringe die
Beine schon von der
Stelle. Ein bißchen
steif sind sie ja immer
noch, aber die Be¬
wegung ist doch nicht
mehr gehemmt. Ich
begreife nicht, was
mir den Magen so ver¬
dorben haben sollte,
ich meine anfänglich,
denn vorhin hat mir
die eiskalte Limonade
den Gnadenstoß ver¬
setzt."
„Das wird wohl
so gewesen sein," er¬
widerte Rosenbauer.
„Und mm, lieber Her¬
bert, tu mir den ein¬
zigen Gefallen, dein
Herz zu verhärten und
alles abzulehnen, was
dir deine Nichte eintrichtern will, selbst wenn es zur Ab- ich dir morgen nach Römers Verordnung wieder eine Dosis
wechslung was Warmes sein sollte, denn die bestgemeinten verabreichen!" Ko>uch>mg solgm
Zu unseren Bildern
4 Ver volksliebling von gestern (S. 423). — Zu allen Zeiten der
Weltgeschichte, von ihren Uranfängen bis zu der gerade an solchen Bei-
spielen reichen Gegenwart, hat sich der ewige Wankelmut der Menge,
die gestern einen Volksgenossen vergötterte und ihn heute steinigt, in
grellen Farben enthüllt. Von, „Hosianna" bis zum „Kreuzige" war für
Christus nur ein Schritt, und zahllose Beispiele von nicht weniger er-
schreckender Deutlichkeit und Grausamkeit lassen sich diesem aus allen
Abschnitten der Geschichte anreihen. Nicht umsonst hat man das beschä-
mende, aber wahre Wort von der „feilen Volksgunst" geprägt. In
Sturmeszeiten einer Nation, wenn die Gemüter aufs höchste aufgepeitscht
wurden, hat sich dieser Wankelmut der Menge, der den damaligen Zeit-
genossen als solcher nie zum Bewußtsein kam, den Spätergeborenen aber
immer unfaßlich bleibt — bis auch sie ihm zu gegebener Zeit unbewußt
einmal unterliegen —, stets am widerwärtigsten offenbart. Die Jahre
der französischen Revolution strotzen von solchen niederschlagenden Be-
weisen erschreckender Hohlheit einer scheinbar unzerstörbaren Volksgunst.
Die Namen Danton und Robespierre legen hierfür ein beredtes Zeugnis
ab. Beide Männer, die Lieblinge der großen Masse jener Zeit, verehrt,
vergöttert, im Besitz fast unumschränkter Gewalt, fielen fast von heut
auf morgen der urplötzlich umgeschlagenen Volksstimmung zum Opfer.
Diese beinahe ohne erkennbaren Grund einsehende Umkehrung der
Massenseele hat etwas Grauenhaftes, und daß sie möglich ist, wirkt be-
schämend auf die Einzelperson, die, für sich allein genommen, vielleicht
folgerichtig denken und Handels würde, als Teil einer Menge aber hem-
mungslos deren Willen und Stimmung unterliegt, die sie als unvernünftig
weit von sich weisen würde, falls ein anderer einzelner sie ihr aufdrängen
wollte. Es ist die Massensuggestion unserer Tags, der nicht etwa nur die
niederen Geister, sondern auch höherstehende anheimsallen. Und da
diese Erkenntnis feststeht, so liegt die Verpflichtung für alle Volksgenossen
vor, sich den klaren Kopf und eigenes Urteil zu bewahren und nicht blind-
lings einer tönenden, aber haltlosen Schlagworten bereits unterlegenen
Masse zu folge».
4 Rast in El Uantara (S. 430—431).— Es ist eine uralte Raststelle,
von Hunderten von Geschlechtern bereits besucht, an der die Karawane
Haltgemacht hat. Mit durstigem Hals beugen sich Kamel und Araberroß
über das erquickende, langentbehrte Naß, das sich ihnen hier in einem
ausgiebigen Brunnen bietet. Seine festen Mauern und die Umfriedung
des Ortes deuten an, daß der Ort sich an einer wichtigen Karawanenstraße
befindet. Und so ist cs auch. Er liegt im unteren Ägypten am Ostuser des
Suezkanals, auf der Landenge zwischen den Seen Menzale und Balah.
El Kantarat el Lhazne ist sein ägyptischer Name, der „die Brücke des
Schatzes" bedeutet und der ausschweifenden Phantasie märchenhungriger
Köpfe den weitesten Spielraum läßt. Die alte Raststelle inmitten der
Felseinsamkeit wird allerdings öfters schon der Schauplatz abenteuerlicher
Begebenheiten gewesen sein, zogen doch bereits die alten Phönizier diese
Heerstraße von Ägypten nach Syrien. Die ionischen Söldner des ägyp-
tischen Königs Psammetich I., der 671 bis 610 vor Christo regierte, hatten
einst hier ein befestigtes Lager zuni Schuhe der Straße aufgeschlagen,
dessen Trümmer noch heute vorhanden sind. Auch die unfernen Reste
eines Tempels Ramses' II., der etwa dreizehnhundert Jahre vor Christo
lebte, verleihen der Gegend einen geheimnisvollen Zauber, wie ihn alle
Trümmer einer großen Vergangenheit auf empfängliche Herzen aus-
üben. Und vergegenwärtigt man sich das malerische Bild, das El Kantara
zur Zeit der alljährlichen Mekkapilgerfahrt bietet, wenn in dem um-
friedeten Brunnenhof Hunderte frommer Mosleme lagern und nach
Sonnenuntergang mit nach Mekka gewendetem Antlitz ihr Abendgebet
verrichten, so wird sich auch der nüchterne Verstandesmensch dein eigenen
Reiz der Stätte nicht zu entziehen vermögen.
z In höchster Not (S. 434). — Die meisten Menschenleben gehen
bei Schiffsunfällen auf hoher See dadurch verloren, daß es an Bord
der Handelschiffe trotz aller gesetzlichen Vorschriften an der genügenden
Zahl von Rettungsbooten fehlt. Zudem ist ein gesichertes Zuwasser-
bringen der Rettungsboote bei Schiffsuntergängen vielfach technisch un-
möglich. Aus diesem Grund sind in neuerer Zeit auf den großen Übersee-
dampfern an Deck alle möglichen Gegenstände untergebracht, die beim
Versinken des Schiffes sich selbsttätig in Flöße verwandeln und von den
im Wasser treibenden Passagieren leicht erstiegen werden können. Aber
auch in früherer Zeit spielte das rasch zusammengezimmerte Floß bei
Schiffsuntergängen eine große Rolle,' es sind Fälle bekannt, wo es den
Schiffbrüchigen gelang, tage- und wochenlang ihr Leben auf Notflößen
zu fristen, bis ein vorüberfahrendes Schiff sich ihrer annahm. Schlimm
wird es, wenn hoher Seegang die Balken und Bretter des Notfloßes
dauernd überspült. In solchen verzweifelten Lagen versuchen die Schiff-
brüchigen sich durch Winken mit einer Notflagge bemerkbar zu machen,
denn ihre geringe Höhe über dem Wasserspiegel läßt sie namentlich
bei bewegtem Wasser schwer sichtbar werden. Ist ihr Hilferuf zu guter
Letzt bemerkt worden, so gestaltet sich das Anbordbringen der erschöpften
Seeleute noch recht schwierig, da das gebrechliche Floß leicht am Schiff
zerschellen kann. Daher muß, wenn der Seegang es einigermaßen zu-
läßt, das Bergen der Schiffbrüchigen durch Rettungsboote geschehen.
DaeBuchfüvAlle
/
Mittel der Laien sind
oft an, schädlichsten.
Fräulein Pilar reitet
und singt vorzüglich,
aber als Pflegerin
scheint sie nur d^och
unter aller Kanone zu
sein."
„Nach der letzten
Erfahrung kannst du
sicher sein, daß ich
keine Limonade mehr
trinke," versicherte El-
benboru. „Das kommt
davon, wenn man
aus Rücksicht und
übertriebener Höflich-
keit zu sich nimmt,
was einen, angeboten
wird."
„Das nennt man
durch Schaden klug
werden. Wie ist dir
jetzt?"
„Wirklich bedeu-
tend besser," versicherte
Elbenborn.
„Na, dann werde
Elbenborn lebhaft, und
aufstehend recüe er
sich und machte ein
paar Schritte durch
das Zimmer. „Wahr¬
haftig, ich bringe die
Beine schon von der
Stelle. Ein bißchen
steif sind sie ja immer
noch, aber die Be¬
wegung ist doch nicht
mehr gehemmt. Ich
begreife nicht, was
mir den Magen so ver¬
dorben haben sollte,
ich meine anfänglich,
denn vorhin hat mir
die eiskalte Limonade
den Gnadenstoß ver¬
setzt."
„Das wird wohl
so gewesen sein," er¬
widerte Rosenbauer.
„Und mm, lieber Her¬
bert, tu mir den ein¬
zigen Gefallen, dein
Herz zu verhärten und
alles abzulehnen, was
dir deine Nichte eintrichtern will, selbst wenn es zur Ab- ich dir morgen nach Römers Verordnung wieder eine Dosis
wechslung was Warmes sein sollte, denn die bestgemeinten verabreichen!" Ko>uch>mg solgm
Zu unseren Bildern
4 Ver volksliebling von gestern (S. 423). — Zu allen Zeiten der
Weltgeschichte, von ihren Uranfängen bis zu der gerade an solchen Bei-
spielen reichen Gegenwart, hat sich der ewige Wankelmut der Menge,
die gestern einen Volksgenossen vergötterte und ihn heute steinigt, in
grellen Farben enthüllt. Von, „Hosianna" bis zum „Kreuzige" war für
Christus nur ein Schritt, und zahllose Beispiele von nicht weniger er-
schreckender Deutlichkeit und Grausamkeit lassen sich diesem aus allen
Abschnitten der Geschichte anreihen. Nicht umsonst hat man das beschä-
mende, aber wahre Wort von der „feilen Volksgunst" geprägt. In
Sturmeszeiten einer Nation, wenn die Gemüter aufs höchste aufgepeitscht
wurden, hat sich dieser Wankelmut der Menge, der den damaligen Zeit-
genossen als solcher nie zum Bewußtsein kam, den Spätergeborenen aber
immer unfaßlich bleibt — bis auch sie ihm zu gegebener Zeit unbewußt
einmal unterliegen —, stets am widerwärtigsten offenbart. Die Jahre
der französischen Revolution strotzen von solchen niederschlagenden Be-
weisen erschreckender Hohlheit einer scheinbar unzerstörbaren Volksgunst.
Die Namen Danton und Robespierre legen hierfür ein beredtes Zeugnis
ab. Beide Männer, die Lieblinge der großen Masse jener Zeit, verehrt,
vergöttert, im Besitz fast unumschränkter Gewalt, fielen fast von heut
auf morgen der urplötzlich umgeschlagenen Volksstimmung zum Opfer.
Diese beinahe ohne erkennbaren Grund einsehende Umkehrung der
Massenseele hat etwas Grauenhaftes, und daß sie möglich ist, wirkt be-
schämend auf die Einzelperson, die, für sich allein genommen, vielleicht
folgerichtig denken und Handels würde, als Teil einer Menge aber hem-
mungslos deren Willen und Stimmung unterliegt, die sie als unvernünftig
weit von sich weisen würde, falls ein anderer einzelner sie ihr aufdrängen
wollte. Es ist die Massensuggestion unserer Tags, der nicht etwa nur die
niederen Geister, sondern auch höherstehende anheimsallen. Und da
diese Erkenntnis feststeht, so liegt die Verpflichtung für alle Volksgenossen
vor, sich den klaren Kopf und eigenes Urteil zu bewahren und nicht blind-
lings einer tönenden, aber haltlosen Schlagworten bereits unterlegenen
Masse zu folge».
4 Rast in El Uantara (S. 430—431).— Es ist eine uralte Raststelle,
von Hunderten von Geschlechtern bereits besucht, an der die Karawane
Haltgemacht hat. Mit durstigem Hals beugen sich Kamel und Araberroß
über das erquickende, langentbehrte Naß, das sich ihnen hier in einem
ausgiebigen Brunnen bietet. Seine festen Mauern und die Umfriedung
des Ortes deuten an, daß der Ort sich an einer wichtigen Karawanenstraße
befindet. Und so ist cs auch. Er liegt im unteren Ägypten am Ostuser des
Suezkanals, auf der Landenge zwischen den Seen Menzale und Balah.
El Kantarat el Lhazne ist sein ägyptischer Name, der „die Brücke des
Schatzes" bedeutet und der ausschweifenden Phantasie märchenhungriger
Köpfe den weitesten Spielraum läßt. Die alte Raststelle inmitten der
Felseinsamkeit wird allerdings öfters schon der Schauplatz abenteuerlicher
Begebenheiten gewesen sein, zogen doch bereits die alten Phönizier diese
Heerstraße von Ägypten nach Syrien. Die ionischen Söldner des ägyp-
tischen Königs Psammetich I., der 671 bis 610 vor Christo regierte, hatten
einst hier ein befestigtes Lager zuni Schuhe der Straße aufgeschlagen,
dessen Trümmer noch heute vorhanden sind. Auch die unfernen Reste
eines Tempels Ramses' II., der etwa dreizehnhundert Jahre vor Christo
lebte, verleihen der Gegend einen geheimnisvollen Zauber, wie ihn alle
Trümmer einer großen Vergangenheit auf empfängliche Herzen aus-
üben. Und vergegenwärtigt man sich das malerische Bild, das El Kantara
zur Zeit der alljährlichen Mekkapilgerfahrt bietet, wenn in dem um-
friedeten Brunnenhof Hunderte frommer Mosleme lagern und nach
Sonnenuntergang mit nach Mekka gewendetem Antlitz ihr Abendgebet
verrichten, so wird sich auch der nüchterne Verstandesmensch dein eigenen
Reiz der Stätte nicht zu entziehen vermögen.
z In höchster Not (S. 434). — Die meisten Menschenleben gehen
bei Schiffsunfällen auf hoher See dadurch verloren, daß es an Bord
der Handelschiffe trotz aller gesetzlichen Vorschriften an der genügenden
Zahl von Rettungsbooten fehlt. Zudem ist ein gesichertes Zuwasser-
bringen der Rettungsboote bei Schiffsuntergängen vielfach technisch un-
möglich. Aus diesem Grund sind in neuerer Zeit auf den großen Übersee-
dampfern an Deck alle möglichen Gegenstände untergebracht, die beim
Versinken des Schiffes sich selbsttätig in Flöße verwandeln und von den
im Wasser treibenden Passagieren leicht erstiegen werden können. Aber
auch in früherer Zeit spielte das rasch zusammengezimmerte Floß bei
Schiffsuntergängen eine große Rolle,' es sind Fälle bekannt, wo es den
Schiffbrüchigen gelang, tage- und wochenlang ihr Leben auf Notflößen
zu fristen, bis ein vorüberfahrendes Schiff sich ihrer annahm. Schlimm
wird es, wenn hoher Seegang die Balken und Bretter des Notfloßes
dauernd überspült. In solchen verzweifelten Lagen versuchen die Schiff-
brüchigen sich durch Winken mit einer Notflagge bemerkbar zu machen,
denn ihre geringe Höhe über dem Wasserspiegel läßt sie namentlich
bei bewegtem Wasser schwer sichtbar werden. Ist ihr Hilferuf zu guter
Letzt bemerkt worden, so gestaltet sich das Anbordbringen der erschöpften
Seeleute noch recht schwierig, da das gebrechliche Floß leicht am Schiff
zerschellen kann. Daher muß, wenn der Seegang es einigermaßen zu-
läßt, das Bergen der Schiffbrüchigen durch Rettungsboote geschehen.