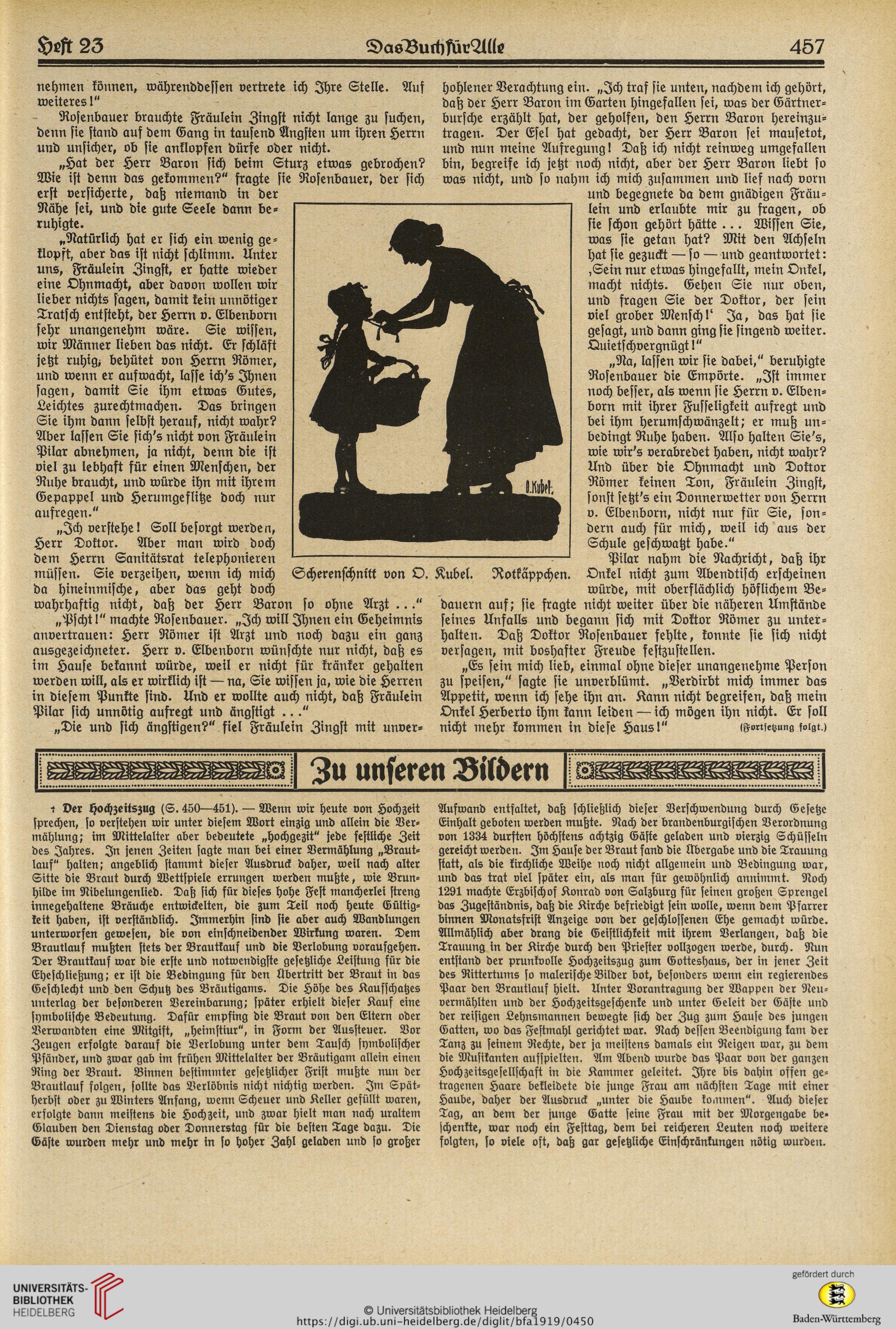Heft 23
DasBuchfürAlle
457
nehmen können, währenddessen vertrete ich Ihre Stelle. Auf
weiteres!"
Rosenbauer brauchte Fräulein Zingst nicht lange zu suchen,
denn sie stand auf dem Gang in tausend Ängsten um ihren Herrn
und unsicher, ob sie anklopfen dürfe oder nicht.
„Hat der Herr Baron sich beim Sturz etwas gebrochen?
Wie ist denn das gekommen?" fragte sie Rosenbauer, der sich
erst versicherte, daß niemand in der
Nähe sei, und die gute Seele dann be¬
ruhigte.
„Natürlich hat er sich ein wenig ge¬
klopft, aber das ist nicht schlimm. Unter
uns, Fräulein Zingst, er hatte wieder
eine Ohnmacht, aber davon wollen wir
lieber nichts sagen, damit kein unnötiger
Tratsch entsteht, der Herrn v. Elbenborn
sehr unangenehm wäre. Sie wissen,
wir Männer lieben das nicht. Er schläft
jetzt ruhige behütet von Herrn Römer,
und wenn er aufwacht, lasse ich's Ihnen
sagen, damit Sie ihm etwas Gutes,
Leichtes zurechtmachen. Das bringen
Sie ihm dann selbst herauf, nicht wahr?
Aber lassen Sie sich's nicht von Fräulein
Pilar abnehmen, ja nicht, denn die ist
viel zu lebhaft für einen Menschen, der
Ruhe braucht, und würde ihn mit ihrem
Eepappel und Herumgeflitze doch nur
aufregen."
„Ich verstehe! Soll besorgt werden,
Herr Doktor. Aber man wird doch
dem Herrn Sanitätsrat telephonieren
müssen. Sie verzeihen, wenn ich mich
da hineinmische, aber das geht doch
wahrhaftig nicht, daß der Herr Baron so ohne Arzt ..."
„Pscht I" machte Rosenbauer. „Ich will Ihnen ein Geheimnis
anvertrauen: Herr Römer ist Arzt und noch dazu ein ganz
ausgezeichneter. Herr v. Eibenborn wünschte nur nicht, dasz es
im Hause bekannt würde, weil er nicht für kränker gehalten
werden will, als er wirklich ist — na, Sie wissen ja, wie die Herren
in diesem Punkte sind. Und er wollte auch nicht, daß Fräulein
Pilar sich unnötig aufregt und ängstigt ..."
„Die und sich ängstigen?" fiel Fräulein Zingst mit unver-
hohlener Verachtung ein. „Ich traf sie unten, nachdem ich gehört,
dah der Herr Baron im Garten hingefallen sei, was der Gärtner-
bursche erzählt hat, der geholfen, den Herrn Baron hereinzu-
tragen. Der Esel hat gedacht, der Herr Baron sei mausetot,
und nun meine Aufregung I Daß ich nicht reinweg umgefallen
bin, begreife ich jetzt noch nicht, aber der Herr Baron liebt so
was nicht, und so nahm ich mich zusammen und lief nach vorn
und begegnete da dem gnädigen Fräu-
lein und erlaubte mir zu fragen, ob
sie schon gehört hätte ... Wissen Sie,
was sie getan hat? Mit den Achseln
hat sie gezuckt — so — und geantwortet:
,Sein nur etwas hingefallt, mein Onkel,
macht nichts. Gehen Sie nur oben,
und fragen Sie der Doktor, der sein
viel grober Mensch!' Ja, das hat sie
gesagt, und dann ging sie singend weiter.
Quietschvergnügt!"
„Na, lassen wir sie dabei," beruhigte
Rosenbauer die Empörte. „Ist immer
noch besser, als wenn sie Herrn v. Elben-
born mit ihrer Fusseligkeit aufregt und
bei ihm herumschwänzelt,' er mutz un-
bedingt Ruhe haben. Also halten Sie's,
wie wir's verabredet haben, nicht wahr?
Und über die Ohnmacht und Doktor
Römer keinen Ton, Fräulein Zingst,
sonst setzt's ein Donnerwetter von Herrn
v. Elbenborn, nicht nur für Sie, son-
dern auch für mich, weil ich aus der
Schule geschwatzt habe."
Pilar nahm die Nachricht, daß ihr
Onkel nicht zum Abendtisch erscheinen
würde, mit oberflächlich höflichem Be-
dauern auf; sie fragte nicht weiter über die näheren Umstände
seines Unfalls und begann sich mit Doktor Römer zu unter-
halten. Daß Doktor Rosenbauer fehlte, konnte sie sich nicht
versagen, mit boshafter Freude festzustellen.
„Es sein mich lieb, einmal ohne dieser unangenehme Person
zu speisen," sagte sie unverblümt. „Verdirbt mich immer das
Appetit, wenn ich sehe ihn an. Kann nicht begreifen, daß mein
Onkel Herberto ihm kann leiden — ich mögen ihn nicht. Er soll
nicht mehr kommen in diese Haus!" «Fortsetzung folgt.»
Scherenschnitt von O. Kubel. Rotkäppchen.
Zu unseren Bildern
7 Der Hochzeitszug (S. 450—451). — Wenn wir heute von Hochzeit
sprechen, so verstehen wir unter diesem Wort einzig und allein die Ver-
mählung; im Mittelalter aber bedeutete „hochgezit" jede festliche Zeit
des Jahres. In jenen Zeiten sagte man bei einer Vermählung „Braut-
lauf" halten; angeblich stammt dieser Ausdruck daher, weil nach alter
Sitte die Braut durch Wettspiele errungen werden mutzte, wie Brun-
Hilde im Nibelungenlied. Daß sich für dieses hohe Fest mancherlei streng
innegehaltene Bräuche entwickelten, die zum Teil noch heute Gültig-
keit haben, ist verständlich. Immerhin sind sie aber auch Wandlungen
unterworfen gewesen, die von einschneidender Wirkung waren. Dem
Vrautlauf mutzten stets der Brautkauf und die Verlobung voraufgehen.
Der Brautkauf war die erste und notwendigste gesetzliche Leistung für die
Eheschließung; er ist die Bedingung für den Übertritt der Braut in das
Geschlecht und den Schutz des Bräutigams. Die Höhe des Kaufschatzes
unterlag der besonderen Vereinbarung; später erhielt dieser Kauf eine
symbolische Bedeutung. Dafür empfing die Braut von den Eltern oder
Verwandten eine Mitgift, „heimstiur", in Form der Aussteuer. Vor
Zeugen erfolgte darauf die Verlobung unter dem Tausch symbolischer
Pfänder, und zwar gab im frühen Mittelalter der Bräutigam allein einen
Ring der Braut. Binnen bestimmter gesetzlicher Frist mutzte nun der
Brautlauf folgen, sollte das Verlöbnis nicht nichtig werden. Im Spät-
herbst oder zu Winters Anfang, wenn Scheuer und Keller gefüllt waren,
erfolgte dann meistens die Hochzeit, und zwar hielt man nach uraltem
Glauben den Dienstag oder Donnerstag für die besten Tage dazu. Die
Gäste wurden mehr und mehr in so hoher Zahl geladen und so großer
Aufwand entfaltet, daß schließlich dieser Verschwendung durch Gesetze
Einhalt geboten werden mutzte. Nach der brandenburgischen Verordnung
von 1334 durften höchstens achtzig Gäste geladen und vierzig Schüsseln
gereicht werden. Im Hause der Braut fand die Übergabe und die Trauung
statt, als die kirchliche Weihe noch nicht allgemein und Bedingung war,
und das trat viel später ein, als man für gewöhnlich annimmt. Noch
1291 machte Erzbischof Konrad von Salzburg für seinen großen Sprengel
das Zugeständnis, daß die Kirche befriedigt sein wolle, wem: dem Pfarrer
binnen Monatsfrist Anzeige von der geschlossenen Ehe gemacht würde.
Allmählich aber drang die Geistlichkeit mit ihrem Verlangen, daß die
Trauung in der Kirche durch den Priester vollzogen werde, durch. Nun
entstand der prunkvolle Hochzeitszug zum Gotteshaus, der in jener Zeit
des Rittertums so malerische Bilder bot, besonders wenn ein regierendes
Paar den Brautlauf hielt. Unter Vorantragung der Wappen der Neu-
vermählten und der Hochzeitsgeschenke und unter Geleit der Gäste und
der reisigen Lehnsmannen bewegte sich der Zug zum Hause des jungen
Gatten, wo das Festmahl gerichtet war. Nach dessen Beendigung kam der
Tanz zu seinem Rechte, der ja meistens damals ein Reigen war, zu dem
die Musikanten aufspielten. Am Abend wurde das Paar von der ganzen
Hochzeitsgesellschaft in die Kammer geleitet. Ihre bis dahin offen ge-
tragenen Haare bekleidete die junge Frau am nächsten Tage mit einer
Haube, daher der Ausdruck „unter die Haube kommen". Auch dieser
Tag, an dem der junge Gatte seine Frau mit der Morgengabe be-
schenkte, war noch ein Festtag, dem bei reicheren Leuten noch weitere
folgten, so viele oft, daß gar gesetzliche Einschränkungen nötig wurden.
DasBuchfürAlle
457
nehmen können, währenddessen vertrete ich Ihre Stelle. Auf
weiteres!"
Rosenbauer brauchte Fräulein Zingst nicht lange zu suchen,
denn sie stand auf dem Gang in tausend Ängsten um ihren Herrn
und unsicher, ob sie anklopfen dürfe oder nicht.
„Hat der Herr Baron sich beim Sturz etwas gebrochen?
Wie ist denn das gekommen?" fragte sie Rosenbauer, der sich
erst versicherte, daß niemand in der
Nähe sei, und die gute Seele dann be¬
ruhigte.
„Natürlich hat er sich ein wenig ge¬
klopft, aber das ist nicht schlimm. Unter
uns, Fräulein Zingst, er hatte wieder
eine Ohnmacht, aber davon wollen wir
lieber nichts sagen, damit kein unnötiger
Tratsch entsteht, der Herrn v. Elbenborn
sehr unangenehm wäre. Sie wissen,
wir Männer lieben das nicht. Er schläft
jetzt ruhige behütet von Herrn Römer,
und wenn er aufwacht, lasse ich's Ihnen
sagen, damit Sie ihm etwas Gutes,
Leichtes zurechtmachen. Das bringen
Sie ihm dann selbst herauf, nicht wahr?
Aber lassen Sie sich's nicht von Fräulein
Pilar abnehmen, ja nicht, denn die ist
viel zu lebhaft für einen Menschen, der
Ruhe braucht, und würde ihn mit ihrem
Eepappel und Herumgeflitze doch nur
aufregen."
„Ich verstehe! Soll besorgt werden,
Herr Doktor. Aber man wird doch
dem Herrn Sanitätsrat telephonieren
müssen. Sie verzeihen, wenn ich mich
da hineinmische, aber das geht doch
wahrhaftig nicht, daß der Herr Baron so ohne Arzt ..."
„Pscht I" machte Rosenbauer. „Ich will Ihnen ein Geheimnis
anvertrauen: Herr Römer ist Arzt und noch dazu ein ganz
ausgezeichneter. Herr v. Eibenborn wünschte nur nicht, dasz es
im Hause bekannt würde, weil er nicht für kränker gehalten
werden will, als er wirklich ist — na, Sie wissen ja, wie die Herren
in diesem Punkte sind. Und er wollte auch nicht, daß Fräulein
Pilar sich unnötig aufregt und ängstigt ..."
„Die und sich ängstigen?" fiel Fräulein Zingst mit unver-
hohlener Verachtung ein. „Ich traf sie unten, nachdem ich gehört,
dah der Herr Baron im Garten hingefallen sei, was der Gärtner-
bursche erzählt hat, der geholfen, den Herrn Baron hereinzu-
tragen. Der Esel hat gedacht, der Herr Baron sei mausetot,
und nun meine Aufregung I Daß ich nicht reinweg umgefallen
bin, begreife ich jetzt noch nicht, aber der Herr Baron liebt so
was nicht, und so nahm ich mich zusammen und lief nach vorn
und begegnete da dem gnädigen Fräu-
lein und erlaubte mir zu fragen, ob
sie schon gehört hätte ... Wissen Sie,
was sie getan hat? Mit den Achseln
hat sie gezuckt — so — und geantwortet:
,Sein nur etwas hingefallt, mein Onkel,
macht nichts. Gehen Sie nur oben,
und fragen Sie der Doktor, der sein
viel grober Mensch!' Ja, das hat sie
gesagt, und dann ging sie singend weiter.
Quietschvergnügt!"
„Na, lassen wir sie dabei," beruhigte
Rosenbauer die Empörte. „Ist immer
noch besser, als wenn sie Herrn v. Elben-
born mit ihrer Fusseligkeit aufregt und
bei ihm herumschwänzelt,' er mutz un-
bedingt Ruhe haben. Also halten Sie's,
wie wir's verabredet haben, nicht wahr?
Und über die Ohnmacht und Doktor
Römer keinen Ton, Fräulein Zingst,
sonst setzt's ein Donnerwetter von Herrn
v. Elbenborn, nicht nur für Sie, son-
dern auch für mich, weil ich aus der
Schule geschwatzt habe."
Pilar nahm die Nachricht, daß ihr
Onkel nicht zum Abendtisch erscheinen
würde, mit oberflächlich höflichem Be-
dauern auf; sie fragte nicht weiter über die näheren Umstände
seines Unfalls und begann sich mit Doktor Römer zu unter-
halten. Daß Doktor Rosenbauer fehlte, konnte sie sich nicht
versagen, mit boshafter Freude festzustellen.
„Es sein mich lieb, einmal ohne dieser unangenehme Person
zu speisen," sagte sie unverblümt. „Verdirbt mich immer das
Appetit, wenn ich sehe ihn an. Kann nicht begreifen, daß mein
Onkel Herberto ihm kann leiden — ich mögen ihn nicht. Er soll
nicht mehr kommen in diese Haus!" «Fortsetzung folgt.»
Scherenschnitt von O. Kubel. Rotkäppchen.
Zu unseren Bildern
7 Der Hochzeitszug (S. 450—451). — Wenn wir heute von Hochzeit
sprechen, so verstehen wir unter diesem Wort einzig und allein die Ver-
mählung; im Mittelalter aber bedeutete „hochgezit" jede festliche Zeit
des Jahres. In jenen Zeiten sagte man bei einer Vermählung „Braut-
lauf" halten; angeblich stammt dieser Ausdruck daher, weil nach alter
Sitte die Braut durch Wettspiele errungen werden mutzte, wie Brun-
Hilde im Nibelungenlied. Daß sich für dieses hohe Fest mancherlei streng
innegehaltene Bräuche entwickelten, die zum Teil noch heute Gültig-
keit haben, ist verständlich. Immerhin sind sie aber auch Wandlungen
unterworfen gewesen, die von einschneidender Wirkung waren. Dem
Vrautlauf mutzten stets der Brautkauf und die Verlobung voraufgehen.
Der Brautkauf war die erste und notwendigste gesetzliche Leistung für die
Eheschließung; er ist die Bedingung für den Übertritt der Braut in das
Geschlecht und den Schutz des Bräutigams. Die Höhe des Kaufschatzes
unterlag der besonderen Vereinbarung; später erhielt dieser Kauf eine
symbolische Bedeutung. Dafür empfing die Braut von den Eltern oder
Verwandten eine Mitgift, „heimstiur", in Form der Aussteuer. Vor
Zeugen erfolgte darauf die Verlobung unter dem Tausch symbolischer
Pfänder, und zwar gab im frühen Mittelalter der Bräutigam allein einen
Ring der Braut. Binnen bestimmter gesetzlicher Frist mutzte nun der
Brautlauf folgen, sollte das Verlöbnis nicht nichtig werden. Im Spät-
herbst oder zu Winters Anfang, wenn Scheuer und Keller gefüllt waren,
erfolgte dann meistens die Hochzeit, und zwar hielt man nach uraltem
Glauben den Dienstag oder Donnerstag für die besten Tage dazu. Die
Gäste wurden mehr und mehr in so hoher Zahl geladen und so großer
Aufwand entfaltet, daß schließlich dieser Verschwendung durch Gesetze
Einhalt geboten werden mutzte. Nach der brandenburgischen Verordnung
von 1334 durften höchstens achtzig Gäste geladen und vierzig Schüsseln
gereicht werden. Im Hause der Braut fand die Übergabe und die Trauung
statt, als die kirchliche Weihe noch nicht allgemein und Bedingung war,
und das trat viel später ein, als man für gewöhnlich annimmt. Noch
1291 machte Erzbischof Konrad von Salzburg für seinen großen Sprengel
das Zugeständnis, daß die Kirche befriedigt sein wolle, wem: dem Pfarrer
binnen Monatsfrist Anzeige von der geschlossenen Ehe gemacht würde.
Allmählich aber drang die Geistlichkeit mit ihrem Verlangen, daß die
Trauung in der Kirche durch den Priester vollzogen werde, durch. Nun
entstand der prunkvolle Hochzeitszug zum Gotteshaus, der in jener Zeit
des Rittertums so malerische Bilder bot, besonders wenn ein regierendes
Paar den Brautlauf hielt. Unter Vorantragung der Wappen der Neu-
vermählten und der Hochzeitsgeschenke und unter Geleit der Gäste und
der reisigen Lehnsmannen bewegte sich der Zug zum Hause des jungen
Gatten, wo das Festmahl gerichtet war. Nach dessen Beendigung kam der
Tanz zu seinem Rechte, der ja meistens damals ein Reigen war, zu dem
die Musikanten aufspielten. Am Abend wurde das Paar von der ganzen
Hochzeitsgesellschaft in die Kammer geleitet. Ihre bis dahin offen ge-
tragenen Haare bekleidete die junge Frau am nächsten Tage mit einer
Haube, daher der Ausdruck „unter die Haube kommen". Auch dieser
Tag, an dem der junge Gatte seine Frau mit der Morgengabe be-
schenkte, war noch ein Festtag, dem bei reicheren Leuten noch weitere
folgten, so viele oft, daß gar gesetzliche Einschränkungen nötig wurden.