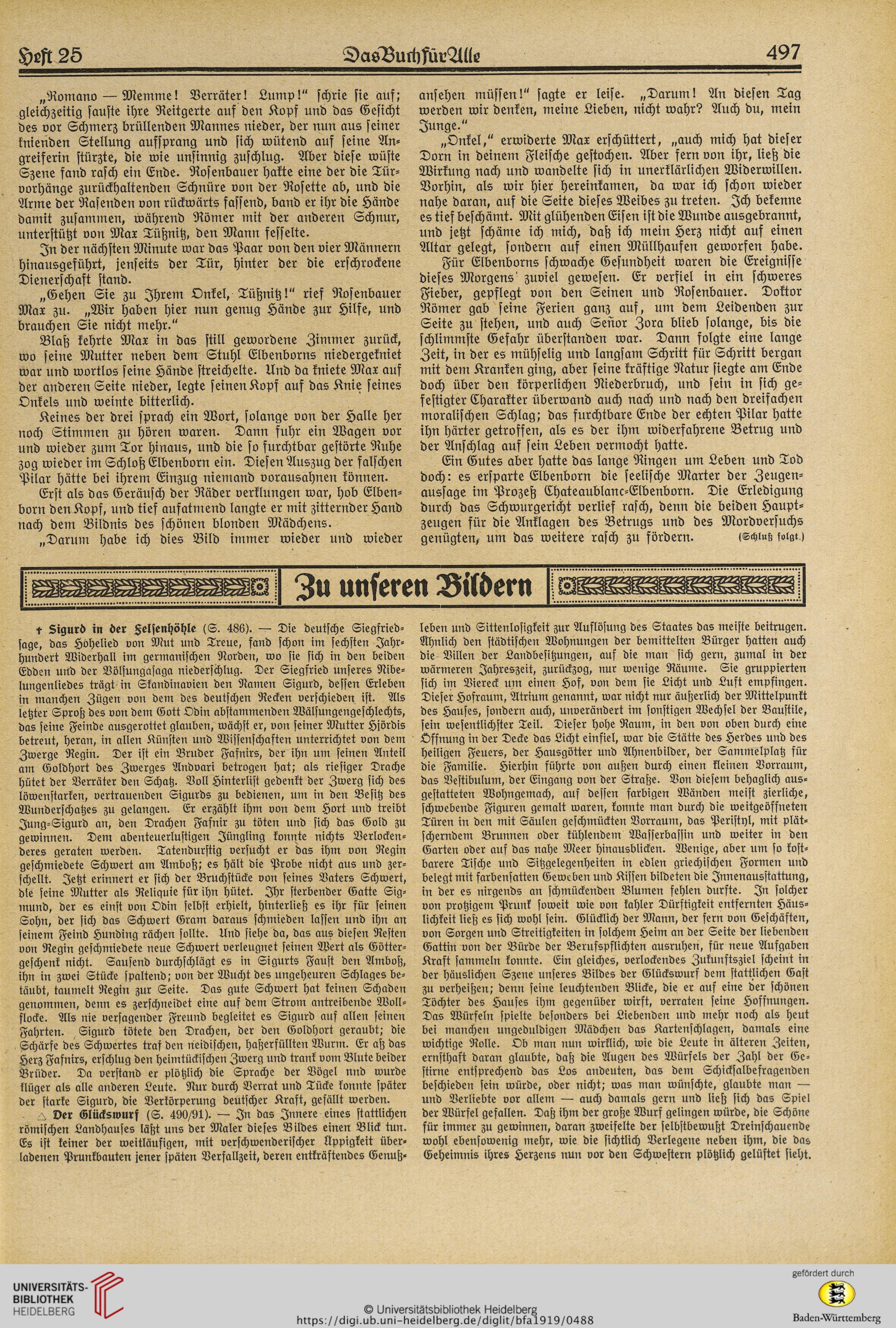Heft 25
DasBuchfüvAlle
497
„Romano — Memme! Verräter! Lump!" schrie sie auf;
gleichzeitig sauste ihre Reitgerte auf den Kopf und das Gesicht
des vor Schmerz brüllenden Mannes nieder, der nun aus seiner
knienden Stellung aufsprang und sich wütend auf seine An-
greiferin stürzte, die wie unsinnig zuschlug. Aber diese wüste
Szene fand rasch ein Ende. Rosenbauer hakte eine der die Tür-
vorhänge zurückhaltenden Schnüre von der Rosette ab, und die
Arme der Rasenden von rückwärts fassend, band er ihr die Hände
damit zusammen, während Römer mit der anderen Schnur,
unterstützt von Mar Tüßnitz, den Mann fesselte.
In der nächsten Minute war das Paar von den vier Männern
hinausgeführt, jenseits der Tür, hinter der die erschrockene
Dienerschaft stand.
„Gehen Sie zu Ihrem Onkel, Tüßnitz!" rief Rosenbauer
Mar zu. „Wir haben hier nun genug Hände zur Hilfe, und
brauchen Sie nicht mehr."
Blaß kehrte Mar in das still gewordene Zimmer zurück,
wo seine Mutter neben dem Stuhl Elbenborns niedergekniet
war und wortlos seine Hände streichelte. Und da kniete Mar auf
der anderen Seite nieder, legte seinen Kopf auf das Knie seines
Onkels und weinte bitterlich.
Keines der drei sprach ein Wort, solange von der Halle her
noch Stimmen zu hören waren. Dann fuhr ein Wagen vor
und wieder zum Tor hinaus, und die so furchtbar gestörte Ruhe
zog wieder im Schloß Eibenborn ein. Diesen Auszug der falschen
Pilar Hütte bei ihrem Einzug niemand vorausahnen können.
Erst als das Geräusch der Räder verklungen war, hob Elben-
born den Kopf, und tief aufatmend langte er mit zitternder Hand
nach dem Bildnis des schönen blonden Mädchens.
„Darum habe ich dies Bild immer wieder und wieder
ansehen müssen!" sagte er leise. „Darum! An diesen Tag
werden wir denken, meine Lieben, nicht wahr? Auch du, mein
Junge."
„Onkel," erwiderte Mar erschüttert, „auch mich hat dieser
Dorn in deinem Fleische gestochen. Aber fern von ihr, ließ die
Wirkung nach und wandelte sich in unerklärlichen Widerwillen.
Vorhin, als wir hier hereinkamen, da war ich schon wieder
nahe daran, auf die Seite dieses Weibes zu treten. Ich bekenne
es tief beschämt. Mit glühenden Eisen ist die Wunde ausgebrannt,
und jetzt schäme ich mich, daß ich mein Herz nicht auf einen
Altar gelegt, sondern auf einen Müllhaufen geworfen habe.
Für Elbenborns schwache Gesundheit waren die Ereignisse
dieses Morgens' zuviel gewesen. Er verfiel in ein schweres
Fieber, gepflegt von den Seinen und Rosenbauer. Doktor
Römer gab seine Ferien ganz auf, um dem Leidenden zur
Seite zu stehen, und auch Senor Zora blieb solange, bis die
schlimmste Gefahr überstanden war. Dann folgte eine lange
Zeit, in der es mühselig und langsam Schritt für Schritt bergan
mit dem Kranken ging, aber seine kräftige Natur siegte am Ende
doch über den körperlichen Niederbruch, und sein in sich ge-
festigter Charakter überwand auch nach und nach den dreifachen
moralischen Schlag; das furchtbare Ende der echten Pilar hatte
ihn härter getroffen, als es der ihm widerfahrene Betrug und
der Anschlag auf sein Leben vermocht hatte.
Ein Gutes aber hatte das lange Ringen um Leben und Tod
doch: es ersparte Elbenborn die seelische Marter der Zeugen-
aussage im Prozeß Chateaublanc-Elbenborn. Die Erledigung
durch das Schwurgericht verlief rasch, denn die beiden Haupt-
zeugen für die Anklagen des Betrugs und des Mordversuchs
genügten, um das weitere rasch zu fördern. iSHlub folgt.»
ZU unseren Bildern
-t Sigurd in der Felsenhöhle (S. 486). — Die deutsche Siegfried-
sage, das Hohelied von Mut und Treue, fand schon im sechsten Jahr-
hundert Widerhall im germanischen Norden, wo sie sich in den beiden
Edden und der Völsungasaga niederschlug. Der Siegfried unseres Nibe-
lungenliedes trägt in Skandinavien den Namen Sigurd, dessen Erleben
in manchen Zügen von dem des deutschen Recken verschieden ist. Als
letzter Sproß des von dem Gott Odin abstammenden Wälsungengeschlechts,
das seine Feinde ausgerottet glauben, wächst er, von seiner Mutter Hjördis
betreut, heran, in allen Künsten und Wissenschaften unterrichtet von dem
Zwerge Regin. Der ist ein Bruder Fafnirs, der ihn um seinen Anteil
am Eoldhort des Zwerges Andvari betrogen hat; als riesiger Drache
hütet der Verräter den Schah. Voll Hinterlist gedenkt der Zwerg sich des
löwenstarken, vertrauenden Sigurds zu bedienen, um in den Besitz des
Wunderschatzes zu gelangen. Er erzählt ihm von dem Hort und treibt
Jung-Sigurd an, den Drachen Fasnir zu töten und sich das Gold zu
gewinnen. Dem abenteuerlustigen Jüngling konnte nichts Verlocken-
deres geraten werden. Tatendurstig versucht er das ihm von Regin
geschmiedete Schwert am Amboß; es hält die Probe nicht aus und zer-
schellt. Jetzt erinnert er sich der Bruchstücke von seines Vaters Schwert,
die seine Mutter als Reliquie für ihn hütet. Ihr sterbender Gatte Sig-
mund, der es einst von Odin selbst erhielt, hinterließ es ihr für seinen
Sohn, der sich das Schwert Gram daraus schmieden lassen und ihn an
seinem Feind Hunding rächen sollte. Und siehe da, das aus diesen Resten
von Regin geschmiedete neue Schwert verleugnet seinen Wert als Götter-
geschenk nicht. Sausend durchschlägt es in Sigurts Faust den Amboß,
ihn in zwei Stücke spaltend; von der Wucht des ungeheuren Schlages be-
täubt, taumelt Regin zur Seite. Das gute Schwert hat keinen Schaden
genommen, denn es zerschneidet eine auf dem Strom antreibende Woll-
flocke. Als nie versagender Freund begleitet es Sigurd auf allen seinen
Fahrten. Sigurd tötete den Drachen, der den Goldhort geraubt; die
Schärfe des Schwertes traf den neidischen, haßerfüllten Wurm. Er aß das
Herz Fafnirs, erschlug den heimtückischen Zwerg und trank vom Blute beider
Brüder. Da verstand er plötzlich die Sprache der Vögel nnd wurde
klüger als alle anderen Leute. Nur durch Verrat und Tücke konnte später
der starke Sigurd, die Verkörperung deutscher Kraft, gefällt werden.
Der Glückswurf (S. 490/91). — In das Innere eines stattlichen
römischen Landhauses läßt uns der Maler dieses Bildes einen Blick tun.
Ls ist keiner der weitläufigen, mit verschwenderischer Üppigkeit über-
ladenen Prunkbauten jener späten Verfallzeit, deren entkräftendes Genuß-
leben und Sittenlosigkeit zur Auflösung des Staates das meiste beitrugen.
Ähnlich den städtischen Wohnungen der bemittelten Bürger hatten auch
die Villen der Landbesitzungen, auf die man sich gern, zumal in der
wärmeren Jahreszeit, zurückzog, nur wenige Räume. Sie gruppierten
sich im Viereck um einen Hof, von dem sie Licht und Luft empfingen.
Dieser Hofraum, Atrium genannt, war nicht nur äußerlich der Mittelpunkt
des Hauses, sondern auch, unverändert im sonstigen Wechsel der Baustile,
sein wesentlichster Teil. Dieser hohe Raum, in den von oben durch eine
Öffnung in der Decke das Licht einfiel, war die Stätte des Herdes und des
heiligen Feuers, der Hausgötter und Ahnenbilder, der Sammelplatz für
die Familie. Hierhin führte von außen durch einen kleinen Vorraum,
das Vestibulum, der Eingang von der Straße. Von diesem behaglich aus-
gestatteten Wohngemach, auf dessen farbigen Wänden meist zierliche,
schwebende Figuren gemalt waren, konnte nian durch die weitgeöffneten
Türen in den mit Säulen geschmückten Vorraum, das Peristyl, mit plät-
scherndem Brunnen oder kühlendem Wasserbassin und weiter in den
Garten oder auf das nahe Meer hinausblicken. Wenige, aber um so kost-
barere Tische und Sitzgelegenheiten in edlen griechischen Formen und
belegt mit farbensatten Geweben und Kissen bildeten die Innenausstattung,
in der es nirgends an schmückenden Blumen fehlen durfte. In solcher
von protzigem Prunk soweit wie von kahler Dürftigkeit entfernten Häus-
lichkeit ließ es sich wohl sein. Glücklich der Mann, der fern von Geschäften,
von Sorgen und Streitigkeiten in solchem Heim an der Seite der liebenden
Gattin von der Bürde der Berufspflichten ausruhen, für neue Aufgaben
Kraft sammeln konnte. Ein gleiches, verlockendes Zukunftsziel scheint in
der häuslichen Szene unseres Bildes der Glückswurf dem stattlichen East
zu verheißen; denn seine leuchtenden Blicke, die er auf eine der schönen
Töchter des Hauses ihm gegenüber wirft, verraten seine Hoffnungen.
Das Würfeln spielte besonders bei Liebenden und mehr noch als heut
bei manchen ungeduldigen Mädchen das Kartenschlagen, damals eine
wichtige Rolle. Ob man nun wirklich, wie die Leute in älteren Zeiten,
ernsthaft daran glaubte, daß die Augen des Würfels der Zahl der Ge-
stirne entsprechend das Los andeuten, das dem Schicksalbefragenden
beschieden sein würde, oder nicht; was man wünschte, glaubte man —
und Verliebte vor allem — auch damals gern und ließ sich das Spiel
der Würfel gefallen. Daß ihm der große Wurf gelingen würde, die Schöne
für immer zu gewinnen, daran zweifelte der selbstbewußt Dreinschauende
wohl ebensowenig mehr, wie die sichtlich Verlegene neben ihm, die das
Geheimnis ihres Herzens nun vor den Schwestern plötzlich gelüftet sieht.
DasBuchfüvAlle
497
„Romano — Memme! Verräter! Lump!" schrie sie auf;
gleichzeitig sauste ihre Reitgerte auf den Kopf und das Gesicht
des vor Schmerz brüllenden Mannes nieder, der nun aus seiner
knienden Stellung aufsprang und sich wütend auf seine An-
greiferin stürzte, die wie unsinnig zuschlug. Aber diese wüste
Szene fand rasch ein Ende. Rosenbauer hakte eine der die Tür-
vorhänge zurückhaltenden Schnüre von der Rosette ab, und die
Arme der Rasenden von rückwärts fassend, band er ihr die Hände
damit zusammen, während Römer mit der anderen Schnur,
unterstützt von Mar Tüßnitz, den Mann fesselte.
In der nächsten Minute war das Paar von den vier Männern
hinausgeführt, jenseits der Tür, hinter der die erschrockene
Dienerschaft stand.
„Gehen Sie zu Ihrem Onkel, Tüßnitz!" rief Rosenbauer
Mar zu. „Wir haben hier nun genug Hände zur Hilfe, und
brauchen Sie nicht mehr."
Blaß kehrte Mar in das still gewordene Zimmer zurück,
wo seine Mutter neben dem Stuhl Elbenborns niedergekniet
war und wortlos seine Hände streichelte. Und da kniete Mar auf
der anderen Seite nieder, legte seinen Kopf auf das Knie seines
Onkels und weinte bitterlich.
Keines der drei sprach ein Wort, solange von der Halle her
noch Stimmen zu hören waren. Dann fuhr ein Wagen vor
und wieder zum Tor hinaus, und die so furchtbar gestörte Ruhe
zog wieder im Schloß Eibenborn ein. Diesen Auszug der falschen
Pilar Hütte bei ihrem Einzug niemand vorausahnen können.
Erst als das Geräusch der Räder verklungen war, hob Elben-
born den Kopf, und tief aufatmend langte er mit zitternder Hand
nach dem Bildnis des schönen blonden Mädchens.
„Darum habe ich dies Bild immer wieder und wieder
ansehen müssen!" sagte er leise. „Darum! An diesen Tag
werden wir denken, meine Lieben, nicht wahr? Auch du, mein
Junge."
„Onkel," erwiderte Mar erschüttert, „auch mich hat dieser
Dorn in deinem Fleische gestochen. Aber fern von ihr, ließ die
Wirkung nach und wandelte sich in unerklärlichen Widerwillen.
Vorhin, als wir hier hereinkamen, da war ich schon wieder
nahe daran, auf die Seite dieses Weibes zu treten. Ich bekenne
es tief beschämt. Mit glühenden Eisen ist die Wunde ausgebrannt,
und jetzt schäme ich mich, daß ich mein Herz nicht auf einen
Altar gelegt, sondern auf einen Müllhaufen geworfen habe.
Für Elbenborns schwache Gesundheit waren die Ereignisse
dieses Morgens' zuviel gewesen. Er verfiel in ein schweres
Fieber, gepflegt von den Seinen und Rosenbauer. Doktor
Römer gab seine Ferien ganz auf, um dem Leidenden zur
Seite zu stehen, und auch Senor Zora blieb solange, bis die
schlimmste Gefahr überstanden war. Dann folgte eine lange
Zeit, in der es mühselig und langsam Schritt für Schritt bergan
mit dem Kranken ging, aber seine kräftige Natur siegte am Ende
doch über den körperlichen Niederbruch, und sein in sich ge-
festigter Charakter überwand auch nach und nach den dreifachen
moralischen Schlag; das furchtbare Ende der echten Pilar hatte
ihn härter getroffen, als es der ihm widerfahrene Betrug und
der Anschlag auf sein Leben vermocht hatte.
Ein Gutes aber hatte das lange Ringen um Leben und Tod
doch: es ersparte Elbenborn die seelische Marter der Zeugen-
aussage im Prozeß Chateaublanc-Elbenborn. Die Erledigung
durch das Schwurgericht verlief rasch, denn die beiden Haupt-
zeugen für die Anklagen des Betrugs und des Mordversuchs
genügten, um das weitere rasch zu fördern. iSHlub folgt.»
ZU unseren Bildern
-t Sigurd in der Felsenhöhle (S. 486). — Die deutsche Siegfried-
sage, das Hohelied von Mut und Treue, fand schon im sechsten Jahr-
hundert Widerhall im germanischen Norden, wo sie sich in den beiden
Edden und der Völsungasaga niederschlug. Der Siegfried unseres Nibe-
lungenliedes trägt in Skandinavien den Namen Sigurd, dessen Erleben
in manchen Zügen von dem des deutschen Recken verschieden ist. Als
letzter Sproß des von dem Gott Odin abstammenden Wälsungengeschlechts,
das seine Feinde ausgerottet glauben, wächst er, von seiner Mutter Hjördis
betreut, heran, in allen Künsten und Wissenschaften unterrichtet von dem
Zwerge Regin. Der ist ein Bruder Fafnirs, der ihn um seinen Anteil
am Eoldhort des Zwerges Andvari betrogen hat; als riesiger Drache
hütet der Verräter den Schah. Voll Hinterlist gedenkt der Zwerg sich des
löwenstarken, vertrauenden Sigurds zu bedienen, um in den Besitz des
Wunderschatzes zu gelangen. Er erzählt ihm von dem Hort und treibt
Jung-Sigurd an, den Drachen Fasnir zu töten und sich das Gold zu
gewinnen. Dem abenteuerlustigen Jüngling konnte nichts Verlocken-
deres geraten werden. Tatendurstig versucht er das ihm von Regin
geschmiedete Schwert am Amboß; es hält die Probe nicht aus und zer-
schellt. Jetzt erinnert er sich der Bruchstücke von seines Vaters Schwert,
die seine Mutter als Reliquie für ihn hütet. Ihr sterbender Gatte Sig-
mund, der es einst von Odin selbst erhielt, hinterließ es ihr für seinen
Sohn, der sich das Schwert Gram daraus schmieden lassen und ihn an
seinem Feind Hunding rächen sollte. Und siehe da, das aus diesen Resten
von Regin geschmiedete neue Schwert verleugnet seinen Wert als Götter-
geschenk nicht. Sausend durchschlägt es in Sigurts Faust den Amboß,
ihn in zwei Stücke spaltend; von der Wucht des ungeheuren Schlages be-
täubt, taumelt Regin zur Seite. Das gute Schwert hat keinen Schaden
genommen, denn es zerschneidet eine auf dem Strom antreibende Woll-
flocke. Als nie versagender Freund begleitet es Sigurd auf allen seinen
Fahrten. Sigurd tötete den Drachen, der den Goldhort geraubt; die
Schärfe des Schwertes traf den neidischen, haßerfüllten Wurm. Er aß das
Herz Fafnirs, erschlug den heimtückischen Zwerg und trank vom Blute beider
Brüder. Da verstand er plötzlich die Sprache der Vögel nnd wurde
klüger als alle anderen Leute. Nur durch Verrat und Tücke konnte später
der starke Sigurd, die Verkörperung deutscher Kraft, gefällt werden.
Der Glückswurf (S. 490/91). — In das Innere eines stattlichen
römischen Landhauses läßt uns der Maler dieses Bildes einen Blick tun.
Ls ist keiner der weitläufigen, mit verschwenderischer Üppigkeit über-
ladenen Prunkbauten jener späten Verfallzeit, deren entkräftendes Genuß-
leben und Sittenlosigkeit zur Auflösung des Staates das meiste beitrugen.
Ähnlich den städtischen Wohnungen der bemittelten Bürger hatten auch
die Villen der Landbesitzungen, auf die man sich gern, zumal in der
wärmeren Jahreszeit, zurückzog, nur wenige Räume. Sie gruppierten
sich im Viereck um einen Hof, von dem sie Licht und Luft empfingen.
Dieser Hofraum, Atrium genannt, war nicht nur äußerlich der Mittelpunkt
des Hauses, sondern auch, unverändert im sonstigen Wechsel der Baustile,
sein wesentlichster Teil. Dieser hohe Raum, in den von oben durch eine
Öffnung in der Decke das Licht einfiel, war die Stätte des Herdes und des
heiligen Feuers, der Hausgötter und Ahnenbilder, der Sammelplatz für
die Familie. Hierhin führte von außen durch einen kleinen Vorraum,
das Vestibulum, der Eingang von der Straße. Von diesem behaglich aus-
gestatteten Wohngemach, auf dessen farbigen Wänden meist zierliche,
schwebende Figuren gemalt waren, konnte nian durch die weitgeöffneten
Türen in den mit Säulen geschmückten Vorraum, das Peristyl, mit plät-
scherndem Brunnen oder kühlendem Wasserbassin und weiter in den
Garten oder auf das nahe Meer hinausblicken. Wenige, aber um so kost-
barere Tische und Sitzgelegenheiten in edlen griechischen Formen und
belegt mit farbensatten Geweben und Kissen bildeten die Innenausstattung,
in der es nirgends an schmückenden Blumen fehlen durfte. In solcher
von protzigem Prunk soweit wie von kahler Dürftigkeit entfernten Häus-
lichkeit ließ es sich wohl sein. Glücklich der Mann, der fern von Geschäften,
von Sorgen und Streitigkeiten in solchem Heim an der Seite der liebenden
Gattin von der Bürde der Berufspflichten ausruhen, für neue Aufgaben
Kraft sammeln konnte. Ein gleiches, verlockendes Zukunftsziel scheint in
der häuslichen Szene unseres Bildes der Glückswurf dem stattlichen East
zu verheißen; denn seine leuchtenden Blicke, die er auf eine der schönen
Töchter des Hauses ihm gegenüber wirft, verraten seine Hoffnungen.
Das Würfeln spielte besonders bei Liebenden und mehr noch als heut
bei manchen ungeduldigen Mädchen das Kartenschlagen, damals eine
wichtige Rolle. Ob man nun wirklich, wie die Leute in älteren Zeiten,
ernsthaft daran glaubte, daß die Augen des Würfels der Zahl der Ge-
stirne entsprechend das Los andeuten, das dem Schicksalbefragenden
beschieden sein würde, oder nicht; was man wünschte, glaubte man —
und Verliebte vor allem — auch damals gern und ließ sich das Spiel
der Würfel gefallen. Daß ihm der große Wurf gelingen würde, die Schöne
für immer zu gewinnen, daran zweifelte der selbstbewußt Dreinschauende
wohl ebensowenig mehr, wie die sichtlich Verlegene neben ihm, die das
Geheimnis ihres Herzens nun vor den Schwestern plötzlich gelüftet sieht.