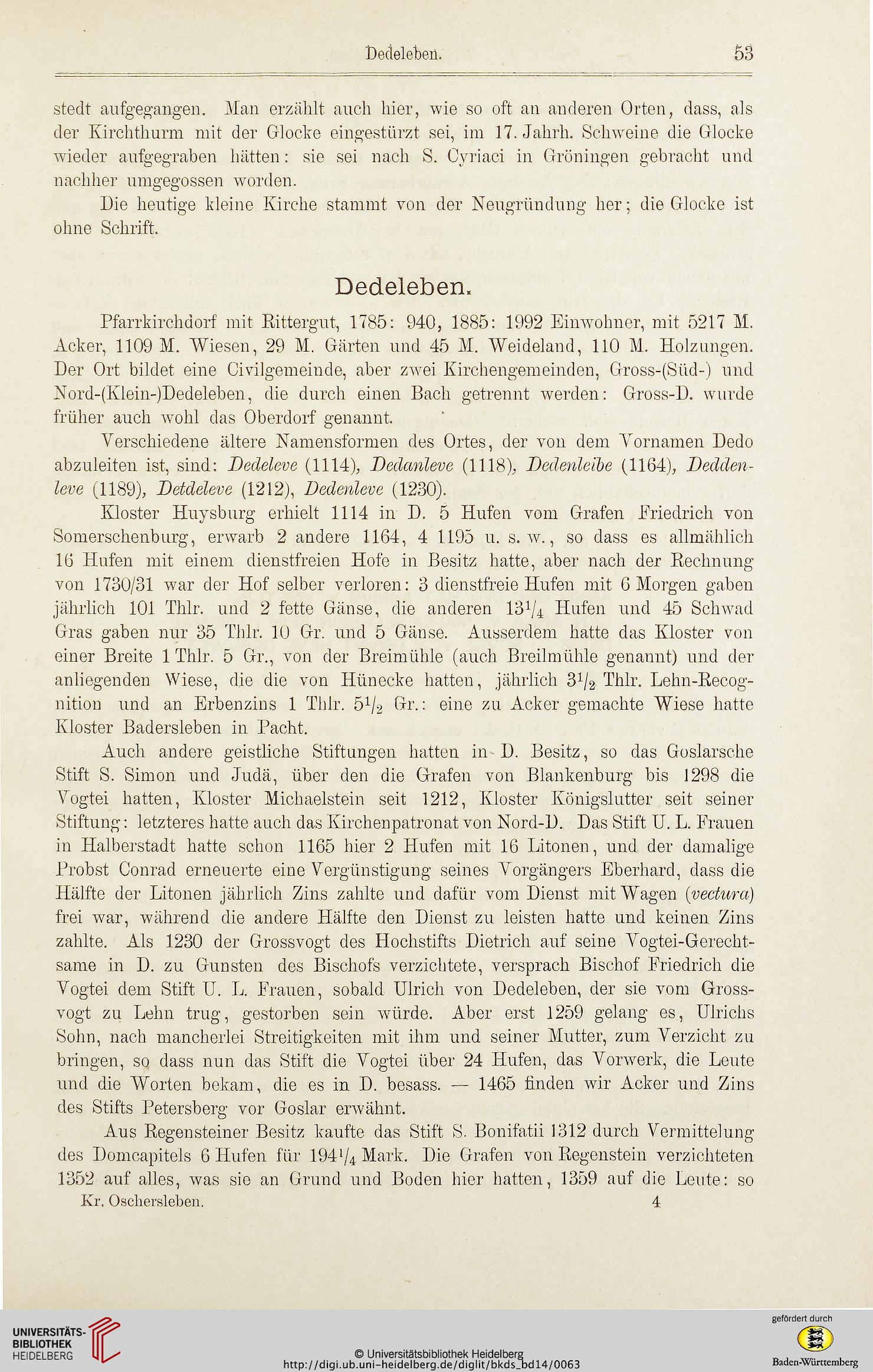Dedeleben.
53
stedt aufgegangen. Man erzählt auch hier, wie so oft an anderen Orten, dass, als
der Kirchthurm mit der Glocke eingestürzt sei, im 17. Jahrh. Schweine die Glocke
wieder aufgegraben hätten: sie sei nach S. Cyriaci in Groningen gebracht und
nachher umgegossen worden.
Die heutige kleine Kirche stammt von der Neugründung her; die Glocke ist
ohne Schrift.
Dedeleben.
Pfarrkirchdorf mit Rittergut, 1785: 940, 1885: 1992 Einwohner, mit 5217 M.
Acker, 1109 M. Wiesen, 29 M. Gärten und 45 M. Weideland, 110 M. Holzungen.
Der Ort bildet eine Civilgemeinde, aber zwei Kirchengemeinden, Gross-(Süd-) und
Nord-(Klein-)Dedeleben, die durch einen Bach getrennt werden: Gross-D. wurde
früher auch wohl das Oberdorf genannt.
Verschiedene ältere Namensformen des Ortes, der von dem Vornamen Dedo
abzuleiten ist, sind: Dedeleve (1114), Declanleve (1118), Dedenleibe (1164), Dedden-
leve (1189), Detdeleve (1212), Dedenleve (1230).
Kloster Huysburg erhielt 1114 in D. 5 Hufen vom Grafen Friedrich von
Somerschenburg, erwarb 2 andere 1164, 4 1195 u. s. w., so dass es allmählich
16 Hufen mit einem dienstfreien Hofe in Besitz hatte, aber nach der Rechnung
von 1730/31 war der Hof selber verloren: 3 dienstfreie Hufen mit 6 Morgen gaben
jährlich 101 Thlr. und 2 fette Gänse, die anderen 13^4 Hufen und 45 Schwad
Gras gaben nur 35 Thlr. 10 Gr. und 5 Gänse. Ausserdem hatte das Kloster von
einer Breite 1 Thlr. 5 Gr., von der Breimühle (auch Breilmühle genannt) und der
anliegenden Wiese, die die von Hünecke hatten, jährlich 3^2 Thlr. Lehn-Recog-
nition und an Erbenzins 1 Thlr. 5^2 Gr.: eine zu Acker gemachte Wiese hatte
Kloster Badersleben in Pacht.
Auch andere geistliche Stiftungen hatten in D. Besitz, so das Goslarsche
Stift S. Simon und Judä, über den die Grafen von Blankenburg bis 1298 die
Vogtei hatten, Kloster Michaelstein seit 1212, Kloster Königslutter seit seiner
Stiftung: letzteres hatte auch das Kirchenpatronat von Nord-D. Das Stift U. L. Frauen
in Halberstadt hatte schon 1165 hier 2 Hufen mit 16 Litonen, und der damalige
Probst Conrad erneuerte eine Vergünstigung seines Vorgängers Eberhard, dass die
Hälfte der Litonen jährlich Zins zahlte und dafür vom Dienst mit Wagen (vectura)
frei war, während die andere Hälfte den Dienst zu leisten hatte und keinen Zins
zahlte. Als 1230 der Grossvogt des Hochstifts Dietrich auf seine Vogtei-Gerecht-
same in D. zu Gunsten des Bischofs verzichtete, versprach Bischof Friedrich die
Vogtei dem Stift U. L. Frauen, sobald Ulrich von Dedeleben, der sie vom Gross-
vogt zu Lehn trug, gestorben sein würde. Aber erst 1259 gelang es, Ulrichs
Sohn, nach mancherlei Streitigkeiten mit ihm und seiner Mutter, zum Verzicht zu
bringen, sq dass nun das Stift die Vogtei über 24 Hufen, das Vorwerk, die Leute
und die Worten bekam, die es in D. besass. — 1465 finden wir Acker und Zins
des Stifts Petersberg vor Goslar erwähnt.
Aus Regensteiner Besitz kaufte das Stift S. Bonifatii 1312 durch Vermittelung
des Domcapitels 6 Hufen für 194% Mark. Die Grafen von Regenstein verzichteten
1352 auf alles, was sie an Grund und Boden hier hatten, 1359 auf die Leute: so
Kr. Oscliersleben. 4
53
stedt aufgegangen. Man erzählt auch hier, wie so oft an anderen Orten, dass, als
der Kirchthurm mit der Glocke eingestürzt sei, im 17. Jahrh. Schweine die Glocke
wieder aufgegraben hätten: sie sei nach S. Cyriaci in Groningen gebracht und
nachher umgegossen worden.
Die heutige kleine Kirche stammt von der Neugründung her; die Glocke ist
ohne Schrift.
Dedeleben.
Pfarrkirchdorf mit Rittergut, 1785: 940, 1885: 1992 Einwohner, mit 5217 M.
Acker, 1109 M. Wiesen, 29 M. Gärten und 45 M. Weideland, 110 M. Holzungen.
Der Ort bildet eine Civilgemeinde, aber zwei Kirchengemeinden, Gross-(Süd-) und
Nord-(Klein-)Dedeleben, die durch einen Bach getrennt werden: Gross-D. wurde
früher auch wohl das Oberdorf genannt.
Verschiedene ältere Namensformen des Ortes, der von dem Vornamen Dedo
abzuleiten ist, sind: Dedeleve (1114), Declanleve (1118), Dedenleibe (1164), Dedden-
leve (1189), Detdeleve (1212), Dedenleve (1230).
Kloster Huysburg erhielt 1114 in D. 5 Hufen vom Grafen Friedrich von
Somerschenburg, erwarb 2 andere 1164, 4 1195 u. s. w., so dass es allmählich
16 Hufen mit einem dienstfreien Hofe in Besitz hatte, aber nach der Rechnung
von 1730/31 war der Hof selber verloren: 3 dienstfreie Hufen mit 6 Morgen gaben
jährlich 101 Thlr. und 2 fette Gänse, die anderen 13^4 Hufen und 45 Schwad
Gras gaben nur 35 Thlr. 10 Gr. und 5 Gänse. Ausserdem hatte das Kloster von
einer Breite 1 Thlr. 5 Gr., von der Breimühle (auch Breilmühle genannt) und der
anliegenden Wiese, die die von Hünecke hatten, jährlich 3^2 Thlr. Lehn-Recog-
nition und an Erbenzins 1 Thlr. 5^2 Gr.: eine zu Acker gemachte Wiese hatte
Kloster Badersleben in Pacht.
Auch andere geistliche Stiftungen hatten in D. Besitz, so das Goslarsche
Stift S. Simon und Judä, über den die Grafen von Blankenburg bis 1298 die
Vogtei hatten, Kloster Michaelstein seit 1212, Kloster Königslutter seit seiner
Stiftung: letzteres hatte auch das Kirchenpatronat von Nord-D. Das Stift U. L. Frauen
in Halberstadt hatte schon 1165 hier 2 Hufen mit 16 Litonen, und der damalige
Probst Conrad erneuerte eine Vergünstigung seines Vorgängers Eberhard, dass die
Hälfte der Litonen jährlich Zins zahlte und dafür vom Dienst mit Wagen (vectura)
frei war, während die andere Hälfte den Dienst zu leisten hatte und keinen Zins
zahlte. Als 1230 der Grossvogt des Hochstifts Dietrich auf seine Vogtei-Gerecht-
same in D. zu Gunsten des Bischofs verzichtete, versprach Bischof Friedrich die
Vogtei dem Stift U. L. Frauen, sobald Ulrich von Dedeleben, der sie vom Gross-
vogt zu Lehn trug, gestorben sein würde. Aber erst 1259 gelang es, Ulrichs
Sohn, nach mancherlei Streitigkeiten mit ihm und seiner Mutter, zum Verzicht zu
bringen, sq dass nun das Stift die Vogtei über 24 Hufen, das Vorwerk, die Leute
und die Worten bekam, die es in D. besass. — 1465 finden wir Acker und Zins
des Stifts Petersberg vor Goslar erwähnt.
Aus Regensteiner Besitz kaufte das Stift S. Bonifatii 1312 durch Vermittelung
des Domcapitels 6 Hufen für 194% Mark. Die Grafen von Regenstein verzichteten
1352 auf alles, was sie an Grund und Boden hier hatten, 1359 auf die Leute: so
Kr. Oscliersleben. 4