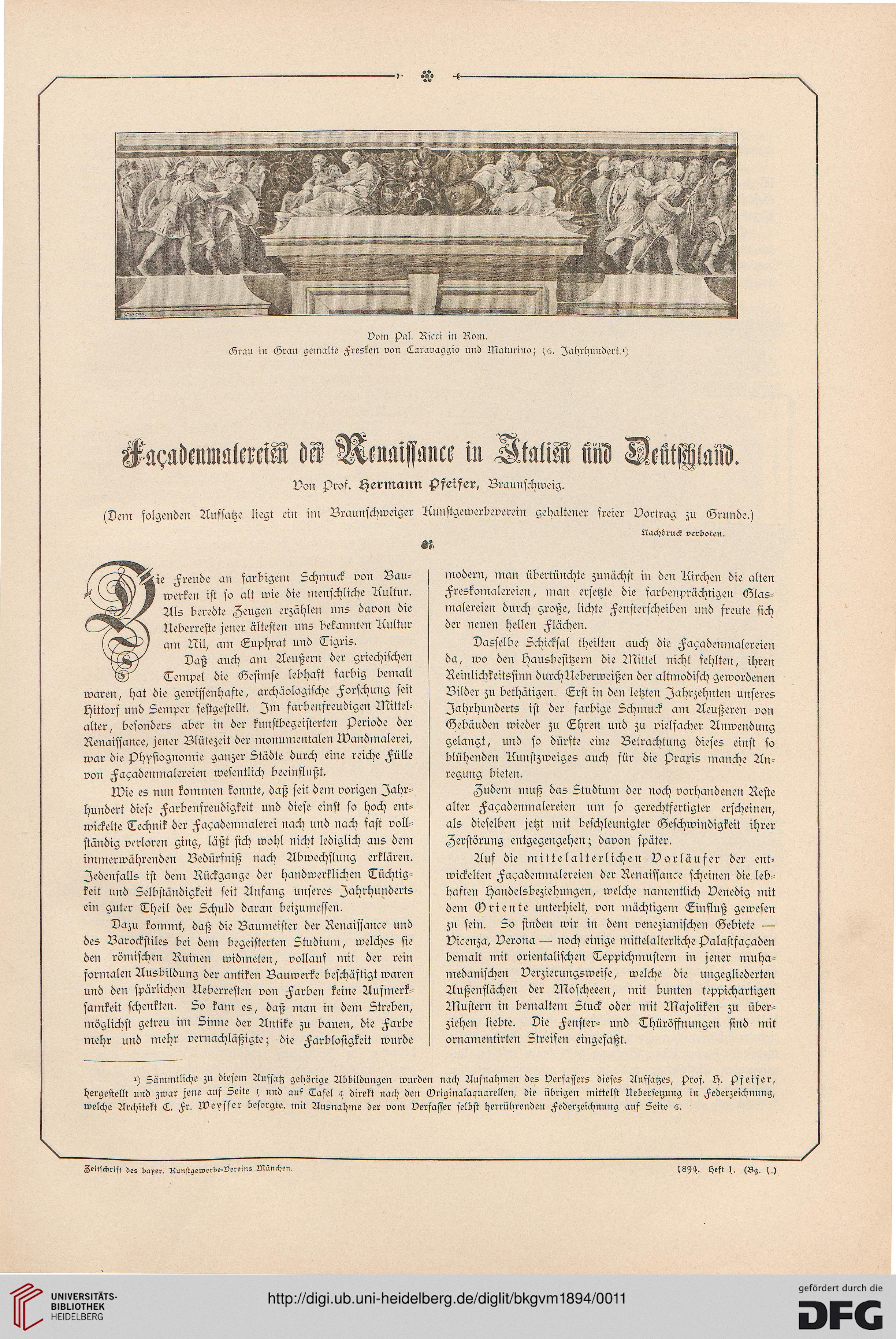Dom pal. Ricci in Rom.
Grau iu Grau gemalte Fresken van Laravaggio und Maturiuo; Jahrhundert.-)
aMdkmiuilerK -K Meiuliffiiiice in MaliN W DkAAlaM.
Von Prof. Hermann Pfeifer, Braunschweig.
(Den: folgenden Aufsatze liegt ein im
Braunschweiger Kunstgewerbeverein gehaltener freier Vortrag zu Grunde.)
Nachdruck verboten.
^/chA^Lie Freude an farbigem Schmuck von Bau-
VFMst I werken ist so alt wie die menschliche Kultur.
Als beredte Zeugen erzählen uns davon die
Ueberreste jener ältesten uns bekannten Kultur
am Nil, ant Euphrat uitd Tigris.
Daß auch am Aeußern der griechischen
Tempel die Gesintse lebhaft farbig bemalt
waren, hat die gewissenhafte, archäologische Forschuitg seit
Pittorf und Semper festgestellt. Jur farbenfreudigen Mittel-
alter, besonders aber in der kunstbegeisterten Periode der
Renaissance, jener Blütezeit der monumentalen Wandmalerei,
war die Physiognomie ganzer Städte durch eine reiche Fülle
von Facadenmalereien wesentlich beeinflußt.
wie es nun kommen konnte, daß seit dem vorigen Jahr-
hundert diese Farbenfreudigkeit und diese einst so hoch ent-
wickelte Technik der Facadenmalerei nach und nach fast voll-
ständig verloren ging, läßt sich wohl nicht lediglich aus dem
immerwährenden Bedürfniß nach Abwechslung erklären.
Jedenfalls ist dem Rückgänge der handwerklichen Tüchtig-
keit und Selbständigkeit seit Anfang unseres Jahrhunderts
ein guter Theil der Schuld daran beizumessen.
Dazu kommt, daß die Baumeister der Renaissance und
des Barockstiles bei dem begeisterten Studium, welches sie
den römischen Ruinen widmeten, vollauf mit der rein
formalen Ausbildung der antiken Bauwerke beschäftigt waren
und den spärlichen Ueberresten von Farben keine Aufmerk-
samkeit schenkten. So kam es, daß man in dem Streben,
möglichst getreu im Sinne der Antike zu bauen, die Farbe
mehr und mehr vernachläßigte; die Farblosigkeit wurde
modern, man übertünchte zunächst in den Kirchen die alten
Freskomalereien, man ersetzte die farbenprächtigen Glas-
malereien durch große, lichte Fensterscheiben und freute sich
der neuen Hellen Flächen.
Dasselbe Schicksal theilten auch die Facadenmalereien
da, wo den Hausbesitzern die Mittel nicht fehlten, ihren
Reinlichkeitssinn durchUeberweißen der altmodisch gewordenen
Bilder zu bethätigen. Erst in den letzten Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts ist der farbige Schmuck am Aeußeren von
Gebäuden wieder zu Ehren und zu vielfacher Anwendung
gelangt, und so dürfte eine Betrachtung dieses einst so
blühenden Kunstzweiges auch für die Praxis manche An-
regung bieten.
Zudem muß das Studium der noch vorhandenen Reste
alter Facadenmalereien um fo gerechtfertigter erscheinen,
als dieselben jetzt mit beschleunigter Geschwindigkeit ihrer
Zerstörung entgegengehen; davon später.
Auf die mittelalterlichen Vorläufer der ent-
wickelten Facadenmalereien der Renaissance scheinen die leb
haften Handelsbeziehungen, welche namentlich Venedig mit
dem Griente unterhielt, von mächtigem Einfluß gewesen
zu sein. So finden wir in dem venezianischen Gebiete —
Vicenza, Verona — noch einige mittelalterliche palastfagaden
bemalt mit orientalischen Teppichmustern in jener muha-
medanischen Verzierungsweise, welche die ungegliederten
Außenflächen der Moscheeen, mit bunten teppichartigen
Mustern in bemaltem Stuck oder mit Majoliken zu über-
ziehen liebte. Die Fenster- und Thüröffnungen sind mit
ornamentirten Streifen eingefaßt.
-) Sämmtliche zu diesem Aufsatz gehörige Abbildungeu wurden nach Aufnahmen des Derfassers dieses Aufsatzes, prof. lf. Pfeifer,
hergestellt und zwar jene auf Seite ; und auf Tafel 4 direkt nach den Griginalaqnarellen, die übrigen mittelst Uebersetzuug in Federzeichnung,
welche Architekt <£. Fr. Weysfer besorgte, mit Ausnahme der vom Derfasser selbst herrührenden Federzeichnung auf Seite 6.
X
Zeitschrift des bayer. Kunstzewerbewereins München.
(894. Heft t (Bg. f.)
/
Grau iu Grau gemalte Fresken van Laravaggio und Maturiuo; Jahrhundert.-)
aMdkmiuilerK -K Meiuliffiiiice in MaliN W DkAAlaM.
Von Prof. Hermann Pfeifer, Braunschweig.
(Den: folgenden Aufsatze liegt ein im
Braunschweiger Kunstgewerbeverein gehaltener freier Vortrag zu Grunde.)
Nachdruck verboten.
^/chA^Lie Freude an farbigem Schmuck von Bau-
VFMst I werken ist so alt wie die menschliche Kultur.
Als beredte Zeugen erzählen uns davon die
Ueberreste jener ältesten uns bekannten Kultur
am Nil, ant Euphrat uitd Tigris.
Daß auch am Aeußern der griechischen
Tempel die Gesintse lebhaft farbig bemalt
waren, hat die gewissenhafte, archäologische Forschuitg seit
Pittorf und Semper festgestellt. Jur farbenfreudigen Mittel-
alter, besonders aber in der kunstbegeisterten Periode der
Renaissance, jener Blütezeit der monumentalen Wandmalerei,
war die Physiognomie ganzer Städte durch eine reiche Fülle
von Facadenmalereien wesentlich beeinflußt.
wie es nun kommen konnte, daß seit dem vorigen Jahr-
hundert diese Farbenfreudigkeit und diese einst so hoch ent-
wickelte Technik der Facadenmalerei nach und nach fast voll-
ständig verloren ging, läßt sich wohl nicht lediglich aus dem
immerwährenden Bedürfniß nach Abwechslung erklären.
Jedenfalls ist dem Rückgänge der handwerklichen Tüchtig-
keit und Selbständigkeit seit Anfang unseres Jahrhunderts
ein guter Theil der Schuld daran beizumessen.
Dazu kommt, daß die Baumeister der Renaissance und
des Barockstiles bei dem begeisterten Studium, welches sie
den römischen Ruinen widmeten, vollauf mit der rein
formalen Ausbildung der antiken Bauwerke beschäftigt waren
und den spärlichen Ueberresten von Farben keine Aufmerk-
samkeit schenkten. So kam es, daß man in dem Streben,
möglichst getreu im Sinne der Antike zu bauen, die Farbe
mehr und mehr vernachläßigte; die Farblosigkeit wurde
modern, man übertünchte zunächst in den Kirchen die alten
Freskomalereien, man ersetzte die farbenprächtigen Glas-
malereien durch große, lichte Fensterscheiben und freute sich
der neuen Hellen Flächen.
Dasselbe Schicksal theilten auch die Facadenmalereien
da, wo den Hausbesitzern die Mittel nicht fehlten, ihren
Reinlichkeitssinn durchUeberweißen der altmodisch gewordenen
Bilder zu bethätigen. Erst in den letzten Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts ist der farbige Schmuck am Aeußeren von
Gebäuden wieder zu Ehren und zu vielfacher Anwendung
gelangt, und so dürfte eine Betrachtung dieses einst so
blühenden Kunstzweiges auch für die Praxis manche An-
regung bieten.
Zudem muß das Studium der noch vorhandenen Reste
alter Facadenmalereien um fo gerechtfertigter erscheinen,
als dieselben jetzt mit beschleunigter Geschwindigkeit ihrer
Zerstörung entgegengehen; davon später.
Auf die mittelalterlichen Vorläufer der ent-
wickelten Facadenmalereien der Renaissance scheinen die leb
haften Handelsbeziehungen, welche namentlich Venedig mit
dem Griente unterhielt, von mächtigem Einfluß gewesen
zu sein. So finden wir in dem venezianischen Gebiete —
Vicenza, Verona — noch einige mittelalterliche palastfagaden
bemalt mit orientalischen Teppichmustern in jener muha-
medanischen Verzierungsweise, welche die ungegliederten
Außenflächen der Moscheeen, mit bunten teppichartigen
Mustern in bemaltem Stuck oder mit Majoliken zu über-
ziehen liebte. Die Fenster- und Thüröffnungen sind mit
ornamentirten Streifen eingefaßt.
-) Sämmtliche zu diesem Aufsatz gehörige Abbildungeu wurden nach Aufnahmen des Derfassers dieses Aufsatzes, prof. lf. Pfeifer,
hergestellt und zwar jene auf Seite ; und auf Tafel 4 direkt nach den Griginalaqnarellen, die übrigen mittelst Uebersetzuug in Federzeichnung,
welche Architekt <£. Fr. Weysfer besorgte, mit Ausnahme der vom Derfasser selbst herrührenden Federzeichnung auf Seite 6.
X
Zeitschrift des bayer. Kunstzewerbewereins München.
(894. Heft t (Bg. f.)
/