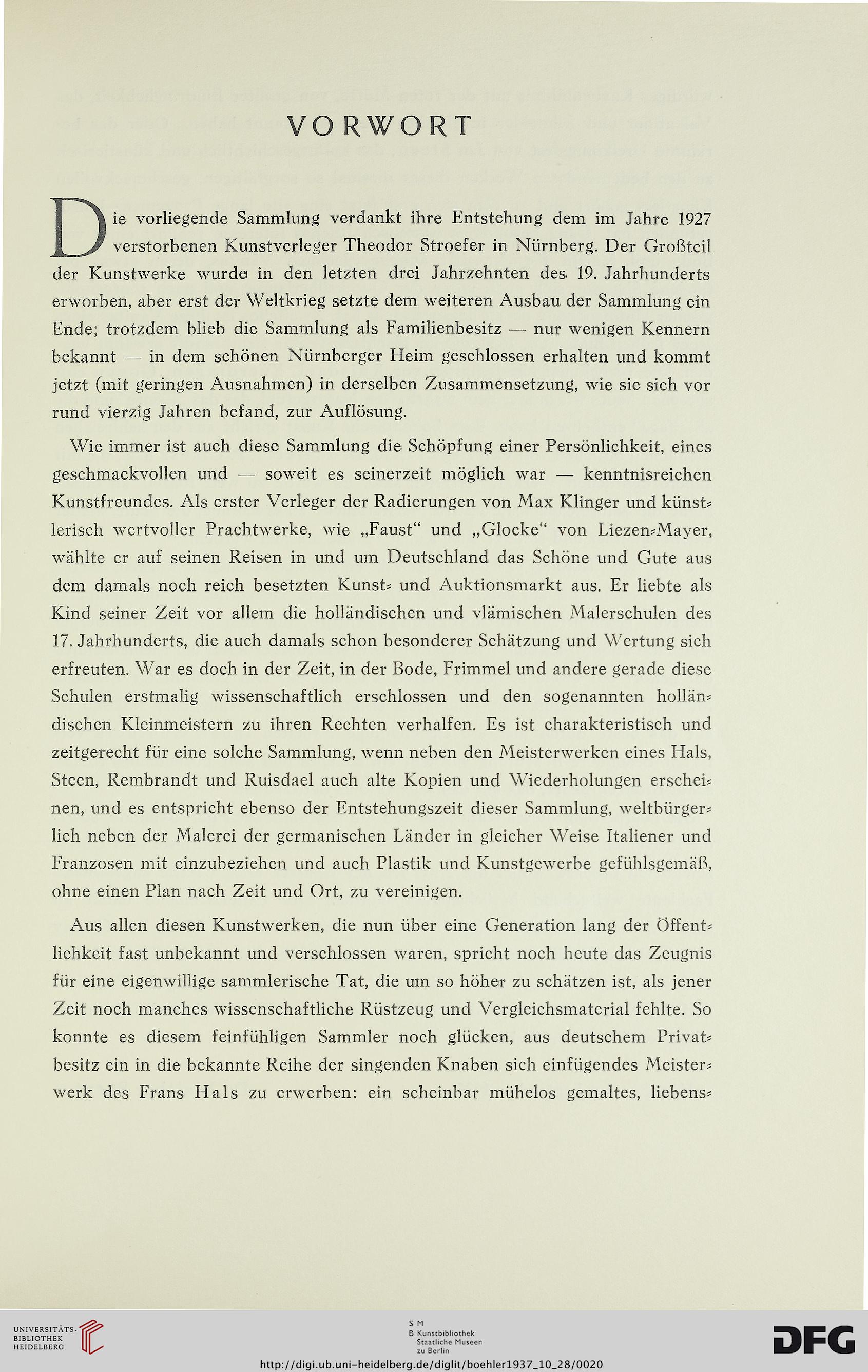VO RWORT
Die vorliegende Sammlung verdankt ihre Entstehung dem im Jahre 1927
verstorbenen Kunstverleger Theodor Stroefer in Nürnberg. Der Großteil
der Kunstwerke wurde in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
erworben, aber erst der Weltkrieg setzte dem weiteren Ausbau der Sammlung ein
Ende; trotzdem blieb die Sammlung als Familienbesitz — nur wenigen Kennern
bekannt — in dem schönen Nürnberger Heim geschlossen erhalten und kommt
jetzt (mit geringen Ausnahmen) in derselben Zusammensetzung, wie sie sich vor
rund vierzig Jahren befand, zur Auflösung.
Wie immer ist auch diese Sammlung die Schöpfung einer Persönlichkeit, eines
geschmackvollen und — soweit es seinerzeit möglich war — kenntnisreichen
Kunstfreundes. Als erster Verleger der Radierungen von Max Klinger und künst?
lerisch wertvoller Prachtwerke, wie „Faust" und „Glocke" von Liezen?Mayer,
wählte er auf seinen Reisen in und um Deutschland das Schöne und Gute aus
dem damals noch reich besetzten Kunst? und Auktionsmarkt aus. Er liebte als
Kind seiner Zeit vor allem die holländischen und vlämischen Malerschulen des
17. Jahrhunderts, die auch damals schon besonderer Schätzung und Wertung sich
erfreuten. War es doch in der Zeit, in der Bode, Frimmel und andere gerade diese
Schulen erstmalig wissenschaftlich erschlossen und den sogenannten hollän?
dischen Kleinmeistern zu ihren Rechten verhalfen. Es ist charakteristisch und
zeitgerecht für eine solche Sammlung, wenn neben den Meisterwerken eines Hals,
Steen, Rembrandt und Ruisdael auch alte Kopien und Wiederholungen erschei?
nen, und es entspricht ebenso der Entstehungszeit dieser Sammlung, Weltbürger?
lieh neben der Malerei der germanischen Länder in gleicher Weise Italiener und
Franzosen mit einzubeziehen und auch Plastik und Kunstgewerbe gefühlsgemäß,
ohne einen Plan nach Zeit und Ort, zu vereinigen.
Aus allen diesen Kunstwerken, die nun über eine Generation lang der Öffent?
lichkeit fast unbekannt und verschlossen waren, spricht noch heute das Zeugnis
für eine eigenwillige sammlerische Tat, die um so höher zu schätzen ist, als jener
Zeit noch manches wissenschaftliche Rüstzeug und Vergleichsmaterial fehlte. So
konnte es diesem feinfühligen Sammler noch glücken, aus deutschem Privat?
besitz ein in die bekannte Reihe der singenden Knaben sich einfügendes Meister?
werk des Frans Hals zu erwerben: ein scheinbar mühelos gemaltes, liebens?
Die vorliegende Sammlung verdankt ihre Entstehung dem im Jahre 1927
verstorbenen Kunstverleger Theodor Stroefer in Nürnberg. Der Großteil
der Kunstwerke wurde in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
erworben, aber erst der Weltkrieg setzte dem weiteren Ausbau der Sammlung ein
Ende; trotzdem blieb die Sammlung als Familienbesitz — nur wenigen Kennern
bekannt — in dem schönen Nürnberger Heim geschlossen erhalten und kommt
jetzt (mit geringen Ausnahmen) in derselben Zusammensetzung, wie sie sich vor
rund vierzig Jahren befand, zur Auflösung.
Wie immer ist auch diese Sammlung die Schöpfung einer Persönlichkeit, eines
geschmackvollen und — soweit es seinerzeit möglich war — kenntnisreichen
Kunstfreundes. Als erster Verleger der Radierungen von Max Klinger und künst?
lerisch wertvoller Prachtwerke, wie „Faust" und „Glocke" von Liezen?Mayer,
wählte er auf seinen Reisen in und um Deutschland das Schöne und Gute aus
dem damals noch reich besetzten Kunst? und Auktionsmarkt aus. Er liebte als
Kind seiner Zeit vor allem die holländischen und vlämischen Malerschulen des
17. Jahrhunderts, die auch damals schon besonderer Schätzung und Wertung sich
erfreuten. War es doch in der Zeit, in der Bode, Frimmel und andere gerade diese
Schulen erstmalig wissenschaftlich erschlossen und den sogenannten hollän?
dischen Kleinmeistern zu ihren Rechten verhalfen. Es ist charakteristisch und
zeitgerecht für eine solche Sammlung, wenn neben den Meisterwerken eines Hals,
Steen, Rembrandt und Ruisdael auch alte Kopien und Wiederholungen erschei?
nen, und es entspricht ebenso der Entstehungszeit dieser Sammlung, Weltbürger?
lieh neben der Malerei der germanischen Länder in gleicher Weise Italiener und
Franzosen mit einzubeziehen und auch Plastik und Kunstgewerbe gefühlsgemäß,
ohne einen Plan nach Zeit und Ort, zu vereinigen.
Aus allen diesen Kunstwerken, die nun über eine Generation lang der Öffent?
lichkeit fast unbekannt und verschlossen waren, spricht noch heute das Zeugnis
für eine eigenwillige sammlerische Tat, die um so höher zu schätzen ist, als jener
Zeit noch manches wissenschaftliche Rüstzeug und Vergleichsmaterial fehlte. So
konnte es diesem feinfühligen Sammler noch glücken, aus deutschem Privat?
besitz ein in die bekannte Reihe der singenden Knaben sich einfügendes Meister?
werk des Frans Hals zu erwerben: ein scheinbar mühelos gemaltes, liebens?