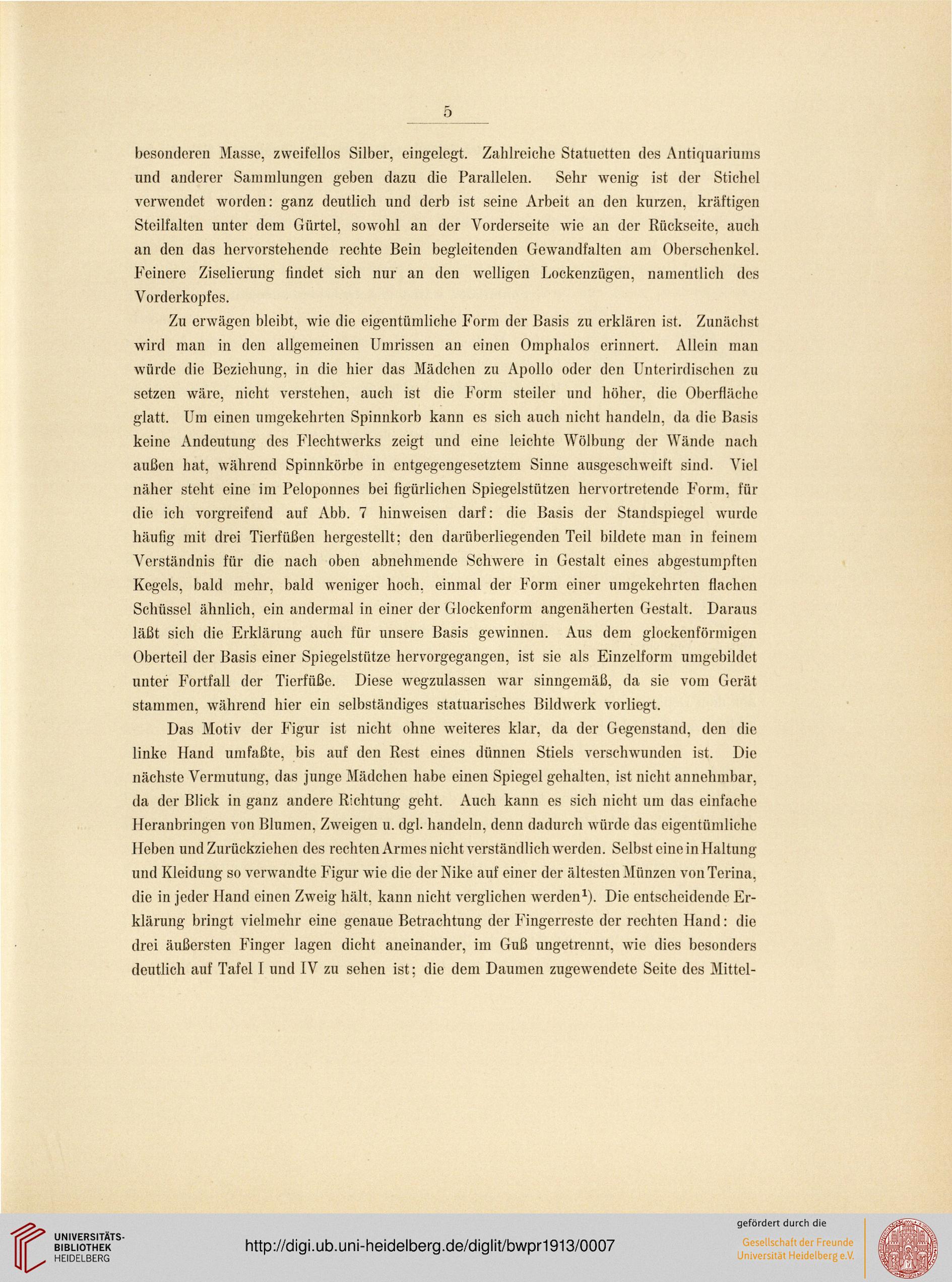besonderen Masse, zweifellos Silber, eingelegt. Zahlreiche Statuetten des Antiquariums
und anderer Sammlungen geben dazu die Parallelen. Sehr wenig ist der Stichel
verwendet worden: ganz deutlich und derb ist seine Arbeit an den kurzen, kräftigen
Steilfalten unter dem Gürtel, sowohl an der Vorderseite wie an der Rückseite, auch
an den das hervorstehende rechte Bein begleitenden Gewandfalten am Oberschenkel.
Feinere Ziselierung findet sich nur an den welligen Lockenzügen, namentlich des
Vorderkopfes.
Zu erwägen bleibt, wie die eigentümliche Form der Basis zu erklären ist. Zunächst
wird man in den allgemeinen Umrissen an einen Omphalos erinnert. Allein man
würde die Beziehung, in die hier das Mädchen zu Apollo oder den Unterirdischen zu
setzen wäre, nicht verstehen, auch ist die Form steiler und höher, die Oberfläche
glatt. Um einen umgekehrten Spinnkorb kann es sich auch nicht handeln, da die Basis
keine Andeutung des Flechtwerks zeigt und eine leichte Wölbung der Wände nach
außen hat, während Spinnkörbe in entgegengesetztem Sinne ausgeschweift sind. Viel
näher steht eine im Peloponnes bei figürlichen Spiegelstützen hervortretende Form, für
die ich vorgreifend auf Abb. 7 hinweisen darf: die Basis der Standspiegel wurde
häufig mit drei Tierfüßen hergestellt; den darüberliegenden Teil bildete man in feinem
Verständnis für die nach oben abnehmende Schwere in Gestalt eines abgestumpften
Kegels, bald mehr, bald weniger hoch, einmal der Form einer umgekehrten flachen
Schüssel ähnlich, ein andermal in einer der Glockenform angenäherten Gestalt. Daraus
läßt sich die Erklärung auch für unsere Basis gewinnen. Aus dem glockenförmigen
Oberteil der Basis einer Spiegelstütze hervorgegangen, ist sie als Einzelform umgebildet
unter Fortfall der Tierfüße. Diese wegzulassen war sinngemäß, da sie vom Gerät
stammen, während hier ein selbständiges statuarisches Bildwerk vorliegt.
Das Motiv der Figur ist nicht ohne weiteres klar, da der Gegenstand, den die
linke Hand umfaßte, bis auf den Rest eines dünnen Stiels verschwunden ist. Die
nächste Vermutung, das junge Mädchen habe einen Spiegel gehalten, ist nicht annehmbar,
da der Blick in ganz andere Richtung geht. Auch kann es sich nicht um das einfache
Heranbringen von Blumen, Zweigen u. dgl. handeln, denn dadurch würde das eigentümliche
Heben und Zurückziehen des rechten Armes nicht verständlich werden. Selbst eine in Haltung
und Kleidung so verwandte Figur wie die der Nike auf einer der ältesten Münzen vonTerina,
die in jeder Hand einen Zweig hält, kann nicht verglichen werden1). Die entscheidende Er-
klärung bringt vielmehr eine genaue Betrachtung der Fingerreste der rechten Hand: die
drei äußersten Finger lagen dicht aneinander, im Guß ungetrennt, wie dies besonders
deutlich auf Tafel I und IV zu sehen ist; die dem Daumen zugewendete Seite des Mittel-
und anderer Sammlungen geben dazu die Parallelen. Sehr wenig ist der Stichel
verwendet worden: ganz deutlich und derb ist seine Arbeit an den kurzen, kräftigen
Steilfalten unter dem Gürtel, sowohl an der Vorderseite wie an der Rückseite, auch
an den das hervorstehende rechte Bein begleitenden Gewandfalten am Oberschenkel.
Feinere Ziselierung findet sich nur an den welligen Lockenzügen, namentlich des
Vorderkopfes.
Zu erwägen bleibt, wie die eigentümliche Form der Basis zu erklären ist. Zunächst
wird man in den allgemeinen Umrissen an einen Omphalos erinnert. Allein man
würde die Beziehung, in die hier das Mädchen zu Apollo oder den Unterirdischen zu
setzen wäre, nicht verstehen, auch ist die Form steiler und höher, die Oberfläche
glatt. Um einen umgekehrten Spinnkorb kann es sich auch nicht handeln, da die Basis
keine Andeutung des Flechtwerks zeigt und eine leichte Wölbung der Wände nach
außen hat, während Spinnkörbe in entgegengesetztem Sinne ausgeschweift sind. Viel
näher steht eine im Peloponnes bei figürlichen Spiegelstützen hervortretende Form, für
die ich vorgreifend auf Abb. 7 hinweisen darf: die Basis der Standspiegel wurde
häufig mit drei Tierfüßen hergestellt; den darüberliegenden Teil bildete man in feinem
Verständnis für die nach oben abnehmende Schwere in Gestalt eines abgestumpften
Kegels, bald mehr, bald weniger hoch, einmal der Form einer umgekehrten flachen
Schüssel ähnlich, ein andermal in einer der Glockenform angenäherten Gestalt. Daraus
läßt sich die Erklärung auch für unsere Basis gewinnen. Aus dem glockenförmigen
Oberteil der Basis einer Spiegelstütze hervorgegangen, ist sie als Einzelform umgebildet
unter Fortfall der Tierfüße. Diese wegzulassen war sinngemäß, da sie vom Gerät
stammen, während hier ein selbständiges statuarisches Bildwerk vorliegt.
Das Motiv der Figur ist nicht ohne weiteres klar, da der Gegenstand, den die
linke Hand umfaßte, bis auf den Rest eines dünnen Stiels verschwunden ist. Die
nächste Vermutung, das junge Mädchen habe einen Spiegel gehalten, ist nicht annehmbar,
da der Blick in ganz andere Richtung geht. Auch kann es sich nicht um das einfache
Heranbringen von Blumen, Zweigen u. dgl. handeln, denn dadurch würde das eigentümliche
Heben und Zurückziehen des rechten Armes nicht verständlich werden. Selbst eine in Haltung
und Kleidung so verwandte Figur wie die der Nike auf einer der ältesten Münzen vonTerina,
die in jeder Hand einen Zweig hält, kann nicht verglichen werden1). Die entscheidende Er-
klärung bringt vielmehr eine genaue Betrachtung der Fingerreste der rechten Hand: die
drei äußersten Finger lagen dicht aneinander, im Guß ungetrennt, wie dies besonders
deutlich auf Tafel I und IV zu sehen ist; die dem Daumen zugewendete Seite des Mittel-