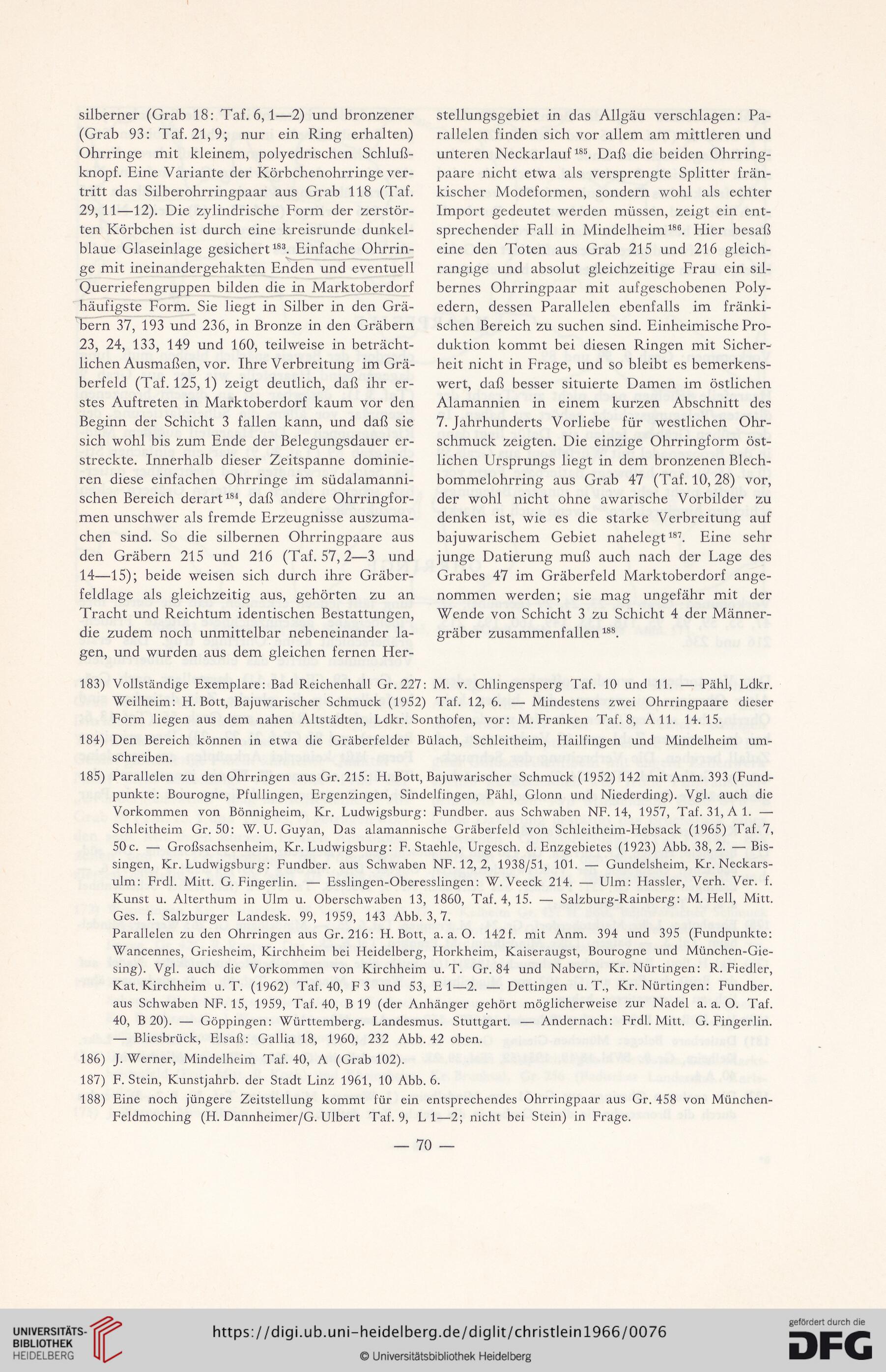silberner (Grab 18: Taf. 6,1—2) und bronzener
(Grab 93: Taf. 21,9; nur ein Ring erhalten)
Ohrringe mit kleinem, polyedrischen Schluß-
knopf. Eine Variante der Körbchenohrringe ver-
tritt das Silberohrringpaar aus Grab 118 (Taf.
29,11—12). Die zylindrische Form der zerstör-
ten Körbchen ist durch eine kreisrunde dunkel-
blaue Glaseinlage gesichert183. Einfache Ohrrin-
ge mit ineinandergehakten Enden und eventuell
Querriefengruppen bilden die in Marktoberdorf
häufigste Form. Sie liegt in Silber in den Grä-
bern 37, 193 und 236, in Bronze in den Gräbern
23, 24, 133, 149 und 160, teilweise in beträcht-
lichen Ausmaßen, vor. Ihre Verbreitung im Grä-
berfeld (Taf. 125,1) zeigt deutlich, daß ihr er-
stes Auftreten in Marktoberdorf kaum vor den
Beginn der Schicht 3 fallen kann, und daß sie
sich wohl bis zum Ende der Belegungsdauer er-
streckte. Innerhalb dieser Zeitspanne dominie-
ren diese einfachen Ohrringe im südalamanni-
schen Bereich derart184, daß andere Ohrringfor-
men unschwer als fremde Erzeugnisse auszuma-
chen sind. So die silbernen Ohrringpaare aus
den Gräbern 215 und 216 (Taf. 57, 2—3 und
14—15); beide weisen sich durch ihre Gräber-
feldlage als gleichzeitig aus, gehörten zu an
Tracht und Reichtum identischen Bestattungen,
die zudem noch unmittelbar nebeneinander la-
gen, und wurden aus dem gleichen fernen Her-
stellungsgebiet in das Allgäu verschlagen: Pa-
rallelen finden sich vor allem am mittleren und
unteren Neckarlauf185. Daß die beiden Ohrring-
paare nicht etwa als versprengte Splitter frän-
kischer Modeformen, sondern wohl als echter
Import gedeutet werden müssen, zeigt ein ent-
sprechender Fall in Mindelheim186. Hier besaß
eine den Toten aus Grab 215 und 216 gleich-
rangige und absolut gleichzeitige Frau ein sil-
bernes Ohrringpaar mit aufgeschobenen Poly-
edern, dessen Parallelen ebenfalls im fränki-
schen Bereich zu suchen sind. Einheimische Pro-
duktion kommt bei diesen Ringen mit Sicher-
heit nicht in Frage, und so bleibt es bemerkens-
wert, daß besser situierte Damen im östlichen
Alamannien in einem kurzen Abschnitt des
7. Jahrhunderts Vorliebe für westlichen Ohr-
schmuck zeigten. Die einzige Ohrringform öst-
lichen Ursprungs liegt in dem bronzenen Blech-
bommelohrring aus Grab 47 (Taf. 10, 28) vor,
der wohl nicht ohne awarische Vorbilder zu
denken ist, wie es die starke Verbreitung auf
bajuwarischem Gebiet nahelegt187. Eine sehr
junge Datierung muß auch nach der Lage des
Grabes 47 im Gräberfeld Marktoberdorf ange-
nommen werden; sie mag ungefähr mit der
Wende von Schicht 3 zu Schicht 4 der Männer-
gräber zusammenfallen188.
183) Vollständige Exemplare: Bad Reichenhall Gr. 227: M. v. Chlingensperg Taf. 10 und 11. — Pähl, Ldkr.
Weilheim: H. Bott, Bajuwarischer Schmuck (1952) Taf. 12, 6. — Mindestens zwei Ohrringpaare dieser
Form liegen aus dem nahen Altstädten, Ldkr. Sonthofen, vor: M. Franken Taf. 8, All. 14.15.
184) Den Bereich können in etwa die Gräberfelder Bülach, Schleitheim, Hailfingen und Mindelheim um-
schreiben.
185) Parallelen zu den Ohrringen aus Gr. 215: H. Bott, Bajuwarischer Schmuck (1952) 142 mit Anm. 393 (Fund-
punkte: Bourogne, Pfullingen, Ergenzingen, Sindelfingen, Pähl, Glonn und Niederding). Vgl. auch die
Vorkommen von Bönnigheim, Kr. Ludwigsburg: Fundber. aus Schwaben NF. 14, 1957, Taf. 31, Al. —
Schleitheim Gr. 50: W. U. Guyan, Das alamannische Gräberfeld von Schleitheim-Hebsack (1965) Taf. 7,
50c. — Großsachsenheim, Kr. Ludwigsburg: F. Staehle, Urgesch. d. Enzgebietes (1923) Abb. 38, 2. —Bis-
singen, Kr. Ludwigsburg: Fundber. aus Schwaben NF. 12, 2, 1938/51, 101. — Gundelsheim, Kr. Neckars-
ulm: Frdl. Mitt. G. Fingerlin. — Esslingen-Oberesslingen: W. Veeck 214. — Ulm: Hassler, Verh. Ver. f.
Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben 13, 1860, Taf. 4, 15. — Salzburg-Rainberg: M. Hell, Mitt.
Ges. f. Salzburger Landesk. 99, 1959, 143 Abb. 3,7.
Parallelen zu den Ohrringen aus Gr. 216: H. Bott, a. a. O. 142f. mit Anm. 394 und 395 (Fundpunkte:
Wancennes, Griesheim, Kirchheim bei Heidelberg, Horkheim, Kaiseraugst, Bourogne und München-Gie-
sing). Vgl. auch die Vorkommen von Kirchheim u. T. Gr. 84 und Nabern, Kr. Nürtingen: R. Fiedler,
Kat. Kirchheim u. T. (1962) Taf. 40, F3 und 53, El—2. — Dettingen u. T., Kr. Nürtingen: Fundber.
aus Schwaben NF. 15, 1959, Taf. 40, B 19 (der Anhänger gehört möglicherweise zur Nadel a. a. O. Taf.
40, B 20). — Göppingen: Württemberg. Landesmus. Stuttgart. — Andernach: Frdl. Mitt. G. Fingerlin.
— Bliesbrück, Elsaß: Gallia 18, 1960, 232 Abb. 42 oben.
186) J. Werner, Mindelheim Taf. 40, A (Grab 102).
187) F. Stein, Kunstjahrb. der Stadt Linz 1961, 10 Abb. 6.
188) Eine noch jüngere Zeitstellung kommt für ein entsprechendes Ohrringpaar aus Gr. 458 von München-
Feldmoching (H. Dannheimer/G. Ulbert Taf. 9, LI—2; nicht bei Stein) in Frage.
— 70 —
(Grab 93: Taf. 21,9; nur ein Ring erhalten)
Ohrringe mit kleinem, polyedrischen Schluß-
knopf. Eine Variante der Körbchenohrringe ver-
tritt das Silberohrringpaar aus Grab 118 (Taf.
29,11—12). Die zylindrische Form der zerstör-
ten Körbchen ist durch eine kreisrunde dunkel-
blaue Glaseinlage gesichert183. Einfache Ohrrin-
ge mit ineinandergehakten Enden und eventuell
Querriefengruppen bilden die in Marktoberdorf
häufigste Form. Sie liegt in Silber in den Grä-
bern 37, 193 und 236, in Bronze in den Gräbern
23, 24, 133, 149 und 160, teilweise in beträcht-
lichen Ausmaßen, vor. Ihre Verbreitung im Grä-
berfeld (Taf. 125,1) zeigt deutlich, daß ihr er-
stes Auftreten in Marktoberdorf kaum vor den
Beginn der Schicht 3 fallen kann, und daß sie
sich wohl bis zum Ende der Belegungsdauer er-
streckte. Innerhalb dieser Zeitspanne dominie-
ren diese einfachen Ohrringe im südalamanni-
schen Bereich derart184, daß andere Ohrringfor-
men unschwer als fremde Erzeugnisse auszuma-
chen sind. So die silbernen Ohrringpaare aus
den Gräbern 215 und 216 (Taf. 57, 2—3 und
14—15); beide weisen sich durch ihre Gräber-
feldlage als gleichzeitig aus, gehörten zu an
Tracht und Reichtum identischen Bestattungen,
die zudem noch unmittelbar nebeneinander la-
gen, und wurden aus dem gleichen fernen Her-
stellungsgebiet in das Allgäu verschlagen: Pa-
rallelen finden sich vor allem am mittleren und
unteren Neckarlauf185. Daß die beiden Ohrring-
paare nicht etwa als versprengte Splitter frän-
kischer Modeformen, sondern wohl als echter
Import gedeutet werden müssen, zeigt ein ent-
sprechender Fall in Mindelheim186. Hier besaß
eine den Toten aus Grab 215 und 216 gleich-
rangige und absolut gleichzeitige Frau ein sil-
bernes Ohrringpaar mit aufgeschobenen Poly-
edern, dessen Parallelen ebenfalls im fränki-
schen Bereich zu suchen sind. Einheimische Pro-
duktion kommt bei diesen Ringen mit Sicher-
heit nicht in Frage, und so bleibt es bemerkens-
wert, daß besser situierte Damen im östlichen
Alamannien in einem kurzen Abschnitt des
7. Jahrhunderts Vorliebe für westlichen Ohr-
schmuck zeigten. Die einzige Ohrringform öst-
lichen Ursprungs liegt in dem bronzenen Blech-
bommelohrring aus Grab 47 (Taf. 10, 28) vor,
der wohl nicht ohne awarische Vorbilder zu
denken ist, wie es die starke Verbreitung auf
bajuwarischem Gebiet nahelegt187. Eine sehr
junge Datierung muß auch nach der Lage des
Grabes 47 im Gräberfeld Marktoberdorf ange-
nommen werden; sie mag ungefähr mit der
Wende von Schicht 3 zu Schicht 4 der Männer-
gräber zusammenfallen188.
183) Vollständige Exemplare: Bad Reichenhall Gr. 227: M. v. Chlingensperg Taf. 10 und 11. — Pähl, Ldkr.
Weilheim: H. Bott, Bajuwarischer Schmuck (1952) Taf. 12, 6. — Mindestens zwei Ohrringpaare dieser
Form liegen aus dem nahen Altstädten, Ldkr. Sonthofen, vor: M. Franken Taf. 8, All. 14.15.
184) Den Bereich können in etwa die Gräberfelder Bülach, Schleitheim, Hailfingen und Mindelheim um-
schreiben.
185) Parallelen zu den Ohrringen aus Gr. 215: H. Bott, Bajuwarischer Schmuck (1952) 142 mit Anm. 393 (Fund-
punkte: Bourogne, Pfullingen, Ergenzingen, Sindelfingen, Pähl, Glonn und Niederding). Vgl. auch die
Vorkommen von Bönnigheim, Kr. Ludwigsburg: Fundber. aus Schwaben NF. 14, 1957, Taf. 31, Al. —
Schleitheim Gr. 50: W. U. Guyan, Das alamannische Gräberfeld von Schleitheim-Hebsack (1965) Taf. 7,
50c. — Großsachsenheim, Kr. Ludwigsburg: F. Staehle, Urgesch. d. Enzgebietes (1923) Abb. 38, 2. —Bis-
singen, Kr. Ludwigsburg: Fundber. aus Schwaben NF. 12, 2, 1938/51, 101. — Gundelsheim, Kr. Neckars-
ulm: Frdl. Mitt. G. Fingerlin. — Esslingen-Oberesslingen: W. Veeck 214. — Ulm: Hassler, Verh. Ver. f.
Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben 13, 1860, Taf. 4, 15. — Salzburg-Rainberg: M. Hell, Mitt.
Ges. f. Salzburger Landesk. 99, 1959, 143 Abb. 3,7.
Parallelen zu den Ohrringen aus Gr. 216: H. Bott, a. a. O. 142f. mit Anm. 394 und 395 (Fundpunkte:
Wancennes, Griesheim, Kirchheim bei Heidelberg, Horkheim, Kaiseraugst, Bourogne und München-Gie-
sing). Vgl. auch die Vorkommen von Kirchheim u. T. Gr. 84 und Nabern, Kr. Nürtingen: R. Fiedler,
Kat. Kirchheim u. T. (1962) Taf. 40, F3 und 53, El—2. — Dettingen u. T., Kr. Nürtingen: Fundber.
aus Schwaben NF. 15, 1959, Taf. 40, B 19 (der Anhänger gehört möglicherweise zur Nadel a. a. O. Taf.
40, B 20). — Göppingen: Württemberg. Landesmus. Stuttgart. — Andernach: Frdl. Mitt. G. Fingerlin.
— Bliesbrück, Elsaß: Gallia 18, 1960, 232 Abb. 42 oben.
186) J. Werner, Mindelheim Taf. 40, A (Grab 102).
187) F. Stein, Kunstjahrb. der Stadt Linz 1961, 10 Abb. 6.
188) Eine noch jüngere Zeitstellung kommt für ein entsprechendes Ohrringpaar aus Gr. 458 von München-
Feldmoching (H. Dannheimer/G. Ulbert Taf. 9, LI—2; nicht bei Stein) in Frage.
— 70 —