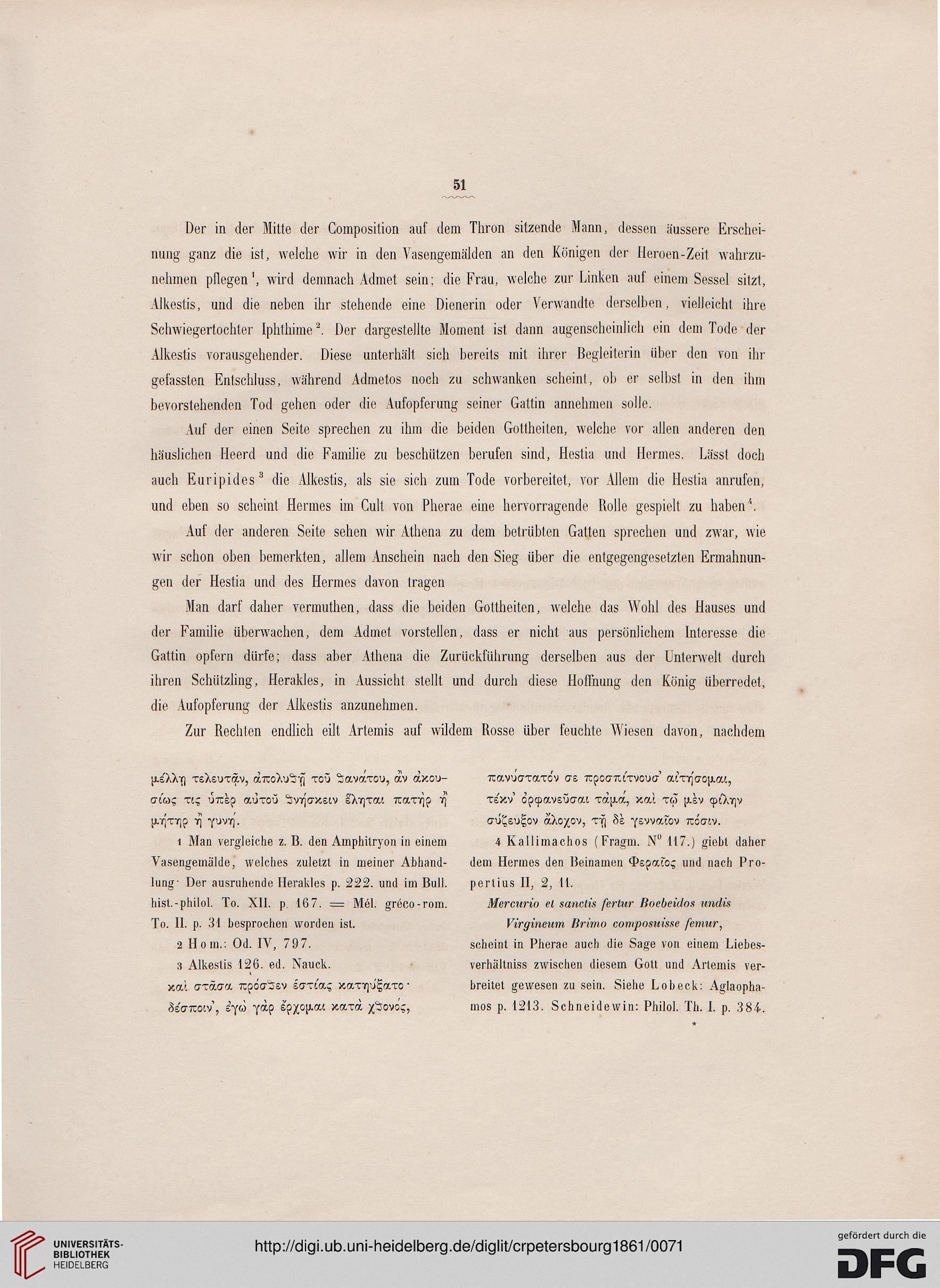51
Der in der Mitte der Composition auf dem Thron sitzende Mann, dessen à'ussere Erschei-
nung ganz die ist, welche wir in den Vasengemâlden an den Kônigen der Heroen-Zeit wahrzu-
nehmen pflegen', wird demnach Admet sein; die Frau, welche zur Linken auf einem Sessel sitzt,
Alkestis, und die neben ihr stehende eine Dienerin oder Verwandte derselben, vieHeicht ihre
Schwiegertochter Iphthime2. Der dargestelltc Moment ist dann augenscheinlich ein dem Tode der
Alkestis vorausgehender. Dièse unterhà'lt sich bereits mit ihrer Begleiterin iiber den von ihr
gefassten Entschluss, wà'hrend Admetos noch zu schwanken scheint, ob er selbst in den ihm
bevorstehenden Tod gehen oder die Aufopferung seiner Gattin annehmen solle.
Auf der einen Seite sprechen zu ihm die beiden Gottheiten, welche vor allen anderen den
hà'uslichen Heerd und die Familie zu beschiitzen berufen sind, Hestia und Hermès. Lasst doch
auch Euripides3 die Alkestis, als sie sich zum Tode vorbereitet, vor Allem die Hestia anrufen,
und eben so scheint Hennés im Cuit von Pherae eine hervorragende Rolle gespielt zu haben''.
Auf der anderen Seite sehcn wir Athena zu dem betriibten Gatten sprechen und zwar, wie
wir schon oben bemerkten, allem Anschein nach den Sieg iiber die entgegengesetzten Ermahnun-
gen der Hestia und des Hermès davon tragen
Man darf daher vennuthen, dass die beiden Gottheiten, welche das Wohl des Hauses und
der Familie iiberwachen, dem Admet vorstellen, dass er nicht aus personlichem Intéresse die
Gattin opfern diirfe; dass aber Athena die Zuriickfiihrung derselben aus der Unterwelt durcli
ihren Schiitzling, Herakles, in Aussicht stellt und durch dièse Hoffnung den Konig iiberredet,
die iufopferung der Alkestis anzunehmen.
Zur Rechten endlich eilt Artemis auf wildem Rosse iiber feuchte Wiesen davon, nachdem
[xsXXTf) TsXeutâv, octcoXuîîtq toù 'iavaTou, âv àxou-
a(aç Ttç uuèp œùxoû 'ïvïj'ffxsiv fX^xai TCotTïjp ~t\
jjltJxtip y] yuvy).
1 Man vergleiche z. B. den Amphitryon in einem
Vasengemâlde, welches zuletzt in meiner Abhand-
lung- Der ausruhende Herakles p. 222. und im Bull,
hist.-philol. To. XII. p 167. = Mél. gréco-rom.
To. II. p. 31 besprochen vvordeu ist.
2 Honi.: Od. IV, 797.
a Alkestis 126. ed. Nauck.
xai GTà.<jn upôa'Ssv i<JT(aç xaxr)uî;aTO •
TCavuaTaTo'v az 7i:poa-7UTvoua' aixYj'aojJLat,
tsxv' opcpavsùaac xà[jLa, xai tm jtàv çcXyjv
aûÇeu^ov aChoypv, tï) hï f£vvarov raaiv.
4 Kallimachos (Fragm. Nu 117.) giebt daher
dem Hermès den Beinamen 5>£pafoç und nach Pro-
pertius II, 2, 11.
Mercurio el sanctis fertur Boebeidos ttndis
Virgineum Brimo composuisse fémur,
scheint in Pherae auch die Sage von einem Liebes-
verhàltniss zwischen diesem Gott und Artemis ver-
breitet gewesen zu sein. Siehe Lobeck: Aglaopha-
mos p. 1213. Schneidewin: Philol. Th. 1. p. 384..
Der in der Mitte der Composition auf dem Thron sitzende Mann, dessen à'ussere Erschei-
nung ganz die ist, welche wir in den Vasengemâlden an den Kônigen der Heroen-Zeit wahrzu-
nehmen pflegen', wird demnach Admet sein; die Frau, welche zur Linken auf einem Sessel sitzt,
Alkestis, und die neben ihr stehende eine Dienerin oder Verwandte derselben, vieHeicht ihre
Schwiegertochter Iphthime2. Der dargestelltc Moment ist dann augenscheinlich ein dem Tode der
Alkestis vorausgehender. Dièse unterhà'lt sich bereits mit ihrer Begleiterin iiber den von ihr
gefassten Entschluss, wà'hrend Admetos noch zu schwanken scheint, ob er selbst in den ihm
bevorstehenden Tod gehen oder die Aufopferung seiner Gattin annehmen solle.
Auf der einen Seite sprechen zu ihm die beiden Gottheiten, welche vor allen anderen den
hà'uslichen Heerd und die Familie zu beschiitzen berufen sind, Hestia und Hermès. Lasst doch
auch Euripides3 die Alkestis, als sie sich zum Tode vorbereitet, vor Allem die Hestia anrufen,
und eben so scheint Hennés im Cuit von Pherae eine hervorragende Rolle gespielt zu haben''.
Auf der anderen Seite sehcn wir Athena zu dem betriibten Gatten sprechen und zwar, wie
wir schon oben bemerkten, allem Anschein nach den Sieg iiber die entgegengesetzten Ermahnun-
gen der Hestia und des Hermès davon tragen
Man darf daher vennuthen, dass die beiden Gottheiten, welche das Wohl des Hauses und
der Familie iiberwachen, dem Admet vorstellen, dass er nicht aus personlichem Intéresse die
Gattin opfern diirfe; dass aber Athena die Zuriickfiihrung derselben aus der Unterwelt durcli
ihren Schiitzling, Herakles, in Aussicht stellt und durch dièse Hoffnung den Konig iiberredet,
die iufopferung der Alkestis anzunehmen.
Zur Rechten endlich eilt Artemis auf wildem Rosse iiber feuchte Wiesen davon, nachdem
[xsXXTf) TsXeutâv, octcoXuîîtq toù 'iavaTou, âv àxou-
a(aç Ttç uuèp œùxoû 'ïvïj'ffxsiv fX^xai TCotTïjp ~t\
jjltJxtip y] yuvy).
1 Man vergleiche z. B. den Amphitryon in einem
Vasengemâlde, welches zuletzt in meiner Abhand-
lung- Der ausruhende Herakles p. 222. und im Bull,
hist.-philol. To. XII. p 167. = Mél. gréco-rom.
To. II. p. 31 besprochen vvordeu ist.
2 Honi.: Od. IV, 797.
a Alkestis 126. ed. Nauck.
xai GTà.<jn upôa'Ssv i<JT(aç xaxr)uî;aTO •
TCavuaTaTo'v az 7i:poa-7UTvoua' aixYj'aojJLat,
tsxv' opcpavsùaac xà[jLa, xai tm jtàv çcXyjv
aûÇeu^ov aChoypv, tï) hï f£vvarov raaiv.
4 Kallimachos (Fragm. Nu 117.) giebt daher
dem Hermès den Beinamen 5>£pafoç und nach Pro-
pertius II, 2, 11.
Mercurio el sanctis fertur Boebeidos ttndis
Virgineum Brimo composuisse fémur,
scheint in Pherae auch die Sage von einem Liebes-
verhàltniss zwischen diesem Gott und Artemis ver-
breitet gewesen zu sein. Siehe Lobeck: Aglaopha-
mos p. 1213. Schneidewin: Philol. Th. 1. p. 384..