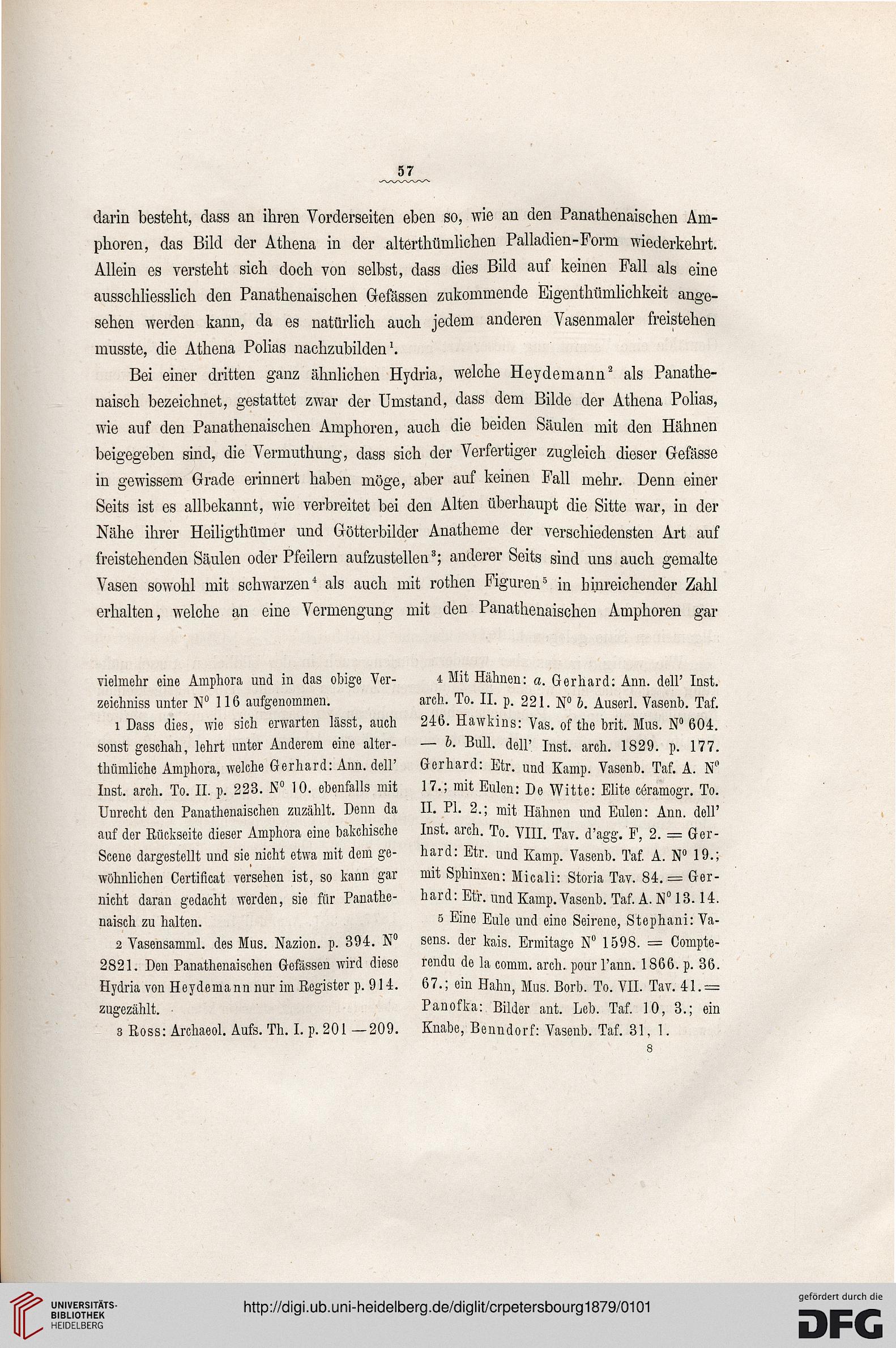57
darin besteht, dass an ihren Vorderseiten eben so, wie an den Panathenaischen Am-
phoren, das Bild der Athena in der alterthümlichen Palladien-Form wiederkehrt.
Allein es versteht sich doch von selbst, dass dies Bild auf keinen Fall als eine
ausschliesslich den Panathenaischen Gelassen zukommende Eigenthümlichkeit ange-
sehen werden kann, da es natürlich auch jedem anderen Vasenmaler freistehen
musste, die Athena Polias nachzubilden1.
Bei einer dritten ganz ähnlichen Hydria, welche Heydemann2 als Panathe-
naisch bezeichnet, gestattet zwar der Umstand, dass dem Bilde der Athena Polias,
wie auf den Panathenaischen Amphoren, auch die beiden Säulen mit den Hähnen
beigegeben sind, die Vermuthung, dass sich der Verfertiger zugleich dieser Gefässe
in gewissem Grade erinnert haben möge, aber auf keinen Fall mehr. Denn einer
Seits ist es allbekannt, wie verbreitet bei den Alten überhaupt die Sitte war, in der
Nähe ihrer Heiligthümer und Götterbilder Anatheme der verschiedensten Art auf
freistehenden Säulen oder Pfeilern aufzustellen3; anderer Seits sind uns auch gemalte
Vasen sowohl mit schwarzen4 als auch mit rothen Figuren5 in hinreichender Zahl
erhalten, Avelche an eine Vermengung mit den Panathenaischen Amphoren gar
vielmehr eine Amphora und in das obige Ver-
zeichniss unter N° 116 aufgenommen.
1 Dass dies, wie sich erwarten lässt, auch
sonst geschah, lehrt unter Anderem eine alter-
tümliche Amphora, welche Gerhard: Ann. dell'
Inst. arch. To. II. p. 223. Ä° 10. ebenfalls mit
Unrecht den Panathenaischen zuzählt. Denn da
auf der Rückseite dieser Amphora eine bakchische
Scene dargestellt und sie nicht etwa mit dem ge-
wöhnlichen Certificat versehen ist, so kann gar
nicht daran gedacht werden, sie für Panathe-
naisch zu halten.
2 Vasensamml. des Mus. Nazion. p. 394. N°
2821. Den Panathenaischen Gefässen wird diese
Hydria von Heydemann nur im Register p. 914.
zugezählt. ■
3 Ross: Archaeol. Aufs. Th. I. p. 201 —209.
i Mit Hähnen: a. Gerhard: Ann. dell' Inst,
arch. To. II. p. 221. N° b. Auserl. Vasenb. Taf.
246. Hawkins: Vas. of the brit. Mus. N° 604.
— b. Bull, dell' Inst. arch. 1829. p. 177.
Gerhard: Etr. und Kamp. Vasenb. Taf. A. N°
17.; mit Eulen: De Witte: Elite céramogr. To.
TL PI. 2.; mit Hähnen und Eulen: Ann. dell'
Inst. arch. To. VIII. Tav. d'agg. F, 2. = Ger-
hard: Etr. und Kamp. Vasenb. Taf. A. N° 19.;
mit Sphinxen: Micali: Storia Tav. 84. = Ger-
hard : Etr. und Kamp. Vasenb. Taf. A. N° 13.14.
5 Eine Eule und eine Seirene, Stephani: Va-
sens, der kais. Ermitage N° 1598. == Compte-
rendu de la comm. arch. pour l'ann. 1866. p. 36.
67.; ein Hahn, Mus. Borb. To. VII. Tav. 41.-
Panofka: Bilder ant. Leb. Taf. 10, 3.; ein
Knabe, Benndorf: Vasenb. Taf. 31, 1.
8
darin besteht, dass an ihren Vorderseiten eben so, wie an den Panathenaischen Am-
phoren, das Bild der Athena in der alterthümlichen Palladien-Form wiederkehrt.
Allein es versteht sich doch von selbst, dass dies Bild auf keinen Fall als eine
ausschliesslich den Panathenaischen Gelassen zukommende Eigenthümlichkeit ange-
sehen werden kann, da es natürlich auch jedem anderen Vasenmaler freistehen
musste, die Athena Polias nachzubilden1.
Bei einer dritten ganz ähnlichen Hydria, welche Heydemann2 als Panathe-
naisch bezeichnet, gestattet zwar der Umstand, dass dem Bilde der Athena Polias,
wie auf den Panathenaischen Amphoren, auch die beiden Säulen mit den Hähnen
beigegeben sind, die Vermuthung, dass sich der Verfertiger zugleich dieser Gefässe
in gewissem Grade erinnert haben möge, aber auf keinen Fall mehr. Denn einer
Seits ist es allbekannt, wie verbreitet bei den Alten überhaupt die Sitte war, in der
Nähe ihrer Heiligthümer und Götterbilder Anatheme der verschiedensten Art auf
freistehenden Säulen oder Pfeilern aufzustellen3; anderer Seits sind uns auch gemalte
Vasen sowohl mit schwarzen4 als auch mit rothen Figuren5 in hinreichender Zahl
erhalten, Avelche an eine Vermengung mit den Panathenaischen Amphoren gar
vielmehr eine Amphora und in das obige Ver-
zeichniss unter N° 116 aufgenommen.
1 Dass dies, wie sich erwarten lässt, auch
sonst geschah, lehrt unter Anderem eine alter-
tümliche Amphora, welche Gerhard: Ann. dell'
Inst. arch. To. II. p. 223. Ä° 10. ebenfalls mit
Unrecht den Panathenaischen zuzählt. Denn da
auf der Rückseite dieser Amphora eine bakchische
Scene dargestellt und sie nicht etwa mit dem ge-
wöhnlichen Certificat versehen ist, so kann gar
nicht daran gedacht werden, sie für Panathe-
naisch zu halten.
2 Vasensamml. des Mus. Nazion. p. 394. N°
2821. Den Panathenaischen Gefässen wird diese
Hydria von Heydemann nur im Register p. 914.
zugezählt. ■
3 Ross: Archaeol. Aufs. Th. I. p. 201 —209.
i Mit Hähnen: a. Gerhard: Ann. dell' Inst,
arch. To. II. p. 221. N° b. Auserl. Vasenb. Taf.
246. Hawkins: Vas. of the brit. Mus. N° 604.
— b. Bull, dell' Inst. arch. 1829. p. 177.
Gerhard: Etr. und Kamp. Vasenb. Taf. A. N°
17.; mit Eulen: De Witte: Elite céramogr. To.
TL PI. 2.; mit Hähnen und Eulen: Ann. dell'
Inst. arch. To. VIII. Tav. d'agg. F, 2. = Ger-
hard: Etr. und Kamp. Vasenb. Taf. A. N° 19.;
mit Sphinxen: Micali: Storia Tav. 84. = Ger-
hard : Etr. und Kamp. Vasenb. Taf. A. N° 13.14.
5 Eine Eule und eine Seirene, Stephani: Va-
sens, der kais. Ermitage N° 1598. == Compte-
rendu de la comm. arch. pour l'ann. 1866. p. 36.
67.; ein Hahn, Mus. Borb. To. VII. Tav. 41.-
Panofka: Bilder ant. Leb. Taf. 10, 3.; ein
Knabe, Benndorf: Vasenb. Taf. 31, 1.
8