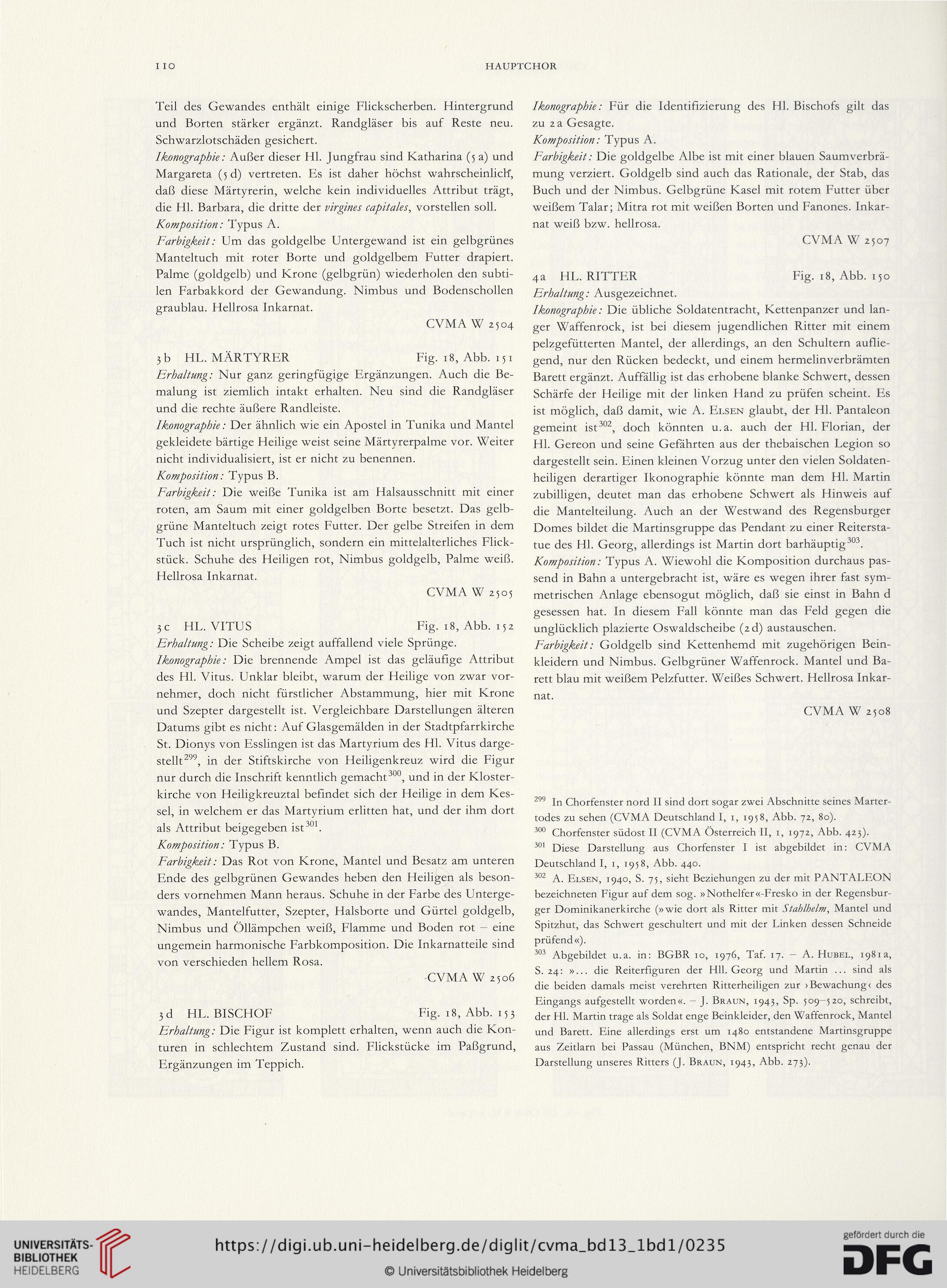I IO
HAUPTCHOR
Teil des Gewandes enthält einige Flickscherben. Hintergrund
und Borten stärker ergänzt. Randgläser bis auf Reste neu.
Schwarzlotschäden gesichert.
Ikonographie: Außer dieser Hl. Jungfrau sind Katharina (5 a) und
Margareta (jd) vertreten. Es ist daher höchst wahrscheinliclf,
daß diese Märtyrerin, welche kein individuelles Attribut trägt,
die Hl. Barbara, die dritte der virgines capitales, vorstellen soll.
Komposition: Typus A.
Farbigkeit: Um das goldgelbe Untergewand ist ein gelbgrünes
Manteltuch mit roter Borte und goldgelbem Futter drapiert.
Palme (goldgelb) und Krone (gelbgrün) wiederholen den subti-
len Farbakkord der Gewandung. Nimbus und Bodenschollen
graublau. Hellrosa Inkarnat.
CVMA W 2504
3 b HL. MÄRTYRER Fig. 18, Abb. 151
Erhaltung: Nur ganz geringfügige Ergänzungen. Auch die Be-
malung ist ziemlich intakt erhalten. Neu sind die Randgläser
und die rechte äußere Randleiste.
Ikonographie: Der ähnlich wie ein Apostel in Tunika und Mantel
gekleidete bärtige Heilige weist seine Märtyrerpalme vor. Weiter
nicht individualisiert, ist er nicht zu benennen.
Komposition: Typus B.
Farbigkeit: Die weiße Tunika ist am Halsausschnitt mit einer
roten, am Saum mit einer goldgelben Borte besetzt. Das gelb-
grüne Manteltuch zeigt rotes Futter. Der gelbe Streifen in dem
Tuch ist nicht ursprünglich, sondern ein mittelalterliches Flick-
stück. Schuhe des Heiligen rot, Nimbus goldgelb, Palme weiß.
Hellrosa Inkarnat.
CVMA W 2505
3 c HL. VITUS Fig. 18, Abb. 152
Erhaltung: Die Scheibe zeigt auffallend viele Sprünge.
Ikonographie: Die brennende Ampel ist das geläufige Attribut
des Hl. Vitus. Unklar bleibt, warum der Heilige von zwar vor-
nehmer, doch nicht fürstlicher Abstammung, hier mit Krone
und Szepter dargestellt ist. Vergleichbare Darstellungen älteren
Datums gibt es nicht: Auf Glasgemälden in der Stadtpfarrkirche
St. Dionys von Esslingen ist das Martyrium des Hl. Vitus darge-
stellt299, in der Stiftskirche von Heiligenkreuz wird die Figur
nur durch die Inschrift kenntlich gemacht300, und in der Kloster-
kirche von Heiligkreuztal befindet sich der Heilige in dem Kes-
sel, in welchem er das Martyrium erlitten hat, und der ihm dort
als Attribut beigegeben ist301.
Komposition: Typus B.
Farbigkeit: Das Rot von Krone, Mantel und Besatz am unteren
Ende des gelbgrünen Gewandes heben den Heiligen als beson-
ders vornehmen Mann heraus. Schuhe in der Farbe des Unterge-
wandes, Mantelfutter, Szepter, Halsborte und Gürtel goldgelb,
Nimbus und Öllämpchen weiß, Flamme und Boden rot - eine
ungemein harmonische Farbkomposition. Die Inkarnatteile sind
von verschieden hellem Rosa.
CVMA W 2506
3d HL. BISCHOF Fig. 18, Abb. 153
Erhaltung: Die Figur ist komplett erhalten, wenn auch die Kon-
turen in schlechtem Zustand sind. Flickstücke im Paßgrund,
Ergänzungen im Teppich.
Ikonographie: Für die Identifizierung des Hl. Bischofs gilt das
zu 2 a Gesagte.
Komposition: Typus A.
Farbigkeit: Die goldgelbe Albe ist mit einer blauen Saumverbrä-
mung verziert. Goldgelb sind auch das Rationale, der Stab, das
Buch und der Nimbus. Gelbgrüne Kasel mit rotem Futter über
weißem Talar; Mitra rot mit weißen Borten und Fanones. Inkar-
nat weiß bzw. hellrosa.
CVMA W 2507
4a HL. RITTER Fig. 18, Abb. 150
Erhaltung: Ausgezeichnet.
Ikonographie: Die übliche Soldatentracht, Kettenpanzer und lan-
ger Waffenrock, ist bei diesem jugendlichen Ritter mit einem
pelzgefütterten Mantel, der allerdings, an den Schultern auflie-
gend, nur den Rücken bedeckt, und einem hermelinverbrämten
Barett ergänzt. Auffällig ist das erhobene blanke Schwert, dessen
Schärfe der Heilige mit der linken Hand zu prüfen scheint. Es
ist möglich, daß damit, wie A. Elsen glaubt, der Hl. Pantaleon
gemeint ist302, doch könnten u.a. auch der Hl. Florian, der
Hl. Gereon und seine Gefährten aus der thebaischen Legion so
dargestellt sein. Einen kleinen Vorzug unter den vielen Soldaten-
heiligen derartiger Ikonographie könnte man dem Hl. Martin
zubilligen, deutet man das erhobene Schwert als Hinweis auf
die Mantelteilung. Auch an der Westwand des Regensburger
Domes bildet die Martinsgruppe das Pendant zu einer Reitersta-
tue des Hl. Georg, allerdings ist Martin dort barhäuptig303.
Komposition: Typus A. Wiewohl die Komposition durchaus pas-
send in Bahn a untergebracht ist, wäre es wegen ihrer fast sym-
metrischen Anlage ebensogut möglich, daß sie einst in Bahn d
gesessen hat. In diesem Fall könnte man das Feld gegen die
unglücklich plazierte Oswaldscheibe (2d) austauschen.
Farbigkeit: Goldgelb sind Kettenhemd mit zugehörigen Bein-
kleidern und Nimbus. Gelbgrüner Waffenrock. Mantel und Ba-
rett blau mit weißem Pelzfutter. Weißes Schwert. Hellrosa Inkar-
nat.
CVMA W 2508
299 In Chorfenster nord II sind dort sogar zwei Abschnitte seines Marter-
todes zu sehen (CVMA Deutschland I, 1, 1958, Abb. 72, 80).
300 Chorfenster südost II (CVMA Österreich II, 1, 1972, Abb. 423).
301 Diese Darstellung aus Chorfenster I ist abgebildet in: CVMA
Deutschland I, 1, 1958, Abb. 440.
302 A. Elsen, 1940, S. 75, sieht Beziehungen zu der mit PANTALEON
bezeichneten Figur auf dem sog. »Nothelfer«-Fresko in der Regensbur-
ger Dominikanerkirche (»wie dort als Ritter mit Stahlhelm, Mantel und
Spitzhut, das Schwert geschultert und mit der Linken dessen Schneide
prüfend«).
303 Abgebildet u.a. in: BGBR 10, 1976, Taf. 17. — A. Hubel, 1981a,
S. 24: »... die Reiterfiguren der Hll. Georg und Martin ... sind als
die beiden damals meist verehrten Ritterheiligen zur > Bewachung < des
Eingangs aufgestellt worden«. — J. Braun, 1943, Sp. 509—520, schreibt,
der Hl. Martin trage als Soldat enge Beinkleider, den Waffenrock, Mantel
und Barett. Eine allerdings erst um 1480 entstandene Martinsgruppe
aus Zeitlarn bei Passau (München, BNM) entspricht recht genau der
Darstellung unseres Ritters (J. Braun, 1943, Abb. 273).
HAUPTCHOR
Teil des Gewandes enthält einige Flickscherben. Hintergrund
und Borten stärker ergänzt. Randgläser bis auf Reste neu.
Schwarzlotschäden gesichert.
Ikonographie: Außer dieser Hl. Jungfrau sind Katharina (5 a) und
Margareta (jd) vertreten. Es ist daher höchst wahrscheinliclf,
daß diese Märtyrerin, welche kein individuelles Attribut trägt,
die Hl. Barbara, die dritte der virgines capitales, vorstellen soll.
Komposition: Typus A.
Farbigkeit: Um das goldgelbe Untergewand ist ein gelbgrünes
Manteltuch mit roter Borte und goldgelbem Futter drapiert.
Palme (goldgelb) und Krone (gelbgrün) wiederholen den subti-
len Farbakkord der Gewandung. Nimbus und Bodenschollen
graublau. Hellrosa Inkarnat.
CVMA W 2504
3 b HL. MÄRTYRER Fig. 18, Abb. 151
Erhaltung: Nur ganz geringfügige Ergänzungen. Auch die Be-
malung ist ziemlich intakt erhalten. Neu sind die Randgläser
und die rechte äußere Randleiste.
Ikonographie: Der ähnlich wie ein Apostel in Tunika und Mantel
gekleidete bärtige Heilige weist seine Märtyrerpalme vor. Weiter
nicht individualisiert, ist er nicht zu benennen.
Komposition: Typus B.
Farbigkeit: Die weiße Tunika ist am Halsausschnitt mit einer
roten, am Saum mit einer goldgelben Borte besetzt. Das gelb-
grüne Manteltuch zeigt rotes Futter. Der gelbe Streifen in dem
Tuch ist nicht ursprünglich, sondern ein mittelalterliches Flick-
stück. Schuhe des Heiligen rot, Nimbus goldgelb, Palme weiß.
Hellrosa Inkarnat.
CVMA W 2505
3 c HL. VITUS Fig. 18, Abb. 152
Erhaltung: Die Scheibe zeigt auffallend viele Sprünge.
Ikonographie: Die brennende Ampel ist das geläufige Attribut
des Hl. Vitus. Unklar bleibt, warum der Heilige von zwar vor-
nehmer, doch nicht fürstlicher Abstammung, hier mit Krone
und Szepter dargestellt ist. Vergleichbare Darstellungen älteren
Datums gibt es nicht: Auf Glasgemälden in der Stadtpfarrkirche
St. Dionys von Esslingen ist das Martyrium des Hl. Vitus darge-
stellt299, in der Stiftskirche von Heiligenkreuz wird die Figur
nur durch die Inschrift kenntlich gemacht300, und in der Kloster-
kirche von Heiligkreuztal befindet sich der Heilige in dem Kes-
sel, in welchem er das Martyrium erlitten hat, und der ihm dort
als Attribut beigegeben ist301.
Komposition: Typus B.
Farbigkeit: Das Rot von Krone, Mantel und Besatz am unteren
Ende des gelbgrünen Gewandes heben den Heiligen als beson-
ders vornehmen Mann heraus. Schuhe in der Farbe des Unterge-
wandes, Mantelfutter, Szepter, Halsborte und Gürtel goldgelb,
Nimbus und Öllämpchen weiß, Flamme und Boden rot - eine
ungemein harmonische Farbkomposition. Die Inkarnatteile sind
von verschieden hellem Rosa.
CVMA W 2506
3d HL. BISCHOF Fig. 18, Abb. 153
Erhaltung: Die Figur ist komplett erhalten, wenn auch die Kon-
turen in schlechtem Zustand sind. Flickstücke im Paßgrund,
Ergänzungen im Teppich.
Ikonographie: Für die Identifizierung des Hl. Bischofs gilt das
zu 2 a Gesagte.
Komposition: Typus A.
Farbigkeit: Die goldgelbe Albe ist mit einer blauen Saumverbrä-
mung verziert. Goldgelb sind auch das Rationale, der Stab, das
Buch und der Nimbus. Gelbgrüne Kasel mit rotem Futter über
weißem Talar; Mitra rot mit weißen Borten und Fanones. Inkar-
nat weiß bzw. hellrosa.
CVMA W 2507
4a HL. RITTER Fig. 18, Abb. 150
Erhaltung: Ausgezeichnet.
Ikonographie: Die übliche Soldatentracht, Kettenpanzer und lan-
ger Waffenrock, ist bei diesem jugendlichen Ritter mit einem
pelzgefütterten Mantel, der allerdings, an den Schultern auflie-
gend, nur den Rücken bedeckt, und einem hermelinverbrämten
Barett ergänzt. Auffällig ist das erhobene blanke Schwert, dessen
Schärfe der Heilige mit der linken Hand zu prüfen scheint. Es
ist möglich, daß damit, wie A. Elsen glaubt, der Hl. Pantaleon
gemeint ist302, doch könnten u.a. auch der Hl. Florian, der
Hl. Gereon und seine Gefährten aus der thebaischen Legion so
dargestellt sein. Einen kleinen Vorzug unter den vielen Soldaten-
heiligen derartiger Ikonographie könnte man dem Hl. Martin
zubilligen, deutet man das erhobene Schwert als Hinweis auf
die Mantelteilung. Auch an der Westwand des Regensburger
Domes bildet die Martinsgruppe das Pendant zu einer Reitersta-
tue des Hl. Georg, allerdings ist Martin dort barhäuptig303.
Komposition: Typus A. Wiewohl die Komposition durchaus pas-
send in Bahn a untergebracht ist, wäre es wegen ihrer fast sym-
metrischen Anlage ebensogut möglich, daß sie einst in Bahn d
gesessen hat. In diesem Fall könnte man das Feld gegen die
unglücklich plazierte Oswaldscheibe (2d) austauschen.
Farbigkeit: Goldgelb sind Kettenhemd mit zugehörigen Bein-
kleidern und Nimbus. Gelbgrüner Waffenrock. Mantel und Ba-
rett blau mit weißem Pelzfutter. Weißes Schwert. Hellrosa Inkar-
nat.
CVMA W 2508
299 In Chorfenster nord II sind dort sogar zwei Abschnitte seines Marter-
todes zu sehen (CVMA Deutschland I, 1, 1958, Abb. 72, 80).
300 Chorfenster südost II (CVMA Österreich II, 1, 1972, Abb. 423).
301 Diese Darstellung aus Chorfenster I ist abgebildet in: CVMA
Deutschland I, 1, 1958, Abb. 440.
302 A. Elsen, 1940, S. 75, sieht Beziehungen zu der mit PANTALEON
bezeichneten Figur auf dem sog. »Nothelfer«-Fresko in der Regensbur-
ger Dominikanerkirche (»wie dort als Ritter mit Stahlhelm, Mantel und
Spitzhut, das Schwert geschultert und mit der Linken dessen Schneide
prüfend«).
303 Abgebildet u.a. in: BGBR 10, 1976, Taf. 17. — A. Hubel, 1981a,
S. 24: »... die Reiterfiguren der Hll. Georg und Martin ... sind als
die beiden damals meist verehrten Ritterheiligen zur > Bewachung < des
Eingangs aufgestellt worden«. — J. Braun, 1943, Sp. 509—520, schreibt,
der Hl. Martin trage als Soldat enge Beinkleider, den Waffenrock, Mantel
und Barett. Eine allerdings erst um 1480 entstandene Martinsgruppe
aus Zeitlarn bei Passau (München, BNM) entspricht recht genau der
Darstellung unseres Ritters (J. Braun, 1943, Abb. 273).