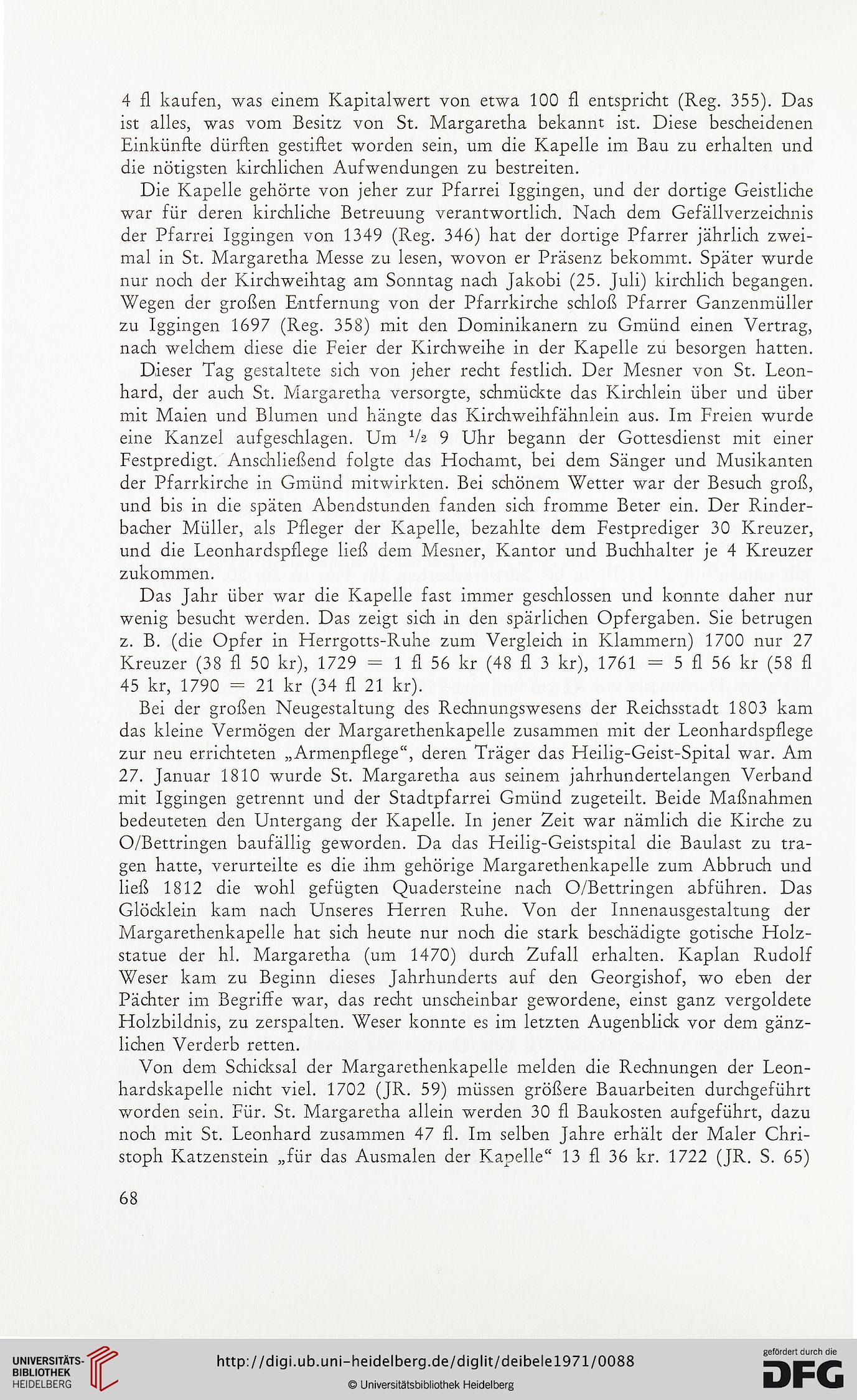4 fl kaufen, was einem Kapitalwert von etwa 100 fl entspricht (Reg. 355). Das
ist alles, was vom Besitz von St. Margaretha bekannt ist. Diese bescheidenen
Einkünfte dürften gestiftet worden sein, um die Kapelle im Bau zu erhalten und
die nötigsten kirchlichen Aufwendungen zu bestreiten.
Die Kapelle gehörte von jeher zur Pfarrei Iggingen, und der dortige Geistliche
war für deren kirchliche Betreuung verantwortlich. Nach dem Gefällverzeichnis
der Pfarrei Iggingen von 1349 (Reg. 346) hat der dortige Pfarrer jährlich zwei-
mal in St. Margaretha Messe zu lesen, wovon er Präsenz bekommt. Später wurde
nur noch der Kirchweihtag am Sonntag nach Jakobi (25. Juli) kirchlich begangen.
Wegen der großen Entfernung von der Pfarrkirche schloß Pfarrer Ganzenmüller
zu Iggingen 1697 (Reg. 358) mit den Dominikanern zu Gmünd einen Vertrag,
nach welchem diese die Feier der Kirchweihe in der Kapelle zu besorgen hatten.
Dieser Tag gestaltete sich von jeher recht festlich. Der Mesner von St. Leon-
hard, der auch St. Margaretha versorgte, schmückte das Kirchlein über und über
mit Maien und Blumen und hängte das Kirchweihfähnlein aus. Im Freien wurde
eine Kanzel aufgeschlagen. Um V2 9 Uhr begann der Gottesdienst mit einer
Festpredigt. Anschließend folgte das Hochamt, bei dem Sänger und Musikanten
der Pfarrkirche in Gmünd mitwirkten. Bei schönem Wetter war der Besuch groß,
und bis in die späten Abendstunden fanden sich fromme Beter ein. Der Rinder-
bacher Müller, als Pfleger der Kapelle, bezahlte dem Festprediger 30 Kreuzer,
und die Leonhardspflege ließ dem Mesner, Kantor und Buchhalter je 4 Kreuzer
zukommen.
Das Jahr über war die Kapelle fast immer geschlossen und konnte daher nur
wenig besucht werden. Das zeigt sich in den spärlichen Opfergaben. Sie betrugen
z. B. (die Opfer in Herrgotts-Ruhe zum Vergleich in Klammern) 1700 nur 27
Kreuzer (38 fl 50 kr), 1729 = 1 fl 56 kr (48 fl 3 kr), 1761 = 5 fl 56 kr (58 fl
45 kr, 1790 = 21 kr (34 fl 21 kr).
Bei der großen Neugestaltung des Rechnungswesens der Reichsstadt 1803 kam
das kleine Vermögen der Margarethenkapelle zusammen mit der Leonhardspflege
zur neu errichteten „Armenpflege“, deren Träger das Heilig-Geist-Spital war. Am
27. Januar 1810 wurde St. Margaretha aus seinem jahrhundertelangen Verband
mit Iggingen getrennt und der Stadtpfarrei Gmünd zugeteilt. Beide Maßnahmen
bedeuteten den Untergang der Kapelle. In jener Zeit war nämlich die Kirche zu
O/Bettringen baufällig geworden. Da das Heilig-Geistspital die Baulast zu tra-
gen hatte, verurteilte es die ihm gehörige Margarethenkapelle zum Abbruch und
ließ 1812 die wohl gefügten Quadersteine nach O/Bettringen abführen. Das
Glöcklein kam nach Unseres Herren Ruhe. Von der Innenausgestaltung der
Margarethenkapelle hat sich heute nur noch die stark beschädigte gotische Holz-
statue der hl. Margaretha (um 1470) durch Zufall erhalten. Kaplan Rudolf
Weser kam zu Beginn dieses Jahrhunderts auf den Georgishof, wo eben der
Pächter im Begriffe war, das recht unscheinbar gewordene, einst ganz vergoldete
Holzbildnis, zu zerspalten. Weser konnte es im letzten Augenblick vor dem gänz-
lichen Verderb retten.
Von dem Schicksal der Margarethenkapelle melden die Rechnungen der Leon-
hardskapelle nicht viel. 1702 (JR. 59) müssen größere Bauarbeiten durchgeführt
worden sein. Für. St. Margaretha allein werden 30 fl Baukosten aufgeführt, dazu
noch mit St. Leonhard zusammen 47 fl. Im selben Jahre erhält der Maler Chri-
stoph Katzenstein „für das Ausmalen der Kapelle“ 13 fl 36 kr. 1722 (JR. S. 65)
68
ist alles, was vom Besitz von St. Margaretha bekannt ist. Diese bescheidenen
Einkünfte dürften gestiftet worden sein, um die Kapelle im Bau zu erhalten und
die nötigsten kirchlichen Aufwendungen zu bestreiten.
Die Kapelle gehörte von jeher zur Pfarrei Iggingen, und der dortige Geistliche
war für deren kirchliche Betreuung verantwortlich. Nach dem Gefällverzeichnis
der Pfarrei Iggingen von 1349 (Reg. 346) hat der dortige Pfarrer jährlich zwei-
mal in St. Margaretha Messe zu lesen, wovon er Präsenz bekommt. Später wurde
nur noch der Kirchweihtag am Sonntag nach Jakobi (25. Juli) kirchlich begangen.
Wegen der großen Entfernung von der Pfarrkirche schloß Pfarrer Ganzenmüller
zu Iggingen 1697 (Reg. 358) mit den Dominikanern zu Gmünd einen Vertrag,
nach welchem diese die Feier der Kirchweihe in der Kapelle zu besorgen hatten.
Dieser Tag gestaltete sich von jeher recht festlich. Der Mesner von St. Leon-
hard, der auch St. Margaretha versorgte, schmückte das Kirchlein über und über
mit Maien und Blumen und hängte das Kirchweihfähnlein aus. Im Freien wurde
eine Kanzel aufgeschlagen. Um V2 9 Uhr begann der Gottesdienst mit einer
Festpredigt. Anschließend folgte das Hochamt, bei dem Sänger und Musikanten
der Pfarrkirche in Gmünd mitwirkten. Bei schönem Wetter war der Besuch groß,
und bis in die späten Abendstunden fanden sich fromme Beter ein. Der Rinder-
bacher Müller, als Pfleger der Kapelle, bezahlte dem Festprediger 30 Kreuzer,
und die Leonhardspflege ließ dem Mesner, Kantor und Buchhalter je 4 Kreuzer
zukommen.
Das Jahr über war die Kapelle fast immer geschlossen und konnte daher nur
wenig besucht werden. Das zeigt sich in den spärlichen Opfergaben. Sie betrugen
z. B. (die Opfer in Herrgotts-Ruhe zum Vergleich in Klammern) 1700 nur 27
Kreuzer (38 fl 50 kr), 1729 = 1 fl 56 kr (48 fl 3 kr), 1761 = 5 fl 56 kr (58 fl
45 kr, 1790 = 21 kr (34 fl 21 kr).
Bei der großen Neugestaltung des Rechnungswesens der Reichsstadt 1803 kam
das kleine Vermögen der Margarethenkapelle zusammen mit der Leonhardspflege
zur neu errichteten „Armenpflege“, deren Träger das Heilig-Geist-Spital war. Am
27. Januar 1810 wurde St. Margaretha aus seinem jahrhundertelangen Verband
mit Iggingen getrennt und der Stadtpfarrei Gmünd zugeteilt. Beide Maßnahmen
bedeuteten den Untergang der Kapelle. In jener Zeit war nämlich die Kirche zu
O/Bettringen baufällig geworden. Da das Heilig-Geistspital die Baulast zu tra-
gen hatte, verurteilte es die ihm gehörige Margarethenkapelle zum Abbruch und
ließ 1812 die wohl gefügten Quadersteine nach O/Bettringen abführen. Das
Glöcklein kam nach Unseres Herren Ruhe. Von der Innenausgestaltung der
Margarethenkapelle hat sich heute nur noch die stark beschädigte gotische Holz-
statue der hl. Margaretha (um 1470) durch Zufall erhalten. Kaplan Rudolf
Weser kam zu Beginn dieses Jahrhunderts auf den Georgishof, wo eben der
Pächter im Begriffe war, das recht unscheinbar gewordene, einst ganz vergoldete
Holzbildnis, zu zerspalten. Weser konnte es im letzten Augenblick vor dem gänz-
lichen Verderb retten.
Von dem Schicksal der Margarethenkapelle melden die Rechnungen der Leon-
hardskapelle nicht viel. 1702 (JR. 59) müssen größere Bauarbeiten durchgeführt
worden sein. Für. St. Margaretha allein werden 30 fl Baukosten aufgeführt, dazu
noch mit St. Leonhard zusammen 47 fl. Im selben Jahre erhält der Maler Chri-
stoph Katzenstein „für das Ausmalen der Kapelle“ 13 fl 36 kr. 1722 (JR. S. 65)
68