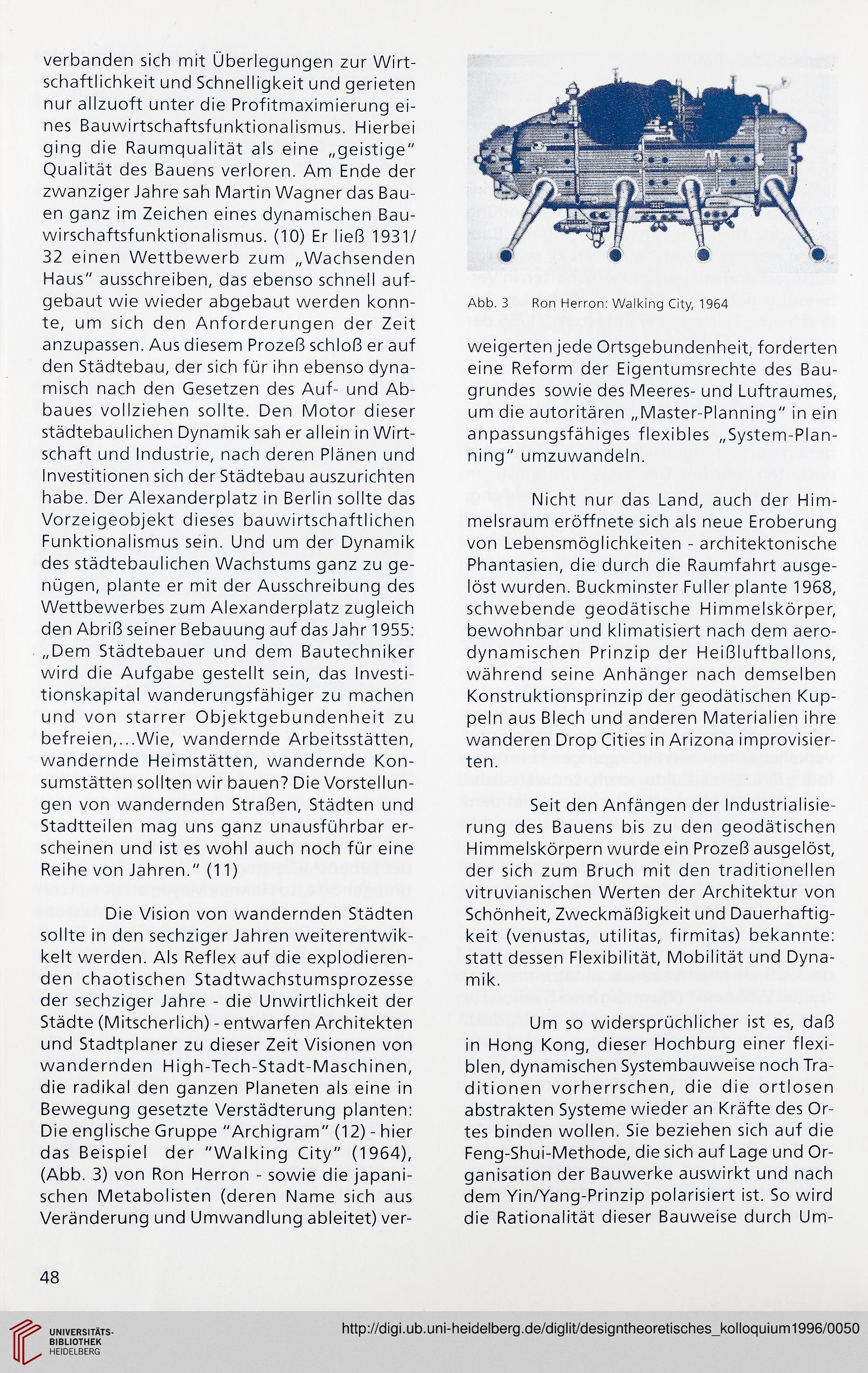verbanden sich mit Überlegungen zur Wirt-
schaftlichkeit und Schnelligkeit und gerieten
nur allzuoft unter die Profitmaximierung ei-
nes Bauwirtschaftsfunktionalismus. Hierbei
ging die Raumqualität als eine „geistige"
Qualität des Bauens verloren. Am Ende der
zwanziger Jahre sah Martin Wagner das Bau-
en ganz im Zeichen eines dynamischen Bau-
wirschaftsfunktionalismus. (10) Er ließ 1931/
32 einen Wettbewerb zum „Wachsenden
Haus" ausschreiben, das ebenso schnell auf-
gebaut wie wieder abgebaut werden konn-
te, um sich den Anforderungen der Zeit
anzupassen. Aus diesem Prozeß schloß er auf
den Städtebau, der sich für ihn ebenso dyna-
misch nach den Gesetzen des Auf- und Ab-
baues vollziehen sollte. Den Motor dieser
städtebaulichen Dynamik sah er allein in Wirt-
schaft und Industrie, nach deren Plänen und
Investitionen sich der Städtebau auszurichten
habe. Der Alexanderplatz in Berlin sollte das
Vorzeigeobjekt dieses bauwirtschaftlichen
Funktionalismus sein. Und um der Dynamik
des städtebaulichen Wachstums ganz zu ge-
nügen, plante er mit der Ausschreibung des
Wettbewerbes zum Alexanderplatz zugleich
den Abriß seiner Bebauung auf das Jahr 1955:
„Dem Städtebauer und dem Bautechniker
wird die Aufgabe gestellt sein, das Investi-
tionskapital wanderungsfähiger zu machen
und von starrer Objektgebundenheit zu
befreien,...Wie, wandernde Arbeitsstätten,
wandernde Heimstätten, wandernde Kon-
sumstätten sollten wir bauen? Die Vorstellun-
gen von wandernden Straßen, Städten und
Stadtteilen mag uns ganz unausführbar er-
scheinen und ist es wohl auch noch für eine
Reihe von Jahren." (11)
Die Vision von wandernden Städten
sollte in den sechziger Jahren weiterentwik-
kelt werden. Als Reflex auf die explodieren-
den chaotischen Stadtwachstumsprozesse
der sechziger Jahre - die Unwirtlichkeit der
Städte (Mitscherlich) - entwarfen Architekten
und Stadtplaner zu dieser Zeit Visionen von
wandernden High-Tech-Stadt-Maschinen,
die radikal den ganzen Planeten als eine in
Bewegung gesetzte Verstädterung planten:
Die englische Gruppe "Archigram" (12) - hier
das Beispiel der "Walking City" (1964),
(Abb. 3) von Ron Herron - sowie die japani-
schen Metabolisten (deren Name sich aus
Veränderung und Umwandlung ableitet) ver-
Abb. 3 Ron Herron: Walking City, 1964
weigerten jede Ortsgebundenheit, forderten
eine Reform der Eigentumsrechte des Bau-
grundes sowie des Meeres- und Luftraumes,
um die autoritären „Master-Planning" in ein
anpassungsfähiges flexibles „System-Plan-
ning" umzuwandeln.
Nicht nur das Land, auch der Him-
melsraum eröffnete sich als neue Eroberung
von Lebensmöglichkeiten - architektonische
Phantasien, die durch die Raumfahrt ausge-
löst wurden. Buckminster Fuller plante 1968,
schwebende geodätische Himmelskörper,
bewohnbar und klimatisiert nach dem aero-
dynamischen Prinzip der Heißluftballons,
während seine Anhänger nach demselben
Konstruktionsprinzip der geodätischen Kup-
peln aus Blech und anderen Materialien ihre
wanderen Drop Cities in Arizona improvisier-
ten.
Seit den Anfängen der IndustriaIisie-
rung des Bauens bis zu den geodätischen
Himmelskörpern wurde ein Prozeß ausgelöst,
der sich zum Bruch mit den traditionellen
vitruvianischen Werten der Architektur von
Schönheit, Zweckmäßigkeit und Dauerhaftig-
keit (venustas, utilitas, firmitas) bekannte:
statt dessen Flexibilität, Mobilität und Dyna-
mik.
Um so widersprüchlicher ist es, daß
in Hong Kong, dieser Hochburg einer flexi-
blen, dynamischen Systembauweise noch Tra-
ditionen vorherrschen, die die ortlosen
abstrakten Systeme wieder an Kräfte des Or-
tes binden wollen. Sie beziehen sich auf die
Feng-Shui-Methode, die sich auf Lage und Or-
ganisation der Bauwerke auswirkt und nach
dem Yin/Yang-Prinzip polarisiert ist. So wird
die Rationalität dieser Bauweise durch Um-
48
schaftlichkeit und Schnelligkeit und gerieten
nur allzuoft unter die Profitmaximierung ei-
nes Bauwirtschaftsfunktionalismus. Hierbei
ging die Raumqualität als eine „geistige"
Qualität des Bauens verloren. Am Ende der
zwanziger Jahre sah Martin Wagner das Bau-
en ganz im Zeichen eines dynamischen Bau-
wirschaftsfunktionalismus. (10) Er ließ 1931/
32 einen Wettbewerb zum „Wachsenden
Haus" ausschreiben, das ebenso schnell auf-
gebaut wie wieder abgebaut werden konn-
te, um sich den Anforderungen der Zeit
anzupassen. Aus diesem Prozeß schloß er auf
den Städtebau, der sich für ihn ebenso dyna-
misch nach den Gesetzen des Auf- und Ab-
baues vollziehen sollte. Den Motor dieser
städtebaulichen Dynamik sah er allein in Wirt-
schaft und Industrie, nach deren Plänen und
Investitionen sich der Städtebau auszurichten
habe. Der Alexanderplatz in Berlin sollte das
Vorzeigeobjekt dieses bauwirtschaftlichen
Funktionalismus sein. Und um der Dynamik
des städtebaulichen Wachstums ganz zu ge-
nügen, plante er mit der Ausschreibung des
Wettbewerbes zum Alexanderplatz zugleich
den Abriß seiner Bebauung auf das Jahr 1955:
„Dem Städtebauer und dem Bautechniker
wird die Aufgabe gestellt sein, das Investi-
tionskapital wanderungsfähiger zu machen
und von starrer Objektgebundenheit zu
befreien,...Wie, wandernde Arbeitsstätten,
wandernde Heimstätten, wandernde Kon-
sumstätten sollten wir bauen? Die Vorstellun-
gen von wandernden Straßen, Städten und
Stadtteilen mag uns ganz unausführbar er-
scheinen und ist es wohl auch noch für eine
Reihe von Jahren." (11)
Die Vision von wandernden Städten
sollte in den sechziger Jahren weiterentwik-
kelt werden. Als Reflex auf die explodieren-
den chaotischen Stadtwachstumsprozesse
der sechziger Jahre - die Unwirtlichkeit der
Städte (Mitscherlich) - entwarfen Architekten
und Stadtplaner zu dieser Zeit Visionen von
wandernden High-Tech-Stadt-Maschinen,
die radikal den ganzen Planeten als eine in
Bewegung gesetzte Verstädterung planten:
Die englische Gruppe "Archigram" (12) - hier
das Beispiel der "Walking City" (1964),
(Abb. 3) von Ron Herron - sowie die japani-
schen Metabolisten (deren Name sich aus
Veränderung und Umwandlung ableitet) ver-
Abb. 3 Ron Herron: Walking City, 1964
weigerten jede Ortsgebundenheit, forderten
eine Reform der Eigentumsrechte des Bau-
grundes sowie des Meeres- und Luftraumes,
um die autoritären „Master-Planning" in ein
anpassungsfähiges flexibles „System-Plan-
ning" umzuwandeln.
Nicht nur das Land, auch der Him-
melsraum eröffnete sich als neue Eroberung
von Lebensmöglichkeiten - architektonische
Phantasien, die durch die Raumfahrt ausge-
löst wurden. Buckminster Fuller plante 1968,
schwebende geodätische Himmelskörper,
bewohnbar und klimatisiert nach dem aero-
dynamischen Prinzip der Heißluftballons,
während seine Anhänger nach demselben
Konstruktionsprinzip der geodätischen Kup-
peln aus Blech und anderen Materialien ihre
wanderen Drop Cities in Arizona improvisier-
ten.
Seit den Anfängen der IndustriaIisie-
rung des Bauens bis zu den geodätischen
Himmelskörpern wurde ein Prozeß ausgelöst,
der sich zum Bruch mit den traditionellen
vitruvianischen Werten der Architektur von
Schönheit, Zweckmäßigkeit und Dauerhaftig-
keit (venustas, utilitas, firmitas) bekannte:
statt dessen Flexibilität, Mobilität und Dyna-
mik.
Um so widersprüchlicher ist es, daß
in Hong Kong, dieser Hochburg einer flexi-
blen, dynamischen Systembauweise noch Tra-
ditionen vorherrschen, die die ortlosen
abstrakten Systeme wieder an Kräfte des Or-
tes binden wollen. Sie beziehen sich auf die
Feng-Shui-Methode, die sich auf Lage und Or-
ganisation der Bauwerke auswirkt und nach
dem Yin/Yang-Prinzip polarisiert ist. So wird
die Rationalität dieser Bauweise durch Um-
48