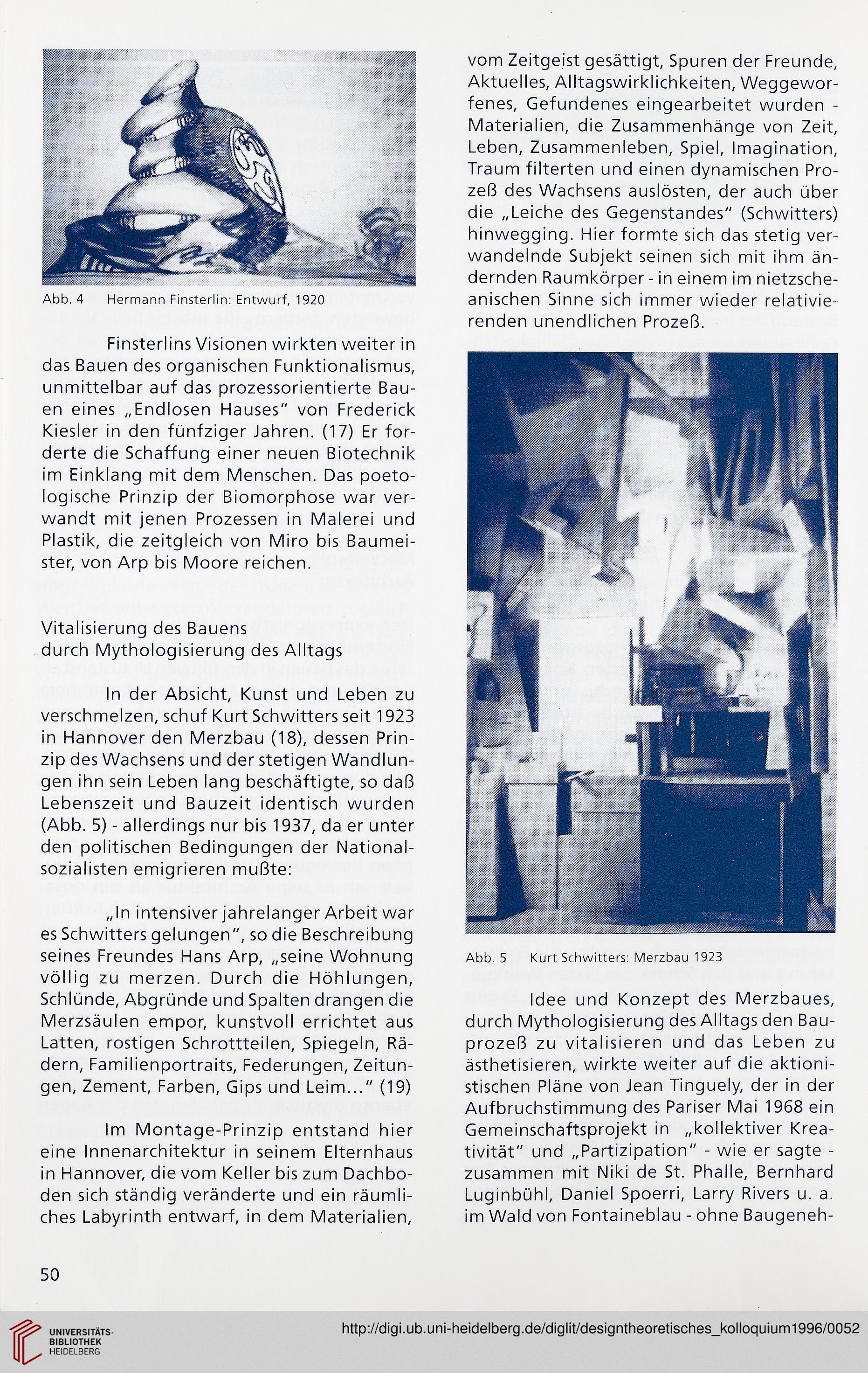Abb. 4 Hermann Finsterlin: Entwurf, 1920
Finsterlins Visionen wirkten weiter in
das Bauen des organischen Funktionalismus,
unmittelbar auf das prozessorientierte Bau-
en eines „Endlosen Flauses" von Frederick
Kiesler in den fünfziger Jahren. (17) Er for-
derte die Schaffung einer neuen Biotechnik
im Einklang mit dem Menschen. Das poeto-
logische Prinzip der Biomorphose war ver-
wandt mit jenen Prozessen in Malerei und
Plastik, die zeitgleich von Miro bis Baumei-
ster, von Arp bis Moore reichen.
Vitalisierung des Bauens
durch Mythologisierung des Alltags
In der Absicht, Kunst und Leben zu
verschmelzen, schuf Kurt Schwitters seit 1923
in Hannover den Merzbau (18), dessen Prin-
zip des Wachsens und der stetigen Wandlun-
gen ihn sein Leben lang beschäftigte, so daß
Lebenszeit und Bauzeit identisch wurden
(Abb. 5) - allerdings nur bis 1937, da er unter
den politischen Bedingungen der National-
sozialisten emigrieren mußte:
„In intensiver jahrelanger Arbeit war
es Schwitters geiungen", so die Beschreibung
seines Freundes Hans Arp, „seine Wohnung
vöilig zu merzen. Durch die Höhlungen,
Schlünde, Abgründe und Spalten drangen die
Merzsäulen empor, kunstvoll errichtet aus
Latten, rostigen Schrottteilen, Spiegeln, Rä-
dern, Familienportraits, Federungen, Zeitun-
gen, Zement, Farben, Gips und Leim..." (19)
Im Montage-Prinzip entstand hier
eine Innenarchitektur in seinem Elternhaus
in Hannover, die vom Keller bis zum Dachbo-
den sich ständig veränderte und ein räumli-
ches Labyrinth entwarf, in dem Materialien,
vom Zeitgeist gesättigt, Spuren der Freunde,
Aktuelles, Alltagswirklichkeiten, Weggewor-
fenes, Gefundenes eingearbeitet wurden -
Materiaiien, die Zusammenhänge von Zeit,
Leben, Zusammenleben, Spiel, Imagination,
Traum filterten und einen dynamischen Pro-
zeß des Wachsens auslösten, der auch über
die „Leiche des Gegenstandes" (Schwitters)
hinwegging. Hier formte sich das stetig ver-
wandelnde Subjekt seinen sich mit ihm än-
dernden Raumkörper- in einem im nietzsche-
anischen Sinne sich immer wieder relativie-
renden unendlichen Prozeß.
Abb. 5 Kurt Schwitters: Merzbau 1923
Idee und Konzept des Merzbaues,
durch Mythologisierung des Alltags den Bau-
prozeß zu vitalisieren und das Leben zu
ästhetisieren, wirkte weiter auf die aktioni-
stischen Pläne von Jean Tinguely, der in der
Aufbruchstimmung des Pariser Mai 1968 ein
Gemeinschaftsprojekt in „kollektiver Krea-
tivität" und „Partizipation" - wie er sagte -
zusammen mit Niki de St. Phalle, Bernhard
Luginbühl, Daniel Spoerri, Larry Rivers u. a.
im Wald von Fontaineblau - ohne Baugeneh-
50
Finsterlins Visionen wirkten weiter in
das Bauen des organischen Funktionalismus,
unmittelbar auf das prozessorientierte Bau-
en eines „Endlosen Flauses" von Frederick
Kiesler in den fünfziger Jahren. (17) Er for-
derte die Schaffung einer neuen Biotechnik
im Einklang mit dem Menschen. Das poeto-
logische Prinzip der Biomorphose war ver-
wandt mit jenen Prozessen in Malerei und
Plastik, die zeitgleich von Miro bis Baumei-
ster, von Arp bis Moore reichen.
Vitalisierung des Bauens
durch Mythologisierung des Alltags
In der Absicht, Kunst und Leben zu
verschmelzen, schuf Kurt Schwitters seit 1923
in Hannover den Merzbau (18), dessen Prin-
zip des Wachsens und der stetigen Wandlun-
gen ihn sein Leben lang beschäftigte, so daß
Lebenszeit und Bauzeit identisch wurden
(Abb. 5) - allerdings nur bis 1937, da er unter
den politischen Bedingungen der National-
sozialisten emigrieren mußte:
„In intensiver jahrelanger Arbeit war
es Schwitters geiungen", so die Beschreibung
seines Freundes Hans Arp, „seine Wohnung
vöilig zu merzen. Durch die Höhlungen,
Schlünde, Abgründe und Spalten drangen die
Merzsäulen empor, kunstvoll errichtet aus
Latten, rostigen Schrottteilen, Spiegeln, Rä-
dern, Familienportraits, Federungen, Zeitun-
gen, Zement, Farben, Gips und Leim..." (19)
Im Montage-Prinzip entstand hier
eine Innenarchitektur in seinem Elternhaus
in Hannover, die vom Keller bis zum Dachbo-
den sich ständig veränderte und ein räumli-
ches Labyrinth entwarf, in dem Materialien,
vom Zeitgeist gesättigt, Spuren der Freunde,
Aktuelles, Alltagswirklichkeiten, Weggewor-
fenes, Gefundenes eingearbeitet wurden -
Materiaiien, die Zusammenhänge von Zeit,
Leben, Zusammenleben, Spiel, Imagination,
Traum filterten und einen dynamischen Pro-
zeß des Wachsens auslösten, der auch über
die „Leiche des Gegenstandes" (Schwitters)
hinwegging. Hier formte sich das stetig ver-
wandelnde Subjekt seinen sich mit ihm än-
dernden Raumkörper- in einem im nietzsche-
anischen Sinne sich immer wieder relativie-
renden unendlichen Prozeß.
Abb. 5 Kurt Schwitters: Merzbau 1923
Idee und Konzept des Merzbaues,
durch Mythologisierung des Alltags den Bau-
prozeß zu vitalisieren und das Leben zu
ästhetisieren, wirkte weiter auf die aktioni-
stischen Pläne von Jean Tinguely, der in der
Aufbruchstimmung des Pariser Mai 1968 ein
Gemeinschaftsprojekt in „kollektiver Krea-
tivität" und „Partizipation" - wie er sagte -
zusammen mit Niki de St. Phalle, Bernhard
Luginbühl, Daniel Spoerri, Larry Rivers u. a.
im Wald von Fontaineblau - ohne Baugeneh-
50