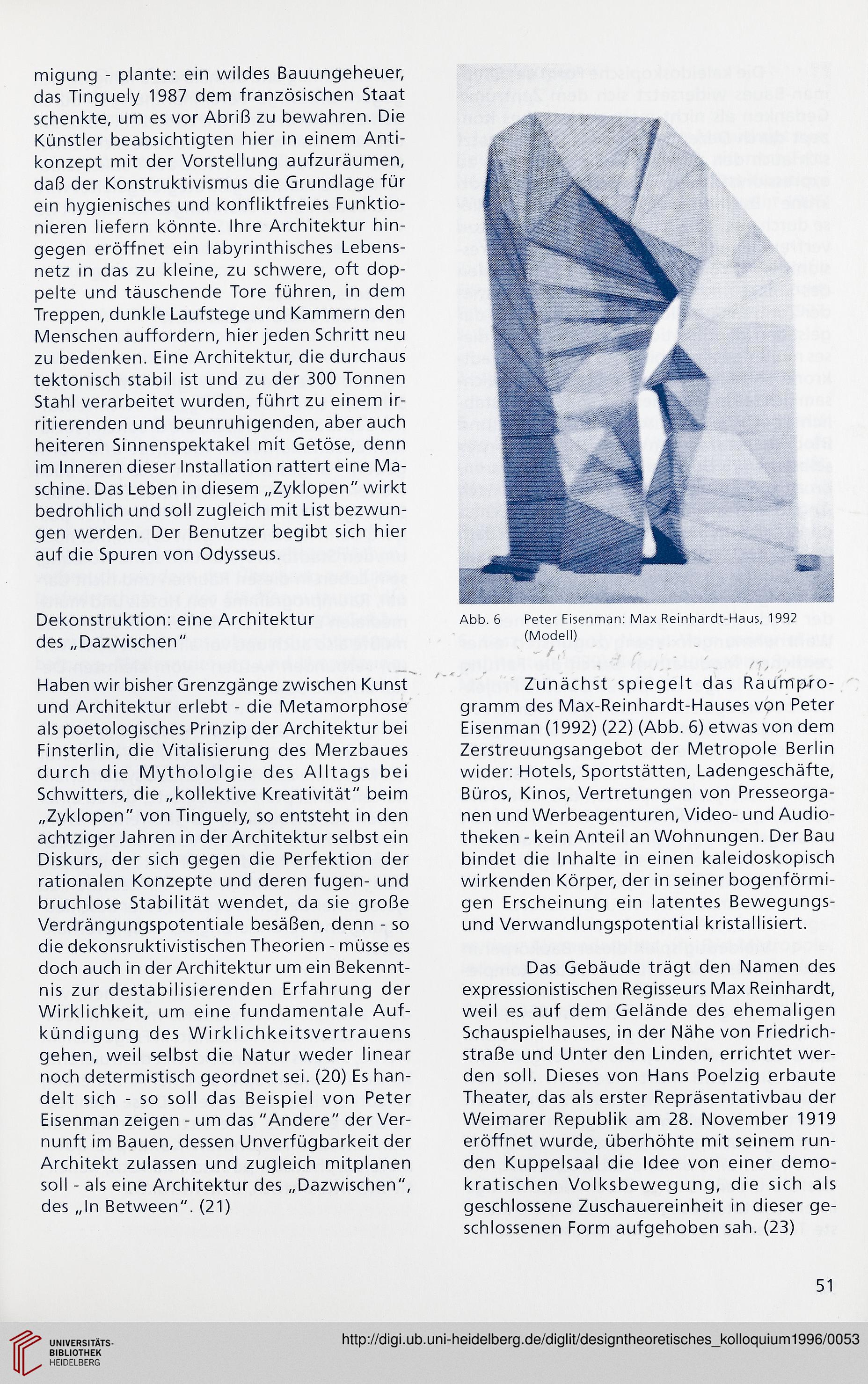migung - plante: ein wildes Bauungeheuer,
das Tinguely 1987 dem französischen Staat
schenkte, um es vor Abriß zu bewahren. Die
Künstler beabsichtigten hier in einem Anti-
konzept mit der Vorstellung aufzuräumen,
daß der Konstruktivismus die Grundlage für
ein hygienisches und konfliktfreies Funktio-
nieren liefern könnte. Ihre Architektur hin-
gegen eröffnet ein labyrinthisches Lebens-
netz in das zu kleine, zu schwere, oft dop-
pelte und täuschende Tore führen, in dem
Treppen, dunkle Laufstege und Kammern den
Menschen auffordern, hier jeden Schritt neu
zu bedenken. Eine Architektur, die durchaus
tektonisch stabil ist und zu der 300 Tonnen
Stahl verarbeitet wurden, führt zu einem ir-
ritierenden und beunruhigenden, aberauch
heiteren Sinnenspektakel mit Getöse, denn
im Inneren dieser Installation rattert eine Ma-
schine. Das Leben in diesem „Zyklopen" wirkt
bedrohlich und soll zugleich mit List bezwun-
gen werden. Der Benutzer begibt sich hier
auf die Spuren von Odysseus.
Dekonstruktion: eine Architektur
des „Dazwischen"
Haben wir bisher Grenzgänge zwischen Kunst
und Architektur erlebt - die Metamorphose
als poetologisches Prinzip der Architektur bei
Finsterlin, die Vitalisierung des Merzbaues
durch die Mythololgie des Alltags bei
Schwitters, die „kollektive Kreativität" beim
„Zyklopen" von Tinguely, so entsteht in den
achtziger Jahren in der Architektur selbst ein
Diskurs, der sich gegen die Perfektion der
rationalen Konzepte und deren fugen- und
bruchlose Stabilität wendet, da sie große
Verdrängungspotentiale besäßen, denn - so
die dekonsruktivistischen Theorien - müsse es
doch auch in der Architektur um ein Bekennt-
nis zur destabilisierenden Erfahrung der
Wirklichkeit, um eine fundamentale Auf-
kündigung des Wirklichkeitsvertrauens
gehen, weil selbst die Natur weder linear
noch determistisch geordnet sei. (20) Es han-
delt sich - so soll das Beispiel von Peter
Eisenman zeigen - um das "Andere" der Ver-
nunft im Bauen, dessen Unverfügbarkeit der
Architekt zulassen und zugleich mitplanen
soll - als eine Architektur des „Dazwischen",
des „In Between". (21)
Abb. 6 Peter Eisenman: Max Reinhardt-Haus, 1992
(Modell)
Zunächst spiegelt das Raumpro-
gramm des Max-Reinhardt-Hauses von Peter
Eisenman (1992) (22) (Abb. 6) etwas von dem
Zerstreuungsangebot der Metropole Berlin
wider: Hotels, Sportstätten, Ladengeschäfte,
Büros, Kinos, Vertretungen von Presseorga-
nen und Werbeagenturen, Video- und Audio-
theken - kein Anteil an Wohnungen. Der Bau
bindet die Inhalte in einen kaleidoskopisch
wirkenden Körper, der in seiner bogenförmi-
gen Erscheinung ein latentes Bewegungs-
und Verwandlungspotential krista11isiert.
Das Gebäude trägt den Namen des
expressionistischen Regisseurs Max Reinhardt,
weil es auf dem Gelände des ehemaligen
Schauspielhauses, in der Nähe von Friedrich-
straße und Unter den Linden, errichtet wer-
den soll. Dieses von Hans Poelzig erbaute
Theater, das als erster Repräsentativbau der
Weimarer Republik am 28. November 1919
eröffnet wurde, überhöhte mit seinem run-
den Kuppelsaal die Idee von einer demo-
kratischen Volksbewegung, die sich als
geschlossene Zuschauereinheit in dieser ge-
schlossenen Form aufgehoben sah. (23)
51
das Tinguely 1987 dem französischen Staat
schenkte, um es vor Abriß zu bewahren. Die
Künstler beabsichtigten hier in einem Anti-
konzept mit der Vorstellung aufzuräumen,
daß der Konstruktivismus die Grundlage für
ein hygienisches und konfliktfreies Funktio-
nieren liefern könnte. Ihre Architektur hin-
gegen eröffnet ein labyrinthisches Lebens-
netz in das zu kleine, zu schwere, oft dop-
pelte und täuschende Tore führen, in dem
Treppen, dunkle Laufstege und Kammern den
Menschen auffordern, hier jeden Schritt neu
zu bedenken. Eine Architektur, die durchaus
tektonisch stabil ist und zu der 300 Tonnen
Stahl verarbeitet wurden, führt zu einem ir-
ritierenden und beunruhigenden, aberauch
heiteren Sinnenspektakel mit Getöse, denn
im Inneren dieser Installation rattert eine Ma-
schine. Das Leben in diesem „Zyklopen" wirkt
bedrohlich und soll zugleich mit List bezwun-
gen werden. Der Benutzer begibt sich hier
auf die Spuren von Odysseus.
Dekonstruktion: eine Architektur
des „Dazwischen"
Haben wir bisher Grenzgänge zwischen Kunst
und Architektur erlebt - die Metamorphose
als poetologisches Prinzip der Architektur bei
Finsterlin, die Vitalisierung des Merzbaues
durch die Mythololgie des Alltags bei
Schwitters, die „kollektive Kreativität" beim
„Zyklopen" von Tinguely, so entsteht in den
achtziger Jahren in der Architektur selbst ein
Diskurs, der sich gegen die Perfektion der
rationalen Konzepte und deren fugen- und
bruchlose Stabilität wendet, da sie große
Verdrängungspotentiale besäßen, denn - so
die dekonsruktivistischen Theorien - müsse es
doch auch in der Architektur um ein Bekennt-
nis zur destabilisierenden Erfahrung der
Wirklichkeit, um eine fundamentale Auf-
kündigung des Wirklichkeitsvertrauens
gehen, weil selbst die Natur weder linear
noch determistisch geordnet sei. (20) Es han-
delt sich - so soll das Beispiel von Peter
Eisenman zeigen - um das "Andere" der Ver-
nunft im Bauen, dessen Unverfügbarkeit der
Architekt zulassen und zugleich mitplanen
soll - als eine Architektur des „Dazwischen",
des „In Between". (21)
Abb. 6 Peter Eisenman: Max Reinhardt-Haus, 1992
(Modell)
Zunächst spiegelt das Raumpro-
gramm des Max-Reinhardt-Hauses von Peter
Eisenman (1992) (22) (Abb. 6) etwas von dem
Zerstreuungsangebot der Metropole Berlin
wider: Hotels, Sportstätten, Ladengeschäfte,
Büros, Kinos, Vertretungen von Presseorga-
nen und Werbeagenturen, Video- und Audio-
theken - kein Anteil an Wohnungen. Der Bau
bindet die Inhalte in einen kaleidoskopisch
wirkenden Körper, der in seiner bogenförmi-
gen Erscheinung ein latentes Bewegungs-
und Verwandlungspotential krista11isiert.
Das Gebäude trägt den Namen des
expressionistischen Regisseurs Max Reinhardt,
weil es auf dem Gelände des ehemaligen
Schauspielhauses, in der Nähe von Friedrich-
straße und Unter den Linden, errichtet wer-
den soll. Dieses von Hans Poelzig erbaute
Theater, das als erster Repräsentativbau der
Weimarer Republik am 28. November 1919
eröffnet wurde, überhöhte mit seinem run-
den Kuppelsaal die Idee von einer demo-
kratischen Volksbewegung, die sich als
geschlossene Zuschauereinheit in dieser ge-
schlossenen Form aufgehoben sah. (23)
51