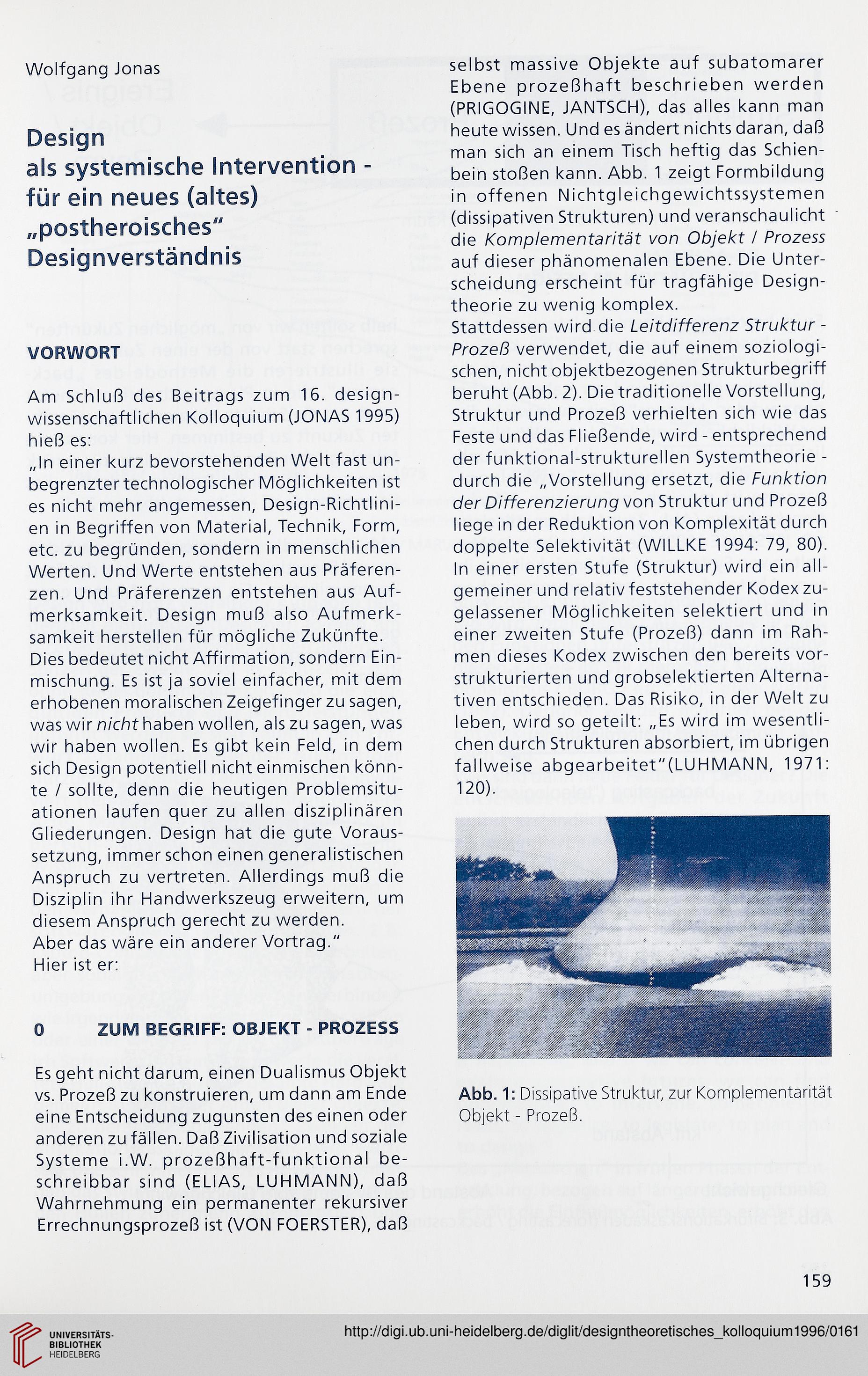Wolfgang Jonas
Design
als systemische Intervention -
für ein neues (altes)
„postheroisches"
Designverständnis
VORWORT
Am Schluß des Beitrags zum 16. design-
wissenschaftlichen Kolloquium (JONAS 1995)
hieß es:
„In einer kurz bevorstehenden Welt fast un-
begrenztertechnologischer Möglichkeiten ist
es nicht mehr angemessen, Design-Richtlini-
en in Begriffen von Material, Technik, Form,
etc. zu begründen, sondern in menschlichen
Werten. Und Werte entstehen aus Präferen-
zen. Und Präferenzen entstehen aus Auf-
merksamkeit. Design muß also Aufmerk-
samkeit herstellen für mögliche Zukünfte.
Dies bedeutet nicht Affirmation, sondern Ein-
mischung. Es ist ja soviel einfacher, mit dem
erhobenen moralischen Zeigefingerzu sagen,
was wir nicht haben wollen, als zu sagen, was
wir haben wollen. Es gibt kein Feld, in dem
sich Design potentiell nicht einmischen könn-
te / sollte, denn die heutigen Problemsitu-
ationen laufen quer zu allen disziplinären
Gliederungen. Design hat die gute Voraus-
setzung, immerschon einen generalistischen
Anspruch zu vertreten. Allerdings muß die
Disziplin ihr Flandwerkszeug erweitern, um
diesem Anspruch gerecht zu werden.
Aber das wäre ein anderer Vortrag."
Flier ist er:
0 ZUM BEGRIFF: OBJEKT - PROZESS
Es geht nicht darum, einen Dualismus Objekt
vs. Prozeß zu konstruieren, um dann am Ende
eine Entscheidung zugunsten des einen oder
anderen zu fällen. Daß ZiviIisation und soziale
Systeme i.W. prozeßhaft-funktional be-
schreibbar sind (ELIAS, LUFIMANN), daß
Wahrnehmung ein permanenter rekursiver
Errechnungsprozeß ist (VON FOERSTER), daß
selbst massive Objekte auf subatomarer
Ebene prozeßhaft beschrieben werden
(PRIGOGINE, JANTSCFI), das alles kann man
heute wissen. Und es ändert nichts daran, daß
man sich an einem Tisch heftig das Schien-
bein stoßen kann. Abb. 1 zeigt Formbildung
in offenen Nichtgleichgewichtssystemen
(dissipativen Strukturen) und veranschaulicht
die Komplementarität von Objekt / Prozess
auf dieser phänomenalen Ebene. Die Unter-
scheidung erscheint für tragfähige Design-
theorie zu wenig komplex.
Stattdessen wird die Leitdlfferenz Struktur -
Prozeß verwendet, die auf einem soziologi-
schen, nicht objektbezogenen Strukturbegriff
beruht (Abb. 2). Die traditionelle Vorstellung,
Struktur und Prozeß verhielten sich wie das
Feste und das Fließende, wird - entsprechend
der funktional-strukturellen Systemtheorie -
durch die „Vorstellung ersetzt, die Funktion
der Differenzierungvon Strukturund Prozeß
liege in der Reduktion von Komplexität durch
doppelte Selektivität (WILLKE 1994: 79, 80).
In einer ersten Stufe (Struktur) wird ein a11-
gemeiner und relativfeststehender Kodex zu-
gelassener Möglichkeiten selektiert und in
einer zweiten Stufe (Prozeß) dann im Rah-
men dieses Kodex zwischen den bereits vor-
strukturierten und grobselektierten Alterna-
tiven entschieden. Das Risiko, in der Welt zu
leben, wird so geteilt: „Es wird im wesentli-
chen durch Strukturen absorbiert, im übrigen
fallweise abgearbeitet"(LUFIMANN, 1971:
120).
Abb. 1: Dissipative Struktur, zur Komplementarität
Objekt - Prozeß.
159
Design
als systemische Intervention -
für ein neues (altes)
„postheroisches"
Designverständnis
VORWORT
Am Schluß des Beitrags zum 16. design-
wissenschaftlichen Kolloquium (JONAS 1995)
hieß es:
„In einer kurz bevorstehenden Welt fast un-
begrenztertechnologischer Möglichkeiten ist
es nicht mehr angemessen, Design-Richtlini-
en in Begriffen von Material, Technik, Form,
etc. zu begründen, sondern in menschlichen
Werten. Und Werte entstehen aus Präferen-
zen. Und Präferenzen entstehen aus Auf-
merksamkeit. Design muß also Aufmerk-
samkeit herstellen für mögliche Zukünfte.
Dies bedeutet nicht Affirmation, sondern Ein-
mischung. Es ist ja soviel einfacher, mit dem
erhobenen moralischen Zeigefingerzu sagen,
was wir nicht haben wollen, als zu sagen, was
wir haben wollen. Es gibt kein Feld, in dem
sich Design potentiell nicht einmischen könn-
te / sollte, denn die heutigen Problemsitu-
ationen laufen quer zu allen disziplinären
Gliederungen. Design hat die gute Voraus-
setzung, immerschon einen generalistischen
Anspruch zu vertreten. Allerdings muß die
Disziplin ihr Flandwerkszeug erweitern, um
diesem Anspruch gerecht zu werden.
Aber das wäre ein anderer Vortrag."
Flier ist er:
0 ZUM BEGRIFF: OBJEKT - PROZESS
Es geht nicht darum, einen Dualismus Objekt
vs. Prozeß zu konstruieren, um dann am Ende
eine Entscheidung zugunsten des einen oder
anderen zu fällen. Daß ZiviIisation und soziale
Systeme i.W. prozeßhaft-funktional be-
schreibbar sind (ELIAS, LUFIMANN), daß
Wahrnehmung ein permanenter rekursiver
Errechnungsprozeß ist (VON FOERSTER), daß
selbst massive Objekte auf subatomarer
Ebene prozeßhaft beschrieben werden
(PRIGOGINE, JANTSCFI), das alles kann man
heute wissen. Und es ändert nichts daran, daß
man sich an einem Tisch heftig das Schien-
bein stoßen kann. Abb. 1 zeigt Formbildung
in offenen Nichtgleichgewichtssystemen
(dissipativen Strukturen) und veranschaulicht
die Komplementarität von Objekt / Prozess
auf dieser phänomenalen Ebene. Die Unter-
scheidung erscheint für tragfähige Design-
theorie zu wenig komplex.
Stattdessen wird die Leitdlfferenz Struktur -
Prozeß verwendet, die auf einem soziologi-
schen, nicht objektbezogenen Strukturbegriff
beruht (Abb. 2). Die traditionelle Vorstellung,
Struktur und Prozeß verhielten sich wie das
Feste und das Fließende, wird - entsprechend
der funktional-strukturellen Systemtheorie -
durch die „Vorstellung ersetzt, die Funktion
der Differenzierungvon Strukturund Prozeß
liege in der Reduktion von Komplexität durch
doppelte Selektivität (WILLKE 1994: 79, 80).
In einer ersten Stufe (Struktur) wird ein a11-
gemeiner und relativfeststehender Kodex zu-
gelassener Möglichkeiten selektiert und in
einer zweiten Stufe (Prozeß) dann im Rah-
men dieses Kodex zwischen den bereits vor-
strukturierten und grobselektierten Alterna-
tiven entschieden. Das Risiko, in der Welt zu
leben, wird so geteilt: „Es wird im wesentli-
chen durch Strukturen absorbiert, im übrigen
fallweise abgearbeitet"(LUFIMANN, 1971:
120).
Abb. 1: Dissipative Struktur, zur Komplementarität
Objekt - Prozeß.
159