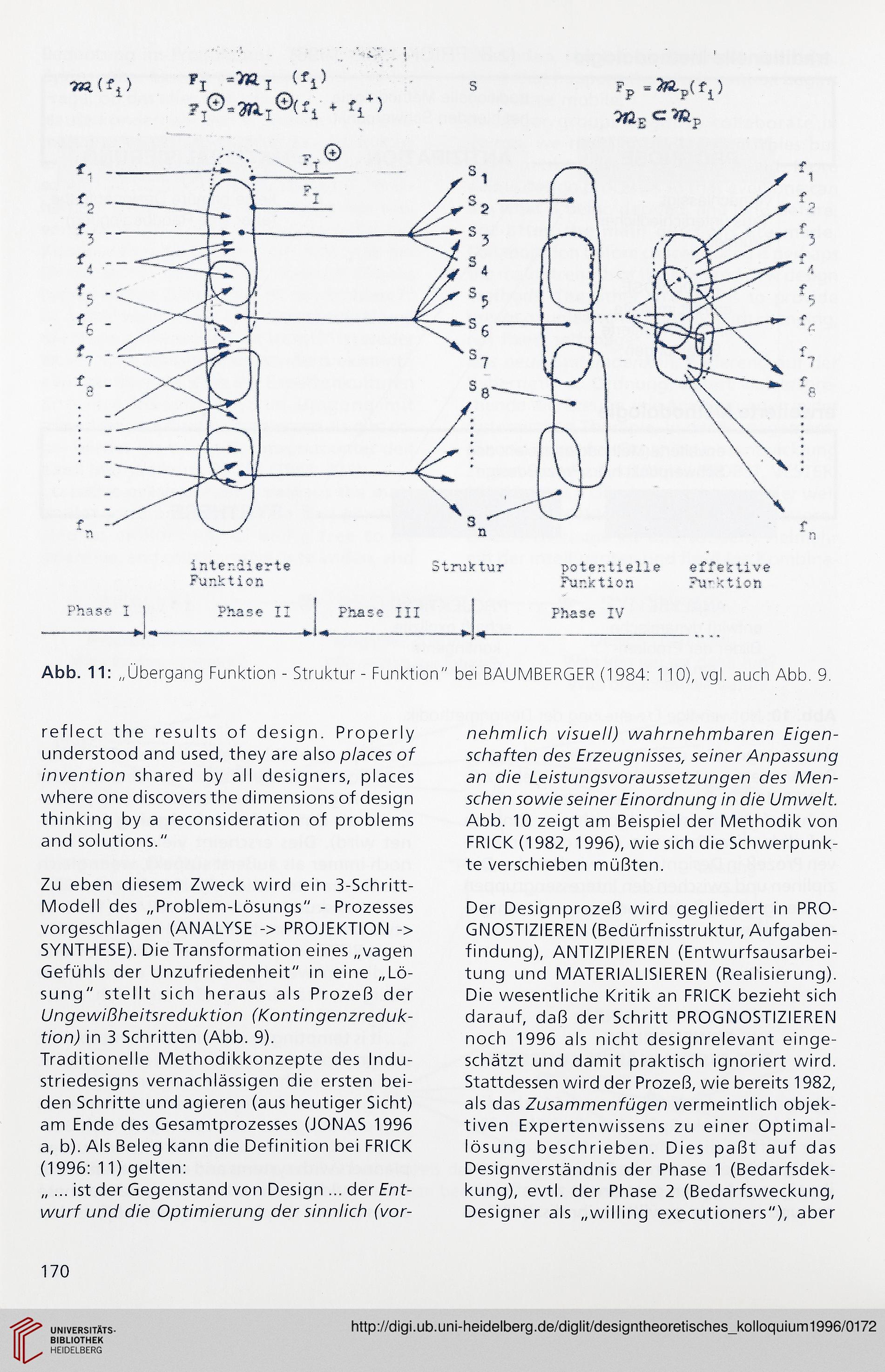Abb. 11: „Übergang Funktion - Struktur - Funktion" bei BAUMBERGER (1984: 110), vgl. auch Abb. 9
reflect the results of design. Properly
understood and used, they are also places of
inventlon shared by a11 designers, places
where one discovers the dimensions of design
thinking by a reconsideration of problems
and solutions."
Zu eben diesem Zweck wird ein 3-Schritt-
Modell des „Problem-Lösungs" - Prozesses
vorgeschlagen (ANALYSE -> PROJEKTION ->
SYNTHESE). Die Transformation eines „vagen
Gefühls der Unzufriedenheit" in eine „Lö-
sung" stellt sich heraus als Prozeß der
Ungewißheitsreduktion (Kontingenzreduk-
tion) in 3 Schritten (Abb. 9).
Traditionelle Methodikkonzepte des Indu-
striedesigns vernachlässigen die ersten bei-
den Schritte und agieren (aus heutiger Sicht)
am Ende des Gesamtprozesses (JONAS 1996
a, b). Als Beleg kann die Definition bei FRICK
(1996: 11) gelten:
„ ... ist der Gegenstand von Design ... der Ent-
wurf und die Optimierung der sinnlich (vor-
nehmlich visuell) wahrnehmbaren Eigen-
schaften des Erzeugnisses, seiner Anpassung
an die Leistungsvoraussetzungen des Men-
schen sowie seiner Einordnung in die Umwelt.
Abb. 10 zeigt am Beispiel der Methodik von
FRICK (1982, 1996), wie sich die Schwerpunk-
te verschieben müßten.
Der Designprozeß wird gegliedert in PRO-
GNOSTIZIEREN (Bedürfnisstruktur, Aufgaben-
findung), ANTIZIPIEREN (Entwurfsausarbei-
tung und MATERIALISIEREN (Realisierung).
Die wesentliche Kritik an FRICK bezieht sich
darauf, daß der Schritt PROGNOSTIZIEREN
noch 1996 als nicht designrelevant einge-
schätzt und damit praktisch ignoriert wird.
Stattdessen wird der Prozeß, wie bereits 1982,
als das Zusammenfügen vermeintlich objek-
tiven Expertenwissens zu einer Optimal-
lösung beschrieben. Dies paßt auf das
Designverständnis der Phase 1 (Bedarfsdek-
kung), evtl. der Phase 2 (Bedarfsweckung,
Designer als „willing executioners"), aber
170
reflect the results of design. Properly
understood and used, they are also places of
inventlon shared by a11 designers, places
where one discovers the dimensions of design
thinking by a reconsideration of problems
and solutions."
Zu eben diesem Zweck wird ein 3-Schritt-
Modell des „Problem-Lösungs" - Prozesses
vorgeschlagen (ANALYSE -> PROJEKTION ->
SYNTHESE). Die Transformation eines „vagen
Gefühls der Unzufriedenheit" in eine „Lö-
sung" stellt sich heraus als Prozeß der
Ungewißheitsreduktion (Kontingenzreduk-
tion) in 3 Schritten (Abb. 9).
Traditionelle Methodikkonzepte des Indu-
striedesigns vernachlässigen die ersten bei-
den Schritte und agieren (aus heutiger Sicht)
am Ende des Gesamtprozesses (JONAS 1996
a, b). Als Beleg kann die Definition bei FRICK
(1996: 11) gelten:
„ ... ist der Gegenstand von Design ... der Ent-
wurf und die Optimierung der sinnlich (vor-
nehmlich visuell) wahrnehmbaren Eigen-
schaften des Erzeugnisses, seiner Anpassung
an die Leistungsvoraussetzungen des Men-
schen sowie seiner Einordnung in die Umwelt.
Abb. 10 zeigt am Beispiel der Methodik von
FRICK (1982, 1996), wie sich die Schwerpunk-
te verschieben müßten.
Der Designprozeß wird gegliedert in PRO-
GNOSTIZIEREN (Bedürfnisstruktur, Aufgaben-
findung), ANTIZIPIEREN (Entwurfsausarbei-
tung und MATERIALISIEREN (Realisierung).
Die wesentliche Kritik an FRICK bezieht sich
darauf, daß der Schritt PROGNOSTIZIEREN
noch 1996 als nicht designrelevant einge-
schätzt und damit praktisch ignoriert wird.
Stattdessen wird der Prozeß, wie bereits 1982,
als das Zusammenfügen vermeintlich objek-
tiven Expertenwissens zu einer Optimal-
lösung beschrieben. Dies paßt auf das
Designverständnis der Phase 1 (Bedarfsdek-
kung), evtl. der Phase 2 (Bedarfsweckung,
Designer als „willing executioners"), aber
170